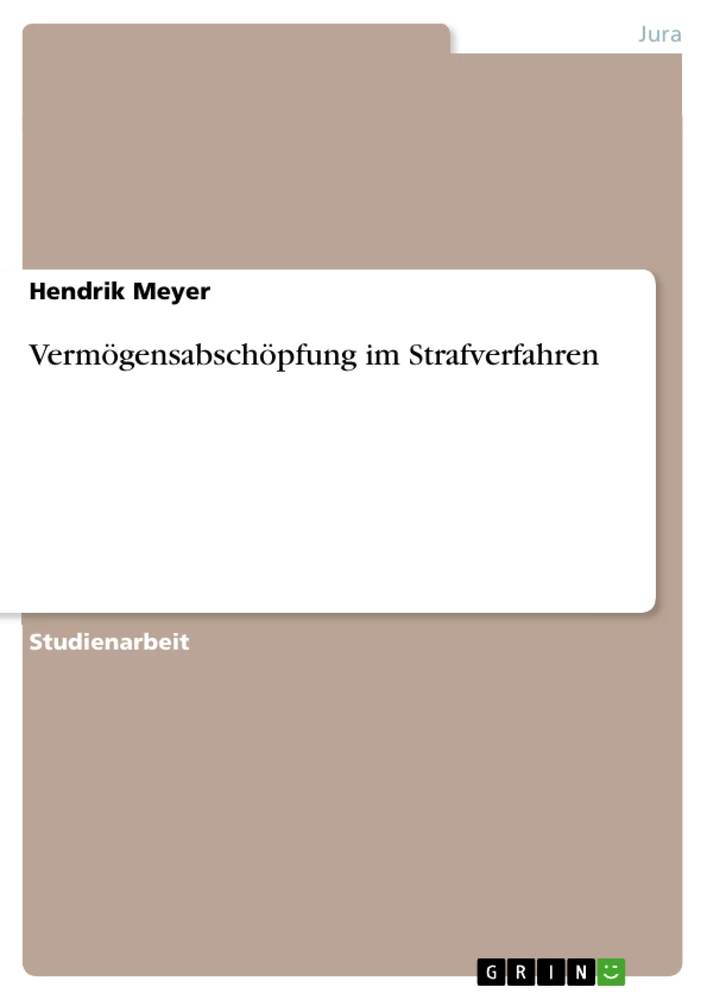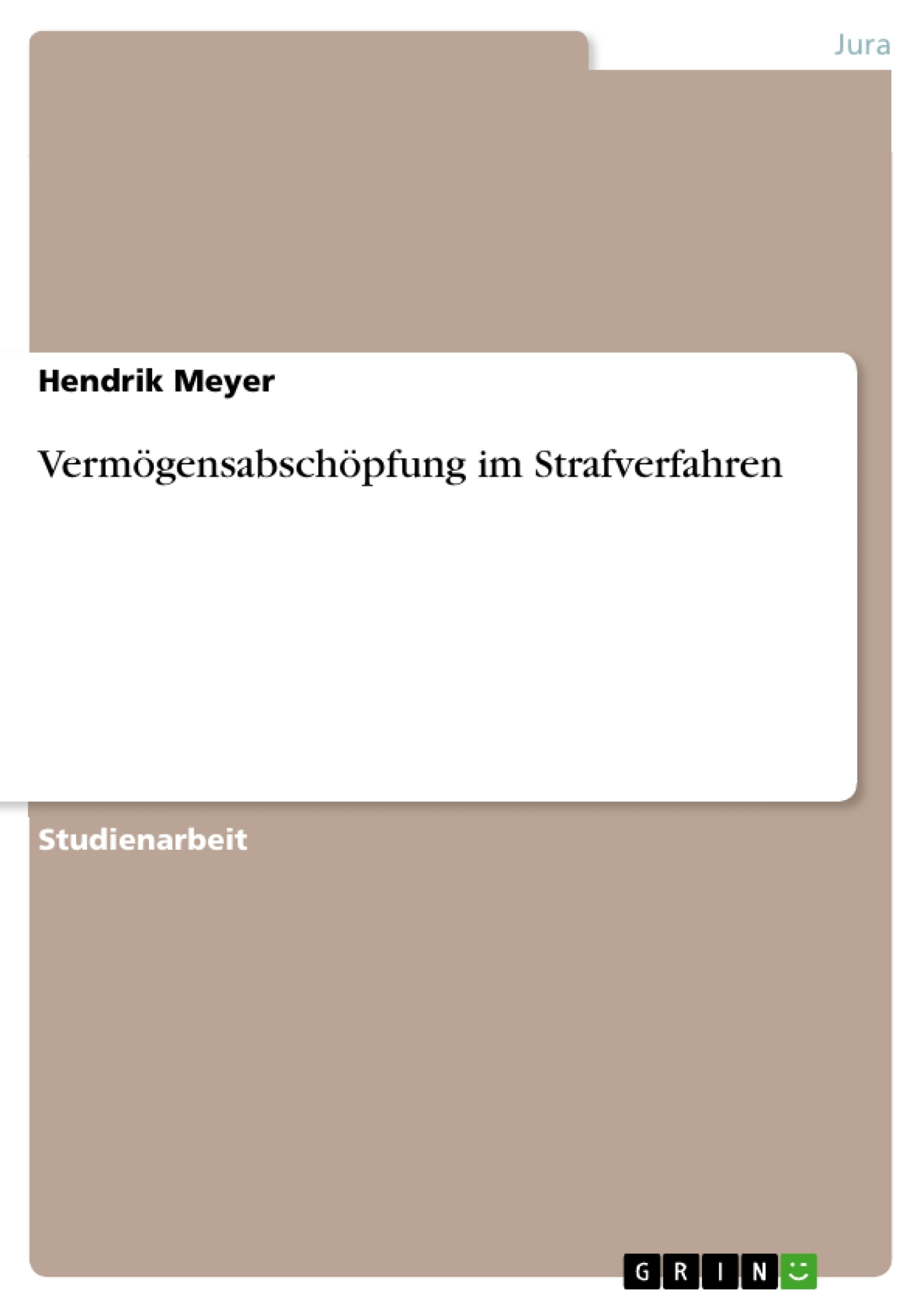Unter der Vermögensabschöpfung versteht man alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Vermögensvorteile, welche ein Täter oder Teilnehmer einer strafrechtlichen Tat an einem Dritten erlangt hat, „ … zugunsten der Verletzten der Tat oder des Staates [zu] entziehen.“
Es wurde als problematisch diskutiert, dass beschlagnahmte Vermögenswerte, die sich einer Straftat nicht konkret zuordnen ließen, an den Täter zurückgegeben wurden, wis-sentlich, dass diese Vermögenswerte aus einer Straftat stammten oder mit dieser in Verbindung standen. Auch die Rechtsprechung hat darauf reagiert und in unterschiedlichen Fällen zu Gunsten der Ordnungsbehörden entschieden. So wurde von einem polnischen Zigarettenschmuggler 93.450 € Bargeld und diverse Mobiltelefone sichergestellt und dem staatlichen Haushalt übergeben. In einem anderen Fall wird ein vermögensloser Straftäter beim Ladendiebstahl gefasst. Dieser stahl ca. 2000 Gegenstände im Wert von 128.000 €, welche von der Polizei beschlagnahmt wurde. Diese waren noch Original verpackt und mit Sicherheitsplaketten bestückt, wurden jedoch von den Ordnungsbehörden verwertet. Die Rechtsprechung hat jedoch der Verwertung durch den Staat Grenzen gesetzt. Auch im Gesetz wie z.B. § 73 I S.2 StGB, lassen sich Grenzen finden, mit dessen Zweck der Staat nicht alle sichergestellten Vermögenswerte verwerten kann.
Fraglich ist zudem, was passiert, wenn sich Rechtsgebiete aufgrund der Vermögensab-schöpfung überschneiden, welche in sich geschlossen sind. Insbesondere das Wirt-schaftsstrafrecht bezieht sich auf verschiedenste Rechtsgebiete. Claus stellt hierbei ein Paradebeispiel einer Überschneidung zur Verfügung. Wird dem Täter der rechtswidrig erlangte Vermögenswert entzogen und verlangt das Steuerrecht die Besteuerung des Gewinns, würde eine Doppelbelastung auf den Betroffenen treffen. Diese Tatsache würde jedoch gegen den Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 I GG verstoßen. Entsprechend wird dann entweder der Abschöpfungsbetrag bei der Einkommensbesteuerung abgesetzt oder die Bemessung der Einkommensteuer „ … nur der um die absehbare Einkommensteuer verminderte Betrag .. [wird zu Grunde] gelegt.“ Solche Beispiele gibt es auch an anderer Stelle.
Inhaltsverzeichnis
- A. Vermögensabschöpfung im Strafverfahren
- I. Gesetzliche Grundlage
- II. BGH Urteil Waffenhandel
- III. Adressatenkreis der Vermögensabschöpfung
- B. Sicherstellung
- I. Sicherungsmaßnahme
- II. Rückgewinnungshilfe
- 1. Voraussetzung
- 2. Anwendung
- III. Keine Sicherung nach StGB oder StPO möglich?
- C. Maßnahmen der Betroffenen
- I. Rechtsschutz
- II. Was kann der Geschädigte machen?
- D. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Vermögensabschöpfung im Strafverfahren. Ziel ist es, die gesetzlichen Grundlagen, die verschiedenen Maßnahmen der Vermögensabschöpfung und den Rechtsschutz der Betroffenen zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die Anwendung der Vermögensabschöpfung in der Praxis und diskutiert schwierige Punkte der Rechtsprechung.
- Gesetzliche Grundlagen der Vermögensabschöpfung
- Sicherstellung von Vermögenswerten im Strafverfahren
- Rechtsschutzmöglichkeiten für Betroffene
- Die Rolle des Geschädigten bei der Vermögensabschöpfung
- Problematische Aspekte der Rechtsprechung und Gesetzesanwendung
Zusammenfassung der Kapitel
A. Vermögensabschöpfung im Strafverfahren: Dieses Kapitel führt in das Thema der Vermögensabschöpfung ein und definiert die Maßnahmen, die zur Entziehung von Vermögensvorteilen dienen, die ein Täter oder Teilnehmer einer Straftat erlangt hat. Es werden anfängliche Probleme bezüglich der Rückgabe beschlagnahmter Vermögenswerte an den Täter diskutiert und die Reaktion der Rechtsprechung auf diese Problematik erläutert. Anhand von Beispielsfällen wird die Praxis der Vermögensabschöpfung illustriert, wobei die Grenzen der staatlichen Verwertung sichergestellter Vermögenswerte und die Problematik von Überschneidungen mit anderen Rechtsgebieten hervorgehoben werden. Der Gleichheitsgrundsatz im Kontext der Doppelbelastung wird ebenfalls thematisiert.
B. Sicherstellung: Dieses Kapitel behandelt die Sicherungsmaßnahmen nach §§ 111b-111p StPO, die dazu dienen, das Vermögen des Beschuldigten zu sichern, sowohl zugunsten des Staates als auch des Geschädigten. Es erläutert die verschiedenen Sicherungsmaßnahmen wie Beschlagnahme, dinglichen Arrest und Notveräußerung und diskutiert die verfassungsrechtlichen Aspekte dieser Eingriffe in die privatrechtliche Sphäre des Betroffenen. Die Beweislastregelung nach § 1006 II BGB und die Rolle von Indizien bei der Beweisführung werden beleuchtet. Weiterhin wird die Rückgewinnungshilfe nach § 111b V StPO detailliert erklärt, einschließlich der Voraussetzungen und Anwendung, sowie die Problematik des Ausschlussgrunds des Verfalls nach § 73 I S.2 StGB ("Totengräber des Verfalls"). Die kritische Betrachtung der Anwendung der Rückgewinnungshilfe in der Praxis und die Gesetzesänderung von 2006 werden ebenfalls behandelt. Schließlich wird der Fall diskutiert, dass keine Sicherung nach StGB oder StPO möglich ist, und alternative Möglichkeiten der Sicherstellung vorgestellt.
C. Maßnahmen der Betroffenen: Dieses Kapitel untersucht den Rechtsschutz der Betroffenen im Verfahren der Vermögensabschöpfung. Es beschreibt die verschiedenen Rechtsmittel, die den Beteiligten zur Verfügung stehen, um Anordnungen wie Verfall oder Beschlagnahme anzufechten. Es wird der Rechtsschutz für nicht tatbeteiligte Dritte betrachtet, die sich auf den verfallenen Gegenstand berufen, und die Möglichkeiten zivilrechtlicher Klagen, Feststellungsklagen und Einwendungen gegen die Vollstreckung erörtert. Das Kapitel beleuchtet auch die Rolle und Möglichkeiten des Geschädigten im Verfahren, einschließlich der Mitteilungspflicht der Staatsanwaltschaft, der Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen und der praktischen Schwierigkeiten bei der Befriedigung der Gläubiger.
Schlüsselwörter
Vermögensabschöpfung, Strafverfahren, Gesetzliche Grundlage, Sicherstellung, Rückgewinnungshilfe, Rechtsschutz, Geschädigter, Täter, Beschlagnahme, Arrest, Verfall, § 73 StGB, § 111b StPO, Gleichheitsgrundsatz, Doppelbelastung, BGH-Rechtsprechung.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Vermögensabschöpfung im Strafverfahren
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich umfassend mit der Vermögensabschöpfung im Strafverfahren. Sie beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen, die verschiedenen Maßnahmen der Vermögensabschöpfung (z.B. Sicherstellung, Verfall), den Rechtsschutz der Betroffenen und die Rolle des Geschädigten.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit analysiert die gesetzlichen Grundlagen der Vermögensabschöpfung, die verschiedenen Sicherungsmaßnahmen (Beschlagnahme, Arrest etc.) nach §§ 111b-111p StPO, die Rückgewinnungshilfe (§ 111b V StPO), den Rechtsschutz der Betroffenen (einschließlich nicht tatbeteiligter Dritter), die Möglichkeiten zivilrechtlicher Klagen und die praktische Anwendung der Vermögensabschöpfung anhand von Beispielsfällen und Rechtsprechungsentscheidungen. Problematische Aspekte der Rechtsprechung und Gesetzesanwendung, wie z.B. die Doppelbelastung und die Problematik von Überschneidungen mit anderen Rechtsgebieten, werden ebenfalls diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel A. Vermögensabschöpfung im Strafverfahren, B. Sicherstellung, C. Maßnahmen der Betroffenen und D. Fazit. Kapitel A führt in das Thema ein und behandelt anfängliche Probleme bezüglich der Rückgabe beschlagnahmter Vermögenswerte. Kapitel B konzentriert sich auf die Sicherungsmaßnahmen nach StPO, inklusive der Rückgewinnungshilfe und der Problematik des Verfalls nach § 73 I S.2 StGB. Kapitel C untersucht den Rechtsschutz der Betroffenen und die Rolle des Geschädigten. Kapitel D fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Rechtsvorschriften spielen eine zentrale Rolle?
Zentrale Rechtsvorschriften sind §§ 111b-111p StPO (Sicherstellungsmaßnahmen), § 73 StGB (Verfall) und § 1006 II BGB (Beweislastregelung). Das BGH-Urteil zum Waffenhandel wird ebenfalls behandelt.
Wer sind die Adressaten der Vermögensabschöpfung?
Die Arbeit beleuchtet den Adressatenkreis der Vermögensabschöpfung, d.h. wer von den Maßnahmen der Vermögensabschöpfung betroffen sein kann (Täter, Teilnehmer, Dritte).
Welche Möglichkeiten des Rechtsschutzes bestehen für Betroffene?
Die Arbeit beschreibt die verschiedenen Rechtsmittel, die Betroffenen zur Verfügung stehen, um Anordnungen wie Verfall oder Beschlagnahme anzufechten, einschließlich zivilrechtlicher Klagen und Feststellungsklagen. Der Rechtsschutz für nicht tatbeteiligte Dritte wird ebenfalls betrachtet.
Welche Rolle spielt der Geschädigte bei der Vermögensabschöpfung?
Die Arbeit untersucht die Rolle und Möglichkeiten des Geschädigten im Verfahren, einschließlich der Mitteilungspflicht der Staatsanwaltschaft und der Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Vermögensabschöpfung, Strafverfahren, Gesetzliche Grundlage, Sicherstellung, Rückgewinnungshilfe, Rechtsschutz, Geschädigter, Täter, Beschlagnahme, Arrest, Verfall, § 73 StGB, § 111b StPO, Gleichheitsgrundsatz, Doppelbelastung, BGH-Rechtsprechung.
Wo finde ich weitere Informationen?
Diese FAQ bieten eine Zusammenfassung der Seminararbeit. Für detaillierte Informationen wird auf den Volltext der Seminararbeit verwiesen. (Hinweis: Der Volltext wurde nicht hier bereitgestellt).
- Quote paper
- LL.B. Hendrik Meyer (Author), 2012, Vermögensabschöpfung im Strafverfahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/199940