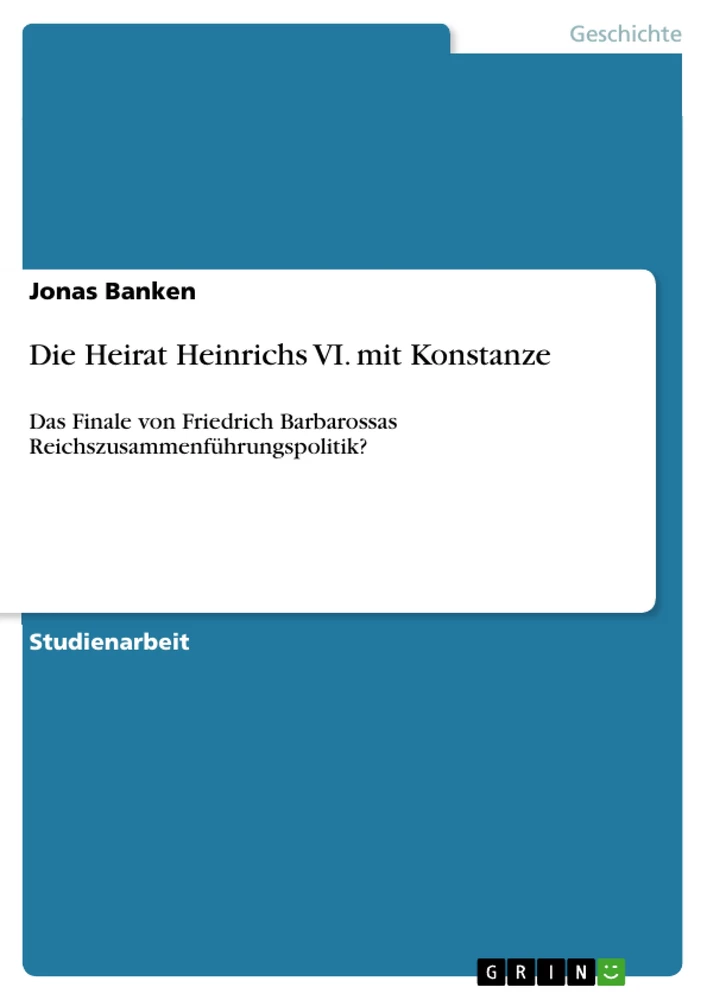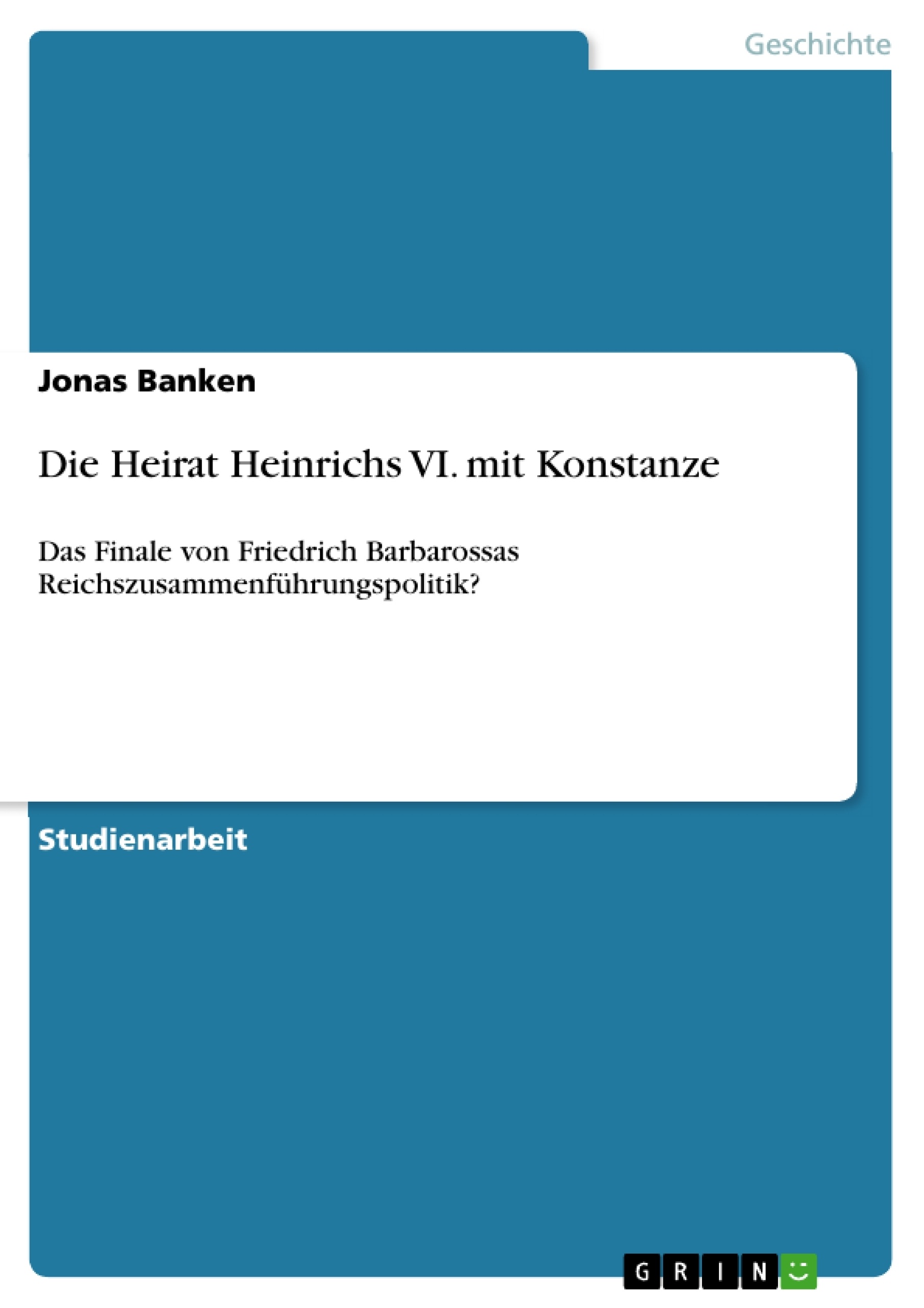Eine aggressive Expansionspolitik der Herrscher im Hochmittelalter war keine Seltenheit. Es wurden Heereszüge in gegnerische Territorien unternommen – oft legitimiert durch alte Rechte oder Erbansprüche. Auch Friedrich Barbarossa versuchte zu seinen Lebzeiten, Ansprüche auf Süditalien, beruhend auf dem alten Reichsrecht, dem antiquum ius imperii, geltend zu machen. Nachdem sich militärisch kein Erfolg einstellte, wurde eine diplomatische Lösung in Form des Friedens von Venedig 1177 gesucht. Doch noch immer schien Friedrich I. seine Ambitionen, eine Verbindung zwischen dem Regnum im Süden Italiens und dem Imperium herzustellen, nicht aufgegeben zu haben. Eine Heirat zwischen dem Sohn des Staufers, Heinrich VI., und Konstanze, der Tante des Normannenkönigs Wilhelm II. und Eventualthronfolgerin bei einem kinderlosen Tod Wilhelms, sollte diese Allianz zwischen Sizilien und den Staufern doch noch ermöglichen. Dass der Normannenherrscher wirklich wenige Jahre später, 1189, kinderlos starb und Heinrich VI. über Konstanze Ansprüche auf Unteritalien anmelden konnte, erfüllte Barbarossa den lange gehegten Wunsch einer Vereinigung des Regnum mit dem Imperium. Fraglich ist jedoch, ob Friedrich I. schon bei der Verlobung 1184 mit diesem Fall der Erbfolge rechnete und er mit diesem Hintergedanken die Hochzeit initiierte.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Hinführung zum Thema
- 2 Das alte Reichsrecht antiquum ius imperii
- 3 Friedrichs Versuche, sich Unteritaliens zu bemächtigen bis zur Verlobung Heinrichs VI. mit Konstanze
- 4 Wer gibt den Anstoß zur Heirat?
- 4.1 Argumente für Friedrich Barbarossa
- 4.2 Wilhelm II. als Initiator
- 4.3 Der Papst vermittelte das Ehebündnis
- 4.4 Heinrich II. von England wollte von der Hochzeit profitieren
- 5 War die Kinderlosigkeit Wilhelms II. bereits 1184 abzusehen?
- 6 Beim Tod Wilhelms II. 1189 – welche Chancen hat Konstanze, sich (als Frau) gegen Tankred von Lecce durchzusetzen?
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Heiratspolitik Friedrich Barbarossas und die Verlobung seines Sohnes Heinrich VI. mit Konstanze von Sizilien im Jahr 1184. Die zentrale Frage ist, ob Barbarossa bereits damals mit der Erbfolge Konstanzes und der damit verbundenen Vereinigung des Regnum Siciliae mit dem Heiligen Römischen Reich rechnete und die Hochzeit initiierte. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Grundlagen der staufischen Ansprüche auf Süditalien, die Motive der beteiligten Akteure und die politische Situation in Süditalien.
- Das antiquum ius imperii als rechtliche Grundlage der staufischen Ansprüche auf Süditalien
- Die Rolle Friedrich Barbarossas, Wilhelms II., des Papstes und Heinrichs II. von England bei der Verlobung
- Die Absehbarkeit der Kinderlosigkeit Wilhelms II. im Jahr 1184
- Konstanzes Chancen, sich nach dem Tod Wilhelms II. durchzusetzen
- Die Bedeutung der Heirat für die Reichszusammenführungspolitik Friedrich Barbarossas
Zusammenfassung der Kapitel
1 Hinführung zum Thema: Die Arbeit untersucht die Frage, ob Friedrich Barbarossa die Verlobung seines Sohnes Heinrich VI. mit Konstanze von Sizilien im Jahr 1184 mit dem Ziel der Erbfolge und der Vereinigung des Regnum Siciliae mit dem Heiligen Römischen Reich plante. Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Grundlagen der staufischen Ansprüche und analysiert die Motive der beteiligten Parteien, inklusive der Rolle von Wilhelm II. und des Papstes. Sie wird die Absehbarkeit von Wilhelms Kinderlosigkeit und Konstanzes Chancen, sich in Sizilien durchzusetzen, untersuchen.
2 Das alte Reichsrecht antiquum ius imperii: Dieses Kapitel erläutert das "antiquum ius imperii", die Rechtsgrundlage, auf die sich die Staufer bei ihren Ansprüchen auf Süditalien beriefen. Es wird dargestellt, wie die Staufer sich als Nachfolger der römischen Kaiser sahen und dieses Recht als Legitimation für ihre Expansionspolitik nutzten. Die wachsende antistaufische Koalition in Italien, bestehend aus dem Papsttum, den Normannen und lombardischen Städten, wird als ein wichtiger Faktor für die Intensivierung der staufischen Süditalienpolitik dargestellt. Der Konflikt mit dem Papsttum und die Bündnisse der Normannen mit Byzanz werden als wesentliche Herausforderungen für Barbarossa's Herrschaft beschrieben.
3 Friedrichs Versuche, sich Unteritaliens zu bemächtigen bis zur Verlobung Heinrichs VI. mit Konstanze: Dieses Kapitel beschreibt die gescheiterten militärischen Versuche Friedrich Barbarossas, Süditalien zu erobern. Die Arbeit zeigt die verschiedenen Feldzüge auf, die aufgrund von innenpolitischen und außenpolitischen Ereignissen immer wieder verschoben oder abgebrochen wurden. Barbarossas stetige Bemühungen um die "Unio regni ad imperium" werden im Kontext der politischen Konstellation der Zeit analysiert – eine Koalition bestehend aus Byzanz, dem Papst und den Normannen stellte dabei eine große Herausforderung dar. Die Kapitel beleuchtet das Scheitern der militärischen Strategie und die Notwendigkeit einer diplomatischen Lösung.
4 Wer gibt den Anstoß zur Heirat?: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Perspektiven und Theorien zur Frage, wer die Verlobung initiierte. Es werden Argumente für Friedrich Barbarossa, Wilhelm II., den Papst und Heinrich II. von England präsentiert und diskutiert. Die unterschiedlichen Interessen und Ziele der beteiligten Akteure werden detailliert beleuchtet, wobei die möglichen Motive und Strategien jeder Partei im Kontext der politischen Lage eingeordnet werden.
5 War die Kinderlosigkeit Wilhelms II. bereits 1184 abzusehen?: Dieses Kapitel untersucht, ob die Kinderlosigkeit Wilhelms II. bereits im Jahr 1184 absehbar war und inwieweit dies die Heiratspolitik der Staufer beeinflusste. Die Analyse dieses Punktes ist entscheidend für die Beantwortung der Hauptfrage, ob Barbarossa die Heirat mit dem Hintergedanken der Erbfolge plante.
6 Beim Tod Wilhelms II. 1189 – welche Chancen hat Konstanze, sich (als Frau) gegen Tankred von Lecce durchzusetzen?: Dieses Kapitel analysiert die Situation Konstanzes nach dem Tod Wilhelms II. und ihre Chancen, sich gegen Tankred von Lecce, einen Konkurrenten um den sizilianischen Thron, durchzusetzen. Die Erfolgsaussichten Konstanzes sind entscheidend für die Beurteilung, ob Barbarossas Plan, das Regnum Siciliae durch die Heirat zu erlangen, realistisch war.
Schlüsselwörter
Friedrich Barbarossa, Heinrich VI., Konstanze von Sizilien, Antiquum ius imperii, Unio regni ad imperium, Normannenreich, Sizilien, Heiliges Römisches Reich, Heiratspolitik, Erbfolge, Papst, Wilhelm II., Tankred von Lecce, Reichszusammenführung.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Heiratspolitik Friedrich Barbarossas und die Verlobung Heinrichs VI. mit Konstanze von Sizilien
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Heiratspolitik Friedrich Barbarossas und die Verlobung seines Sohnes Heinrich VI. mit Konstanze von Sizilien im Jahr 1184. Im Kern geht es um die Frage, ob Barbarossa bereits damals die Erbfolge Konstanzes und die damit verbundene Vereinigung des Regnum Siciliae mit dem Heiligen Römischen Reich plante und die Hochzeit initiierte.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die rechtlichen Grundlagen der staufischen Ansprüche auf Süditalien (das antiquum ius imperii), die Motive der beteiligten Akteure (Friedrich Barbarossa, Wilhelm II., der Papst, Heinrich II. von England), die politische Situation in Süditalien, die Absehbarkeit der Kinderlosigkeit Wilhelms II. im Jahr 1184 und Konstanzes Chancen, sich nach dessen Tod durchzusetzen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung der Heirat für die Reichszusammenführungspolitik Friedrich Barbarossas.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es jeweils?
Die Arbeit besteht aus sieben Kapiteln: Kapitel 1 führt in das Thema ein. Kapitel 2 erläutert das antiquum ius imperii. Kapitel 3 beschreibt Friedrichs gescheiterte Versuche, Süditalien militärisch zu erobern. Kapitel 4 analysiert, wer die Verlobung initiierte. Kapitel 5 untersucht die Absehbarkeit der Kinderlosigkeit Wilhelms II. Kapitel 6 beleuchtet Konstanzes Chancen nach Wilhelms Tod. Kapitel 7 fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Rolle spielte das "antiquum ius imperii"?
Das "antiquum ius imperii" bildete die rechtliche Grundlage der staufischen Ansprüche auf Süditalien. Die Staufer sahen sich als Nachfolger der römischen Kaiser und nutzten dieses Recht zur Legitimation ihrer Expansionspolitik. Der Konflikt mit einer antistaufischen Koalition (Papsttum, Normannen, lombardische Städte) wird als wichtiger Faktor für die staufische Süditalienpolitik dargestellt.
Welche Personen spielten eine wichtige Rolle?
Wichtige Akteure sind Friedrich Barbarossa, sein Sohn Heinrich VI., Konstanze von Sizilien, Wilhelm II. von Sizilien, der Papst und Tankred von Lecce. Die Arbeit analysiert die Motive und Strategien jeder Partei im Kontext der politischen Lage.
War die Kinderlosigkeit Wilhelms II. bereits 1184 absehbar?
Die Arbeit untersucht, ob die Kinderlosigkeit Wilhelms II. im Jahr 1184 absehbar war und welchen Einfluss dies auf die Heiratspolitik der Staufer hatte. Diese Frage ist entscheidend für die Beantwortung der Hauptfrage nach Barbarossas Zielen.
Welche Chancen hatte Konstanze nach dem Tod Wilhelms II.?
Die Arbeit analysiert Konstanzes Chancen, sich nach dem Tod Wilhelms II. gegen Tankred von Lecce, einen Konkurrenten um den sizilianischen Thron, durchzusetzen. Der Erfolg Konstanzes war entscheidend für die Realisierbarkeit von Barbarossas Plan, das Regnum Siciliae durch die Heirat zu erlangen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Barbarossa, Heinrich VI., Konstanze von Sizilien, Antiquum ius imperii, Unio regni ad imperium, Normannenreich, Sizilien, Heiliges Römisches Reich, Heiratspolitik, Erbfolge, Papst, Wilhelm II., Tankred von Lecce, Reichszusammenführung.
- Arbeit zitieren
- Jonas Banken (Autor:in), 2012, Die Heirat Heinrichs VI. mit Konstanze, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/199816