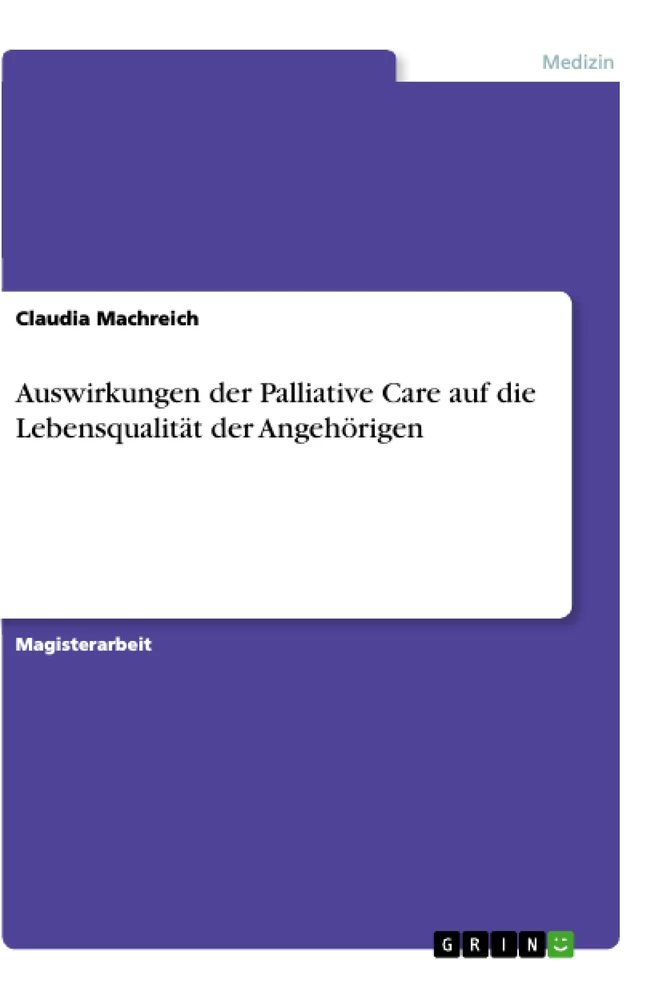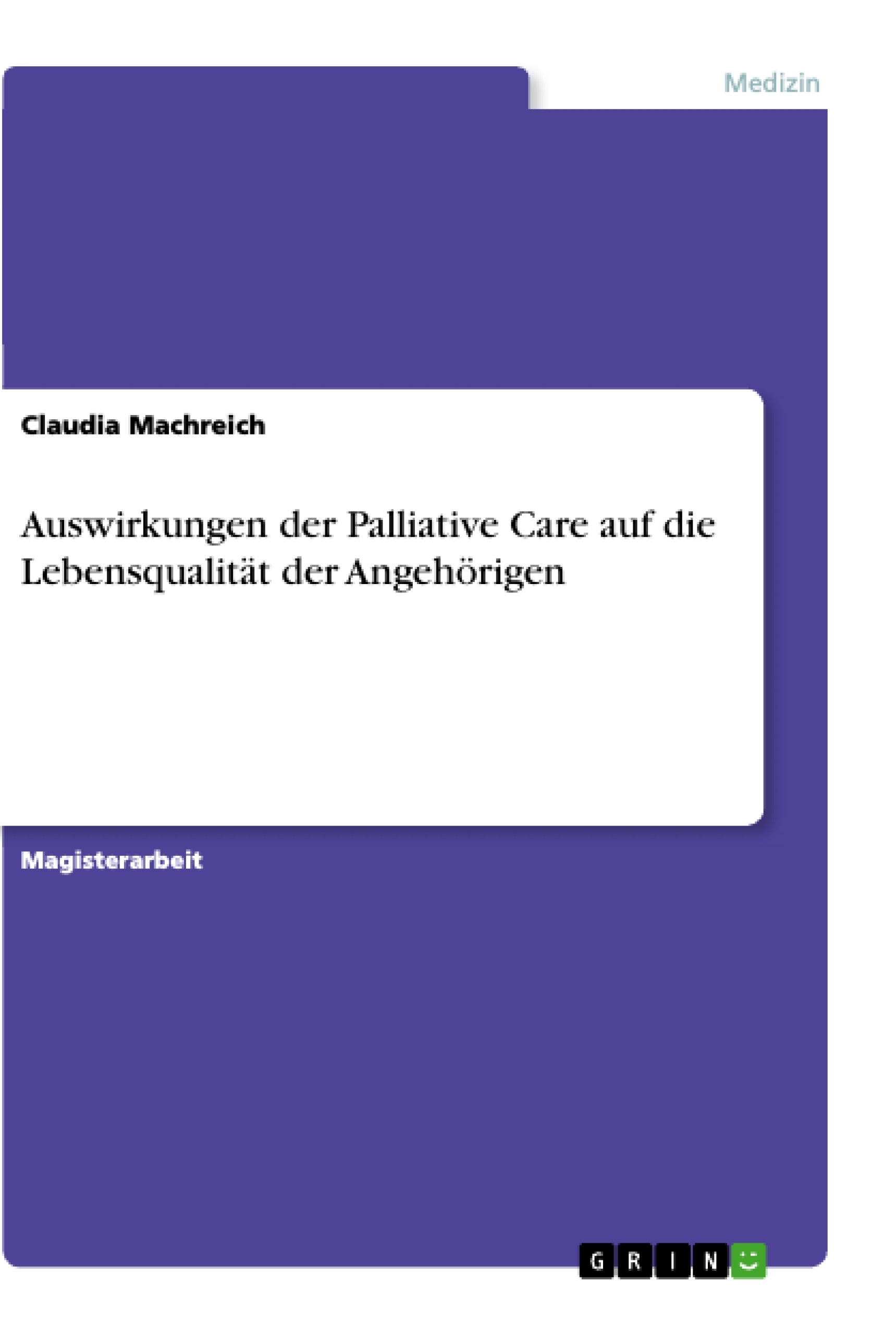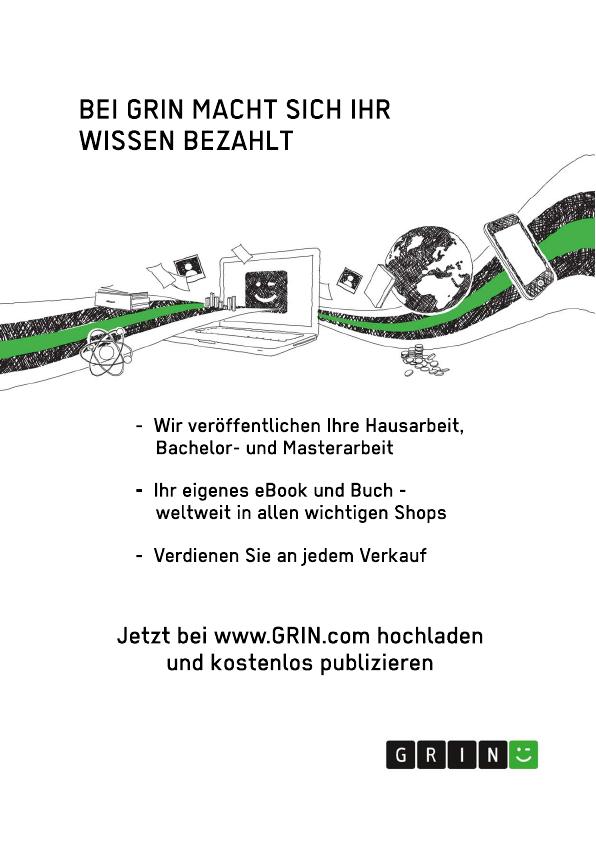Abstract
Experten zufolge erhöht der demografische Wandel und die Institutionalisierung
die Lebenserwartung und verlängert den Sterbevorgang. In den stationären Einrichtungen
liegt der Fokus auf der Verhinderung des Todes. Das Begleiten und
das Krankheitserleben der Angehörigen treten in den Hintergrund.
Angehörige erreichen die Grenzen ihrer Belastbarkeit, da der Betreuungsaufwand
für die sterbenden Personen bis auf 24 Stunden täglich steigt. Emotionale
Erschöpfung und psychische Belastungen mit Symptomen von Angst und Depression
werden von den Angehörigen berichtet.
Palliative Care wirkt sich bei den Angehörigen positiv auf die Lebensqualität aus,
da sie individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse der Angehörigen eingeht. Angehörige
erleben durch die Palliative Care eine große Unterstützung in der Betreuung
ihrer schwer erkrankten und sterbenden Familienmitglieder und Partner.
Als Hauptentlastung werden die gute Erreichbarkeit am Tag und die schnelle Hilfe
durch die Mitglieder der Palliativ Care beschrieben.
Ein Ziel der Studie war es, die Auswirkungen der Palliative Care auf die Lebensqualität
der Angehörigen zu erheben und aufzuzeigen. Weiter wird auf die Wünsche
und Erwartungen der Angehörigen an das mobile Palliativteam (MPT) der
Caritas Salzburg eingegangen.
Die demographische Entwicklung und die damit verbundene Verlängerung des
Sterbeprozesses zeigt deutlich die Dringlichkeit, die Lebensqualität der Angehörigen
zu thematisieren und die Unterstützungsmöglichkeiten der mobilen Palliativteams
weiter auszubauen.
Schlüsselwörter: Palliative Care, Lebensqualität, Angehöriger
Inhaltsverzeichnis
1 EINLEITUNG
1.1 PROBLEMSTELLUNG
1.2 ZIELE
1.3 PFLEGEWISSENSCHAFTLICHE RELEVANZ
1.4 STRUKTUR DER ARBEIT
2 THEORETISCHER TEIL
2.1 LITERATURRECHERCHE
2.1.1 Suchstrategie und Literaturauswahl
2.2 DEMOGRAPHISCHER WANDEL UND MORTALITÄT
2.3 PFLEGELEISTUNGEN DURCH ANGEHÖRIGE
2.4 BELASTUNGEN DER ANGEHÖRIGEN
2.5 BEGRIFFSDEFINITIONEN
2.5.1 Palliative Care
2.5.2 Lebensqualität
2.5.3 Angehörige
2.5.4 Mobiles Palliativteam
2.6 FINANZIERUNG DER HOSPIZ,- UND PALLIATIVEINRICHTUNGEN
2.7 MOBILES PALLIATIVTEAM (MPT) DER CARITAS SALZBURG
2.8 EPIDEMIOLOGISCHE DATEN
3 METHODE
3.1 FORSCHUNGSFRAGE
3.2 QUALITATIVER FORSCHUNGSANSATZ
3.3 BEGRÜNDUNG ZUR WAHL FÜR DEN QUALITATIVEN FORSCHUNGSANSATZ
3.4 QUALITATIVE SOZIALFORSCHUNG NACH MAYRING
3.4.1 Verfahrensdokumentation
3.4.2 Argumentative Interpretationsabsicherung
3.4.3 Regelgeleitheit
3.4.4 Nähe zum Gegenstand
3.4.5 Kommunikative Validierung
3.4.6 Triangulation
3.5 ZUGANG ZUM FORSCHUNGSFELD
3.6 ZU ERWARTENDE ERGEBNISSE UND PROBLEME
3.7 FORSCHUNGSGRUPPE UND FORSCHUNGSRAUM
3.8 ERHEBUNGSINSTRUMENT
3.8.1 Erhebungsinstrument für die Erfassung der Auswirkung der Palliative Care auf die Lebensqualität der Angehörigen
3.9 DURCHFÜHRUNG DER INTERVIEWS
3.10 AUSWERTUNG DER DATEN
4 DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE
4.1 SOZIODEMOGRAFISCHE DATEN DER ANGEHÖRIGEN
4.2 KATEGORIENSYSTEM
4.3 ERFAHRUNGEN VOR DER BETREUUNG VON PALLIATIVE CARE
4.4 ERWARTUNGEN AN DIE PALLIATIVE CARE
4.5 LEBENSQUALITÄT FÜR DEN STERBENDEN MENSCHEN
4.6 INTERDISZIPLINÄRE ZUSAMMENARBEIT
4.7 LEBENSQUALITÄT DER ANGEHÖRIGEN
4.8 UMGANG MIT TROST UND TRAUER
4.9 HINDERLICHE ASPEKTE DER PALLIATIVE CARE
4.10 WÜNSCHE AN DIE PALLIATIVE CARE
4.11 WÜNSCHE AN DIE PALLIATIVE CARE
4.12 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE
5 DISKUSSION
5.1 IMPLIKATIONEN FÜR DIE PRAXIS
5.2 LIMITATIONEN
5.3 SCHLUSSFOLGERUNGEN MIT AUSBLICK
6 LITERATURVERZEICHNIS
7 ANHANG
7.1 ANHANG 1
7.2 ANHANG 2
Danksagung
An erster Stelle möchte ich die Angehörigen nennen, die sich an den Interviews beteiligt haben. Einen besonderen Dank schulde ich den Angehörigen, die sich zu den ausführlichen und oft belastenden Gesprächen für die Interviews bereit erklärt haben. Ihnen möchte ich diese Studie widmen in der Hoffnung, dass meine Er- gebnisse zu einer verstärkten Berücksichtigung ihrer besonderen Situation beitra- gen. Recht herzlich bedanke ich mich an dieser Stelle bei den Angehörigen der Studie für ihre Bereitschaft und das Vertrauen, das sie mir im Rahmen der Inter- views geschenkt haben.
Für die Unterstützung und fachliche Hilfe, sowie für Anregungen und Ratschläge, darf ich mich an dieser Stelle bei Frau Univ. Prof. Dr. Christa Them, Herrn Univ. Prof. Dr. Bernd Seeberger, Frau Dr. Andrea Haselwanter - Schneider, sowie Herrn Dr. David Rester recht herzlich bedanken. Ein herzliches Dankeschön gilt Frau Prof. Dr. Fritz, die mit ihrer Empathie und Ihrer Menschlichkeit dem Studium eine besondere Note verliehen hat. Bedanken möchte ich mich bei dem Studienma- nagement für die organisatorische Hilfe, im Speziellen bei Frau Daniela Margreiter und Frau Katharina Bortolotti.
Danken möchten wir ferner den ärztlichen und nichtärztlichen Mitarbeitern in den mobilen Palliativteams (MPT) der Caritas Salzburg, die mir den Zugang zu den Angehörigen vermittelten. Namentlich erwähnen möchte ich den Leitern der Pallia- tive Care Frau Dr. Groh und Herrn Mag. Neureiter, die sich für Expertengespräche zur Verfügung gestellt haben und mir wertvolle Einblicke in die besondere Situati- on der Angehörigen mit Palliative Care vermittelt haben. Durch ihre Unterstützung bei inhaltlichen Fragen zu meinem Thema, konnte die Arbeit weiter optimiert wer- den. Von Herzen bedanke ich mich für die Unterstützung in der Koordination der Interviews bei allen Teams.
Mein ganz besonderer Dank gilt meinem Lebensgefährten Franz Seitinger, sowie meinen Kindern Michi und Daniel für ihre Liebe und fortwährende Unterstützung, für die starke Motivation und im Besonderen für ihr Verständnis in den Jahren des Studiums.
Ich bin stolz euch zu haben. Danke.
Auch meinen Eltern sei an dieser Stelle von Herzen gedankt. Unsere Gespräche und ihre moralische Unterstützung waren eine Bereicherung bei dieser Arbeit.
Nicht zuletzt ein Dankeschön an all jene, die mir dieses Studium ermöglicht ha- ben.
Abstract
Experten zufolge erhöht der demografische Wandel und die Institutionalisierung die Lebenserwartung und verlängert den Sterbevorgang. In den stationären Einrichtungen liegt der Fokus auf der Verhinderung des Todes. Das Begleiten und das Krankheitserleben der Angehörigen treten in den Hintergrund. Angehörigen erreichen die Grenzen ihrer Belastbarkeit, da der Betreuungsaufwand für die sterbenden Personen bis auf 24 Stunden täglich steigt. Emotionale Erschöpfung und psychische Belastungen mit Symptomen von Angst und Depression werden von den Angehörigen berichtet.
Palliative Care wirkt sich bei den Angehörigen positiv auf die Lebensqualität aus, da sie individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse der Angehörigen eingeht. Angehörige erleben durch die Palliative Care eine große Unterstützung in der Betreuung Ihrer schwer erkrankten und sterbenden Familienmitglieder und Partner. Als Hauptentlastung werden die gute Erreichbarkeit am Tag und die schnelle Hilfe durch die Mitglieder der Palliativ Care beschrieben.
Ein Ziel der Studie war es, die Auswirkungen der Palliative Care auf die Lebensqualität der Angehörigen zu erheben und aufzuzeigen. Weiter wird auf die Wünsche und Erwartungen der Angehörigen an das mobile Palliativteam (MPT) der Caritas Salzburg eingegangen.
Die demographische Entwicklung und die damit verbundene Verlängerung des Sterbeprozesses zeigt deutlich die Dringlichkeit, die Lebensqualität der Angehörigen zu thematisieren und die Unterstützungsmöglichkeiten der mobilen Palliativteams weiter auszubauen.
Schlüsselwörter: Palliative Care, Lebensqualität, Angehöriger
Abstract
According to experts, increasing demographic change and the institutionalization of the life expectancy and extends the dying process. In patient facilities, the focus is on the prevention of death. Accompanying the experience of illness and the family into the background.
Members reach their limits, since the Care expenses for persons dying every day to increase to 24 hours. Emotional exhaustion and mental stress with symptoms of anxiety and depression are reported by their relatives.
Palliative care has a positive impact on the families with the quality of life, as it is received to the individual needs and wishes of the relatives. Experienced by members of the palliative care a great support in the care of your seriously ill and dying family members and partners.
As a major relief during the day and the easy accessibility to the rescue by members of the palliative care are described.
One goal of this study was to bring the impact of palliative care on the quality of life for families and show. The report briefly describes the needs and expectations of the members of the palliative care mobile team (MPT) of Caritas Salzburg. The demographic development and the consequent prolongation of the dying process clearly shows the urgency to address the quality of life for families and support opportunities to further expand the mobile palliative care teams.
Keywords: palliative care, quality of life and, care giver
Zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde in dieser Arbeit die männliche Anredeform verwendet, die als neutral zu verstehen ist.
1 Einleitung
Aufgrund der langjährigen Berufserfahrung der Autorin als Diplomierte Gesund- heits- und Krankenschwester auf Intensivstationen und als Koordinatorin der mobi- len Demenzberatung Pinzgau ergaben sich häufig Situationen, in denen eine Be- rührung mit dem Lebensende stattgefunden hat. Die Betreuung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase und speziell ihrer Angehörigen bezieht sich großteils auf die medizinische und pflegerische Praxis. Die Autorin konnte im beruflichen Kontext einen Einblick in die Arbeit des mobilen Palliativteams (MPT) der Caritas gewinnen. Die umfassende Betreuung und die Empathie, die den Angehörigen entgegengebracht wird, bestätigen die Aussagen einiger Angehöriger, dass ihnen durch die Hilfe des MPT ein Stück Lebensqualität zurückgegeben wird. Die Ge- spräche mit den Leitungen und Koordinatoren des MPT der Caritas und die inten- sive Auseinandersetzung der Autorin mit dem Thema der Palliative Care und der Betreuung der Angehörigen von Menschen am Lebensende waren ausschlagge- bend für die Erstellung dieser Studie.
Laut Wilkenig et al. (2003) ist der Prozess des Sterbens ein Teil des Lebens und unterstützend im Sterbeprozess, wodurch es den Angehörigen ermöglicht wird, mit dem Sterben leben zu lernen. Nach Abschluss der Literaturrecherche zum ge- wählten Thema konnte festgestellt werden, dass wenige Forschungsergebnisse zu diesem Thema veröffentlicht wurden. Diese Tatsache motivierte die Autorin diese qualitative Studie über die Auswirkungen der Palliative Care auf die Lebensqualität der Angehörigen zu verfassen.
Pleschberger (2001) beschreibt, dass international seit ca. 40 Jahren Konzepte für die verbesserte Versorgung von unheilbar kranken und sterbenden Menschen entstehen. Durch die Palliative Care kommt es zu einem Paradigmenwechsel im Gesundheitssystem, der sich von der akutmedizinischen Versorgung abwendet. Werni-Kourik et al. (2009) heben hervor, dass die Angehörigen in der Palliative Care eine zentrale Bedeutung im Hospizkonzept haben. In der Definition der WHO (2002) wird Palliative Care als Ansatz genannt, der die Lebensqualität von Betroffenen und Angehörigen verbessern soll, wenn eine lebensbedrohliche Erkrankung und die damit verbundenen Probleme vorliegen.
Stephan (2009) gibt an, dass der demografische Wandel und die Institutionalisie- rung die Lebenserwartung erhöht und den Sterbeprozesses verlängert. In den sta- tionären Einrichtungen liegt der Fokus auf der Verhinderung des Todes. Das Be- gleiten und das Krankheitserleben der Angehörigen treten in den Hintergrund. Die Palliative Care trägt mit ethischen Grundsätzen und offener Kommunikation zur Akzeptanz von Sterben und Tod in der Gesellschaft bei. Die Ergebnisse seiner qualitativen Studie zeigen, dass die professionelle Zusammenarbeit von mehreren Disziplinen einen starken Einfluss auf die Zufriedenheit der Angehörigen hat. Bei der Palliative Care liegt der Fokus auf dem Erhalt und der Verbesserung der Le- bensqualität für Betroffene und Angehörige (Stephan, 2009). Schildmann et al. (2010) geben an, dass es laut dem Bundesgerichtshof gesetzlich vertretbar ist, die medizinische Behandlung zu reduzieren, die Symptome zu lindern und in Folge eine Verkürzung des Lebens auszulösen. Die Voraussetzung dafür-, ist der Wille des Betroffenen. Für praktizierende Ärzte in Deutschland ist es illegal, Substanzen zu verabreichen, die zum Tod führen. Hack (2010) zeigt auf, das Angehörige Be- lastungen in emotionalen, sozialen und kognitiven Bereichen erleben, wenn sie einen sterbenden Menschen begleiten. Die Trauerphase hält bis nach dem Tod des Betroffenen an. Palliativ Care setzt sich mit der Trauerbewältigung mit den Angehörigen auseinander und entwickelt individuelle Interventionen (Hack, 2010).
1.1 Problemstellung
Baumgartner et al. (2009) weisen auf die Überzeugung der Politik hin, dass eine palliative Versorgung flächendeckend erforderlich ist. Die optimale Versorgung von Menschen und ihrer Angehörigen am Lebensende gewinnt zunehmend an Bedeutung, da die Anzahl der Diskussionen um aktive Sterbehilfe zunehmen (Baumgartner, 2009). Auch Freilinger (2009) gibt an, dass die letzte Lebensphase der Menschen in den vergangenen Jahren an Tragweite gewonnen hat. Die Krankheitsverläufe sind länger und komplexer geworden-, und die letzte Lebens- phase wurde verlängert. 80% der Österreicher äußern den Wunsch zu Hause sterben zu können. 70 % der Österreicher sterben außerhalb ihres häuslichen Umfelds infolge von Krankheiten in einem Sterbeprozess (Freilinger, 2009).
Menschen in der letzten Lebensphase leiden oft an einer ungenügenden Linde- rung ihrer Symptome und psychischen oder physischen Problemen. Ihre Wünsche können häufig nicht ausreichend berücksichtigt werden. Aus diesen Gründen be- nötigen die Angehörigen die Unterstützung der palliativen Betreuung für die Ange- hörigen. Palliative Care hat unterstützende Konzepte für die Angehörigen entwi- ckelt, um ihnen die Kraft für das Betreuen ihrer schwerkranken und sterbenden Menschen in ihrer verbleibenden Lebenszeit zu geben (Binder et al., 2010).
Laut Durec (2010) stellt das Lebensende die Angehörigen vor Herausforderungen die so komplex sind, dass die Medizin sie nicht allein bewältigen kann. Die Men- schen am Lebensende sind nicht ausschließlich Pflegefälle mit hohem Lebensal- ter, sondern es handelt sich beispielsweise um den eigenen Ehemann, der mit 42 Jahren an Leberkrebs erkrankt, bei dem der Zeitpunkt des Lebensendes nicht vo- raussehbar ist. Dieser Einschnitt in den Lebensalltag benötigt professionelles Be- treuen und Empathie, damit die Angehörigen die Situation kognitiv erfassen kön- nen. Angehörige übernehmen ungewohnte Aufgaben, suchen erst spät Hilfe und können Anforderungen von Betroffen nicht gerecht werden. Die Folgen können Erkrankungen und Dekompensationen sein. Das Entwickeln und Umsetzen von Konzepten erfordert kompetente Organisationen (Durec, 2010). Billmann et al. (2009) halten an den Ansichten von Kübler-Ross fest, die das kommunikative Be- treuen der Angehörigen in den Fokus stellt, um ein gutes Begleiten des Sterbens zu gewährleisten.
Die Angehörigen sind mit vielen Aufgaben und Problemen konfrontiert und dienen als Sprachrohr des Sterbenden. Die Angehörigen empfinden das Sterben ihres geliebten Menschen (Ehemann, Mutter etc.) teilweise stärker als der Betroffene selbst. Als Teil des Betroffenen benötigen die Angehörigen das ganzheitliche Un- terstützen und Wertschätzen, um das Sterben zu begleiten. Die interdisziplinären Teams bestehen aus Ärzten, Pflegemitarbeitern, Seelsorgern und Sozialarbeitern (Billmann et al., 2009). Das Entwickeln des Hospizkonzeptes begann in Österreich 1970. Die Gründung des Dachverbandes Hospiz Österreich erfolgte im Jahre 1993. Die Hospizdienste und Palliativteams gehören diesem Dachverband an. Mitglied der European Association of Palliative Care (EAPC) ist der Dachverband Hospiz Österreich seit dem Jahr 2008 (Pelttari et al., 2010).
Wie der Statistik Austria (2011b) zu entnehmen ist, lag die Zahl der Sterbefälle in den 1980er und 1990er Jahren bei durchschnittlich 85.000 pro Jahr. Im Jahr 2004 wurde mit 74.292 die bisher geringste Zahl an Todesfällen in Österreich registriert. Im Jahr 2005 gab es einen Anstieg auf 75.189, dem 2006 ein Rückgang auf 74.295 Sterbefälle folgte. Von 2007 bis 2009 stieg die Zahl der Gestorbenen auf 77.381 an und ging 2010 um 0,2% auf insgesamt 77.199 zurück. Die endgültige Zahl der Todesfälle lag 2010 bundesweit bei 77.199 und war somit um 182 oder 0,2% niedriger als im Jahr 2009. Wegen der gleichzeitig gestiegenen Zahl älterer Menschen bewirkte das ein Plus in der Lebenserwartung bei den Männern um 0,3 Jahre auf 77,7 Jahre und bei den Frauen auf 83,2 Jahre.
Laut Stephan (2009) verstarben in Österreich von insgesamt 74.295 Menschen, 19.056 Menschen an den Folgen der Krankheit Krebs. Diese sterbenden Men- schen werden u. a von dem MPT und von pflegenden Angehörigen bei dem Ver- sorgen und Begleiten im Sterbeprozess unterstützt. Das BMSK (2005) gibt an, dass die Gruppe der pflegenden Angehörigen zu 79% aus Frauen und zu 21% aus Männern besteht, diese sind jeweils im Alter zwischen 20 und 96 Jahren. Der Anteil der weiblichen Hauptpflegepersonen nimmt tendenziell mit steigendem Pflegegrad zu. Auch 53% der pflegenden Angehörigen aus der Kindergeneration sind Frauen, d.h. Töchter oder Schwiegertöchter. Die Angehörigen sind durch das Erkranken und die Pflege des Partners oder Elternteils körperlich und psychisch stark belastet. Dies trifft im Besonderen zu wenn es sich bei den Pflegenden um die Lebenspartner der kranken Person handelt (BMSK, 2005). Axelsson (1998) zeigt auf, dass die Angehörigen mehr Angst haben, als die Betroffenen. Die größte Angst der Angehörigen ist, die Betroffenen im Augenblickt des Todes alleine ge- lassen und somit nicht bei Ihnen gewesen zu sein.
Laut Kim et al. (2005) kann Palliativ Care den Angehörigen helfen, die begrenzte verbleibende Zeit mit dem Betroffenen zu verbessern. Götze et al. (2009) berichten über das große Ausmaß der Angehörigen bei der häuslichen Versorgung von schwerkranken Menschen. Durch die physische und psychische Last sind pflegende Angehörige vom Burnout, dem Gefühl des Überfordert seins und den Depressionen bedroht (Götze et al., 2009).
Die Motivation der Autorin ist es erste Einblicke zu gewährleisten, die dazu dienen können, ein Modell für die Palliative Care im Hinblick auf die Lebensqualität der Angehörigen zu entwickeln, da bisher diesbezüglich keine geeigneten Modelle vorzufinden sind. Optimale Bedingungen für die Angehörigen sollen es ermögli- chen, sich den Anforderungen im Sterbeprozess ihres sterbenden Familienmit- gliedes oder Partners gewachsen zu fühlen. Entscheidend für diese anspruchsvol- le Aufgabenerfüllung der Angehörigen sind nach Ansicht der Autorin die Lebens- qualität der Angehörigen und die Zufriedenheit mit der Versorgung des geliebten Menschen durch die Palliative Care.
1.2 Ziele
Vor der oben gezeigten Problemstellung richtet die vorliegende Arbeit ihren Fokus auf die subjektive Wahrnehmung der Rolle der Angehörigen in Bezug auf ihre persönlichen Bedürfnisse, Erfahrungen mit der Palliative Care und ihren Anliegen an die Palliative Care. Es sollen die Zusammenhänge dargestellt werden zwischen den organisatorisch- strukturellen Rahmenbedingungen der Palliativ Care im häuslichen Umfeld des sterbenden Menschen und dem daraus resultierenden subjektiven, daher individuellen Empfinden der Angehörigen.
Darüber hinaus werden fassbare Informationen über persönliche Ängste und Erwartungen, aber auch über unterschiedliche Konfliktpotenziale mit den Pflegepersonen der Mobilen Palliativteams (MPT) erwartet, welche die Angehörigen belasten. Die erfassten Informationen können dazu dienen, die derzeitige Situation der Angehörigen aufzuzeigen, um dadurch etwaige zukünftige Entscheidungen im Zusammenhang mit der Palliativ Care zu erleichtern.
Das Sensibilisieren des MPT und des Qualitätsmanagement der Caritas für die Belastungen und Wünsche der Angehörigen sind ein zusätzliches Ziel der Studie. Die gewonnenen Erkenntnisse können in Zukunft hilfreich bei der Erstellung von zielführenden Rahmenbedingungen, von Grundlagen für Initiativen und Leitfäden für die Angehörigen von sterbenden Menschen, sowie für weitere Forschung sein.
1.3 Pflegewissenschaftliche Relevanz
Laut Thiel et al. (2001) fordert die Sozialgesetzgebung im SGB V die Sicherung und Verbesserungen der pflegerischen Interventionen. Pflegefachkräfte sind ge- setzlich verpflichtet, Forschungsergebnisse in die Praxis zu übertragen und ihre Interventionen zu evaluieren. Vor diesem Hintergrund ist es wissenschaftlich rele- vant, die Auswirkungen der Palliative Care auf die Lebensqualität der Angehörigen zu erforschen und aufzuzeigen. Hierdurch wird der Palliative Care der Caritas Salzburg ermöglicht, die Forschungsergebnisse in die Praxis zu übertragen und in Folge die Pflegepraxis der Palliative Care für die Angehörigen zu verbessern.
1.4 Struktur der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Das erste Kapitel soll einen Überblick über die Einleitung, Problemstellung und die Zie- le dieser Studie geben. Im zweiten Kapitel folgen die Begriffsdefinitionen der Be- griffe: Palliative Care, Lebensqualität, Angehörige und Mobiles Palliativteam. An- schließend werden die Finanzierung der Hospiz und Palliativeinrichtungen aufge- führt. Die Darstellung der Ziele, Aufgaben und die Leistungen des Mobilen Pallia- tivteams sind ebenfalls Gegenstände des theoretischen Teils dieser Studie.
Im dritten Kapitel wird die Darstellung und Begründung der verwendeten Methode vorgestellt. Die Zusammenfassung wird im vierten Kapitel präsentiert, die kritische Auseinandersetzung der Ergebnisse und Interpretation der Ergebnisse, die in Form von Kategorien abgebildet sind. Die Diskussion erfolgt im fünften Kapitel. Mit den Angaben der Limitationen der vorliegenden Studie, den Schlussfolgerungen und dem Ausblick für die Zukunft in Hinblick auf Implikationen für die Praxis schließt die Studie im fünften Kapitel ab.
2 Theoretischer Teil
Als theoretischer Bezugsrahmen werden die Beschreibung der Literaturrecherche, die unterschiedlichen Begrifflichkeiten zum Thema der Studie, die Finanzierung und die epidemiologischen Daten vor Beginn der tatsächlichen Untersuchung dis- kutiert.
2.1 Literaturrecherche
Im Rahmen der vorliegenden Studie erfolgte die Literaturrecherche in den relevan- ten Datenbanken für gesundheits,- und pflegebezogene Fragestellungen Medline, Cinahl und DIMDI (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Infor- mation). Die Investigation des Themas erfolgte über ausgewählte deutsche und englische Suchbegriffen in unterschiedlichen Kombinationen wie „Auswirkung“, „Palliativ Care“, „Lebensqualität.“, „Angehöriger“; impact“, „palliative care“, „quality of life“ and „care giver“. Die Literaturrecherche fand im Zeitraum vom Mai 2011 bis Januar 2012 statt.
Ebenso wurden in den diversen Fachzeitschriften, wie die Zeitschriften „PR Inter- net“ und „Pflege“ aus dem Hans Huber etc. recherchiert. Zusätzlich wurde in Bib- liotheken und im Internet nach einzelnen Autoren und deren zusätzliche Publikati- onen und bei einzelnen Artikeln nach relevanten Referenzen gesucht. Dabei wur- de sowohl deutschsprachige, sowie englische Literatur verwendet. Die Auswahl der Publikationen für die vorliegende Arbeit richtete sich nach den Kriterien, das die Veröffentlichungen in den Erscheinungsjahren 2000 bis 2011 erschienen bzw. entstanden sind. Weiter erfasste die Literatursuche auch die Homepage der Öster- reichischen Palliativ Gesellschaft (OPG) und dem Dachverband von Palliativ- und Hospizeinrichtungen (Hospiz Österreich) und der Deutschen Gesellschaft für Pal- liativmedizin e.V (DGP). Des Weiteren erfolgte die Suche in den Suchmaschinen: Google, yahoo und Google Scholar.
Die Literaturrecherche zum gewählten Thema erforderte eine zusätzliche Suche auf der Homepage des Deutschen Ärzteblatt und auf der Homepage des Deut- schen Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wichtige Beiträge zum Thema fanden sich in der Bibliothek der Privaten Universität Witten- Herdecke, der Homepage der Caritas, sowie in der Bibliothek des Rudolfinerhaus in Wien. Die Autorin recherchierte in der Pflegebibliothek der UMIT und in der Uni- versitätsbibliothek der Abteilung Pflegeforschung des IPG der Universität Linz. Des Weiteren erfolgte die Suche in pflegeverwandter Literatur in der Bibliothek der medizinischen Universität Graz, in der Homepage der österreichischen Krebshilfe.
2.1.1 Suchstrategie und Literaturauswahl
Aufgrund der Suchbegriffe wurden in den Datenbanken 102 Artikel zur Thematik Palliativ Care, Lebensqualität und Angehörige identifiziert. Nach Lesen der Abstracts können für die vorliegende Arbeit zwölf Studien verwendet werden. Keine Verwendung fanden ebenfalls Studien, in denen die Palliative Care nicht als Aufgabe von Pflegepersonen wahrgenommen worden sind. Nach Abschluss der Literaturrecherche zum gewählten Thema konnte festgestellt werden, dass wenige Forschungsergebnisse zu diesem Thema veröffentlicht wurden.
Diese Tatsache motivierte die Autorin diese qualitative Studie über die Auswirkungen der Palliative Care auf die Lebensqualität der Angehörigen zu verfassen.
2.2 Demographischer Wandel und Mortalität
Laut Jenny (1996) betrug die Lebenserwartung im 16. Jahrhundert im Durchschnitt 25 Jahre. Die Menschen damals starben an Krankheiten und Seuchen oder infol- ge von Hungersnöten. Seit dem 19. Jahrhundert steigt das Lebensalter der Ge- sellschaft stark an und führt zu einer Überalterung der Gesellschaft. Aktuell beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung achtzig Jahre. Der Anstieg der Lebenser- wartung ist auf die Erfolge der Medizin und dem Hygienebewusstsein zurückzu- führen.
Eine Verbesserung der Lebensqualität konnte durch die die Entwicklung von Impf- stoffen, der Sanierung der Städte, sowie der Fortschritte in Hygiene und Entwick- lung in der Technik erzielt werden. Durch die sinkende Anzahl an Geburten, wer- den die Menschen älter und in Folge kommt es zu einer demographischen Wandel (Jenny, 1996). Stephan (2009) zeigt auf, dass der demographische Wandel zu einer Verschiebung der Mortalität und Morbidität führen. Die häufigste Ursache für Mortalität und Morbidität stellen aktuell degenerative und chronische Erkrankun- gen dar. Todesursachen, die zu einem raschen Tod führen werden seltener, da auch die Anzahl an Verkehrsunfällen permanent fällt. Durch die technischen Fort- schritte und die Institutionalisierung ist der Sterbeprozess bei chronischen und degenerativen Erkrankungen wesentlich verlängert worden (Stephan, 2009). In Österreich verursachten im Jahr 2010 laut Statistik Austria (2011) die zwei häu- figsten Todesursachengruppen Herz-Kreislauf-Krankheiten und Krebs gemeinsam sieben von zehn Sterbefällen. 43% der Todesfälle stellen durch Herzkreislaufer- krankungen 33.196 Sterbefälle und 26% der Todesfälle stellen durch den Krebs 19.757 Sterbefälle dar.
Die weiteren Todesursachengruppen verteilten sich mit 5% auf Krankheiten der Atmungsorgane, 4% der Verdauungsorgane, 16% auf sonstige Krankheiten und 5% auf nicht natürliche Todesursachen, wie Verletzungen und Vergiftungen (Statistik Austria, 2011).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Todesursachenstatistik (Statistik Austria, 2011)
In Österreich hat die Todesursachenstatistik nach Statistik Austria (2011) eine bis ins 19. Jahrhundert zurückreichende Tradition und liefert Eckdaten für klinisch - medizinische Studien und wichtige Indikatoren für den Gesundheitszustand der Bevölkerung. Die Statistik Austria ist in Österreich und in vielen anderen Ländern eine der zuverlässigsten Quellen von Daten der Gesundheit. Über den letzten Ver- lauf gibt die Todesursachenstatistik Aufschluss von Krankheiten in der Bevölke- rung. Das des gewonnenen Datenmaterials bildet die Grundlage für zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, welche die geographische, demographische und sozi- oökonomische Variation der Mortalität an bestimmten Krankheiten untersuchen. Die Forschungsfragen betreffen die Untersuchung von Problemen der Gesundheit, Evaluierung von diagnostischen und therapeutischen Techniken innerhalb spezifi- scher Gruppen und die Identifikation von Bereichen, in denen Todesfälle verhin- dert werden können und die Ätiologie von Krankheiten (Statistik Austria, 2011).
Kim et al. (2005) geben an, dass viele Entwicklungen in der Prävention und Be- handlung von Krebs aufgetreten ist, aber der tödliche Verlauf dieser Erkrankung immer noch üblich ist. Nach Angaben der World Health Organization wurden im Jahr 1999 weltweit 7 Millionen Todesfälle durch Krebs registriert (Kim et. Al, 2005). „In Österreich, so Schjerve, kann erwartet werden, dass circa 80% aller Menschen mit einer relativ langen Sterbephase rechnen müssen. Mit einem plötz- lichen Tod („tot umfallen“ oder „still einschlafen“) das heißt mit einer kurzen Le- bens - Sterbens Phase hingegen nur 20%. Dem gegenüber wünschen sich 90% möglichst „plötzlich tot umzufallen“ oder „still einzuschlafen“ (Schjerve, 2002, zit. aus Stephan, 2009, S. 9).
2.3 Pflegeleistungen durch Angehörige
Ältere Menschen wünschen bei Pflegebedarf zu 40% Pflegeleistungen von mobi- len Pflegeeinrichtungen in Kombination mit den Angehörigen. Im Anschluss wün- schen 32% der Pflegebedürftigen die Pflegeleistungen nur durch die mobilen Pfle- geeinrichtungen und 27% könnten sich vorstellen, dass die Angehörigen die kom- plette Pflege übernehmen. Tendenziell gibt es einen Zusammenhang zwischen dem sozialen Status und der gewünschten Übernahme der Pflegeleistungen. Um- so niedriger der soziale Status ist, desto stärker wird der Wunsch nach der Über- nahme der kompletten Pflege durch die Angehörigen geäußert (Schimany, 2004).
2.4 Belastungen der Angehörigen
Schöneberger et al. (2002) geben an, dass hinter fast jedem chronisch kranken und betreuungsbedürftigen Menschen kompetente und besorgte, tröstende und hilfreiche Angehörige stehen. Diese Angehörigen sind häufig überforderte und erschöpfte Angehörige.
Die Ehe,- und Lebenspartner stellen die Gruppe der Angehörigen dar, die für ihre chronisch erkrankten und auf Hilfe und Pflege angewiesenen Partner emotionale Unterstützung leisten, Informationen beschaffen und eine Vielzahl alltäglicher Aufgaben übernehmen.
Die Angehörigen fungieren als Krankheitsmanager bauen Brücken zum sozialen Netz, um die soziale Teilhabe der Betroffenen zu sichern und stehen häufig im Schatten der öffentlichen Wahrnehmung (Schöneberger et. al., 2002). Die Angehörigen im Sterbeprozess sind mit vielen Belastungen konfrontiert. Nach Buttenhauser (2008) werden Angehörige durch die Erkrankung Krebs eines Part- ners oder Familienmitgliedes emotional stark belastet und werfen existenzielle Fragen nach dem Sinn des Lebens auf. Hierdurch kann sich die Angst vor dem eigenen Tod noch verstärken. Mit fortschreitender Krankheitsdauer werden gegen die eigene Person häufig aggressive Tendenzen gerichtet. Nitschke (2002) gibt an, dass die fehlende soziale Unterstützung für die Angehörigen eine große Belas- tung darstellt. Des Weiteren sind weibliche Angehörige stärker belastet, da sie das Bedürfnis haben, ihren Familienangehörigen oder Partner beizustehen und den körperlichen Zerfall im Sterbeprozess miterleben. Angehörige wollen das sterben- de Familienmitglied oder den Partner nicht lange leiden sehen und wünschen ihm einen raschen Tod. Die eigenen Ängste, Gefühle und Emotionen werden vor dem Sterbenden verborgen, um ihn nicht zusätzlich zu belasten. Angehörige haben Angst vor der Erkrankung und versuchen diese zu verdrängen. Hierdurch steigen die emotionalen Belastungen der Angehörigen stark an und es folgen negative Veränderungen der Lebensqualität. Die Verarbeitung der Krankheit und des Ster- beprozesses ist für die Angehörigen erforderlich (Nitschke, 2002). Baldauf und Waldenberger (2008) vertreten die Meinung, dass Angst die Men- schen lähmt und erstarren lässt. Die Angst ist eine starke Belastung und beein- trächtigt die Lebensäußerungen und Empfindungen. Der Boden ist für den Ange- hörigen eines Sterbenden äußerlich und innerlich nicht mehr wahrnehmbar. Von den Angehörigen wird berichtet, dass ihnen der Boden unter ihren Füßen wegge- zogen wird. Angehörige, die ein Familienmitglied mit Krebs versorgen, verspüren die Angst bei weiteren Arztbesuchen, medizinischen Maßnahmen und der erneu- ten Diagnosemitteilung. Die Auslöser der Angst beruhen auf eigene Erfahrungen der Angehörigen mit der Erkrankung Krebs und dem Tod. Auf die Angehörigen wirkt ihre persönliche Biographie. Die Angst vor dem Tod des geliebten Familien- mitgliedes, kann die Angst um ihn sein und die Angst vor der Einsamkeit.
Das Gefühl der Zugehörigkeit geht verloren und das Gefühl der Leere entsteht. Das Leben der Angehörigen verliert den gewohnten Halt und die unvertraute At- mosphäre birgt Ungewissheit (Baldauf, Waldenberger, 2008). Tiefgreifende Belas- tungen sind laut Stets (2001) der Verlust von gemeinsamen sozialen Aktivitäten und Freizeitaktivitäten. Der Verlust des affektiven Austauschs ist für die Angehöri- gen sehr schmerzhaft. Sie werden plötzlich nicht mehr vom geliebten Familienmit- glied umsorgt und sind nicht mehr das Liebesobjekt des Betroffenen, während die Angehörigen gleichzeitig Zuneigung und körperliche Pflege geben. Der Grund hierfür ist die fehlende Kraft des Sterbenden, der abhängig vom Stadium seiner Erkrankung nicht mehr in der Lage ist, etwas zurück zu geben. Die langjährige Basis der Partnerschaft und Ehe die Gegenseitigkeit, die Liebe und die Zunei- gung, auf die die Beziehung aufgebaut war, geht verloren. In der Folge kommt es schmerzlichen Verlusten und starken Belastungen (Stets, 2001).
Die Studie von Mc Cluskey (2007) zeigt auf, dass Ärzte die ethische Pflicht haben gemeinsam mit den Angehörigen und Betroffenen Strategien für das Ende des Lebens zu besprechen, um die Achtung vor der individuellen Autonomie zu wah- ren. Für die Angehörigen und die unheilbar Erkrankten ist es notwendig, dass der Arzt über die Diagnose aufklärt und sie über die Optionen am Ende des Lebens informiert. Der Arzt sollte in einer sachliche Art und Weise, objektiv und unvorein- genommen die Angehörigen informieren. Das richtige Timing für die Konfrontation mit der Diagnose einer unheilbaren Krankheit ist für den Arzt nicht leicht zu finden, aber die Familie hat das Recht auf Aufklärung. Der behandelnde Arzt sollte so früh wie möglich das Gespräch mit den Betroffenen und ihren Angehörigen suchen, Paternalismus vermeiden und ihnen Zeit und Raum anbieten. Nur in dieser Weise erhalten die Angehörigen und ihre Familienmitglieder oder Partner die Möglichkeit die Diagnose und ihre lebensbedrohlichen Auswirkungen zu verarbeiten, ihre Be- lastungen und Ängste, sowie fundierte Entscheidungen mit dem Arzt diskutieren zu können. Es ist zielführend, wenn der Arzt auf die Unsicherheit und die Ängste der Sterbenden und ihre Angehörigen durch eine offene Diskussion eingeht. Je früher die Diskussion eingeleitet wird, umso besser können die Angehörigen sich auf die Situation einstellen und Hilfe im Sterbeprozess annehmen, um Belastun- gen zu verringern bzw. zu vermeiden (Mc Cluskey, 2007).
Fachkräfte und Ärzte sollten auf das oft unterschiedliche Informationsbedürfnis und das Informationsniveau von Patienten und Angehörigen eingehen. Ärzte sind durch die Informationshoheit des Patienten gebunden in ihrem Handlungsspiel- raum gegenüber den Angehörigen. Die Angehörigen haben kein Recht auf eine unabhängige Information ohne die Einwilligung des Betroffenen. Aus ihrer Studie geht hervor, dass eine umfassende Information für die Angehörigen aus prakti- schen und ethischen Gründen wichtig ist. Den Ärzten sind im offenen Umgang mit den Informationen Grenzen gesetzt. Die unverheiratete Lebenspartner erleben die fehlende Information als starke schmerzliche Belastung (Schöneberger et. al, 2002). Kröger (2005) gibt an, dass Angehörige in der professionellen Versorgung eine vernachlässigte Gruppe darstellen, obwohl der Bedarf an Unterstützung ei- nerseits von den Experten und andererseits von den Angehörigen berichtet wer- den. Um die Belastungen der Angehörigen, wie die Krankheitsverarbeitung und Interaktionen mit der sozialen Umwelt, zu reduzieren, wäre die Einbeziehung der Angehörigen in eine professionelle Versorgung zielführend. Der individuelle und gesellschaftliche Sterbe,- und Trauerprozess der Angehörige wird oft bei psycho- onkologischen Beratungen nicht einbezogen, wodurch es zu einer Verschlechte- rung der Auswirkungen auf die Lebensqualität kommen kann (Kröger, 2005).
Stets (2001) zeigt auf, dass Angehörige von Tumorkranken vielfältig belastet sind, wie durch den Verlust des Familienmitgliedes, wie er früher war. Die Angehörigen müssen sich um eine Person liebevoll kümmern, bei der wenig Spuren der frühe- ren Person, wie dem geliebten Partner vorhanden sind. Die Tatsache sich weiter- hin um den Tumorkranken zu kümmern und ihn zu umsorgen, der im weitesten Sinne ein Fremder ist, verschärft das Bewusstsein dafür, dass der frühere Partner nicht mehr existiert, obwohl er nicht gestorben ist. Des Weiteren sind die Angehö- rigen gezwungen, durch die Tumorerkrankung ihres Familienmitgliedes ihre Fami- lienrollen neu zu definieren. Die Belastungen werden durch den drohenden Tod des Sterbenden und der Angst vor dem Gefühl der Leere verstärkt. Leitich (2010) berichtet, dass die Diagnose Krebs eine lebensbedrohliche Erkrankung bedeutet, wodurch die Angehörigen erschüttert sind. Durch die Diagnose sehen die Angehö- rige von den Krebskranken ihre familiäre, soziale und berufliche Zukunft in Frage gestellt.
Innerlich erleben die Angehörigen eine große Anspannung durch die Angst und Einsamkeit, Verzweiflung und Hilflosigkeit. Weitere Belastungen für die Angehöri- gen sind die Wut und die Trauer, sowie die Sorge um den geliebten Menschen. Angehörige werden mit Fragen nach dem Tod und dem Sinn des Lebens konfron- tiert. Ein Leben mit der Diagnose Krebs bedeutet für die Angehörigen und ihre Familien unbekannte Wege zu beschreiten, vergleichbar mit einer anspruchsvollen Bergtour. Manchmal ist der Weg nicht so beängstigend und leichter, teilweise gibt es steile und sehr schwierige Stellen (Leitich, 2010). Die Diagnose Krebs führt bei den Angehörigen nicht automatisch zu einer Hinwendung der Betroffenen zur Re- ligion. Hilfen erwarten sich die Angehörige vom Hausarzt. Der behandelnde Arzt im Krankenhaus stellt für die Angehörigen und die Betroffenen den wichtigsten Ansprechpartner im Krankheitsverlauf dar. Um die Lebensqualität zu verbessern, sollte frühestmöglich eine Integration der Angehörigen in das Arzt-Patienten- Verhältnis angestrebt werden (Röder, 2004).
Die körperliche Pflege des Betroffenen und die Ungewissheit um den Verlauf der Krankheit sind nach Stets (2001) für die Angehörigen schwierig. Berufstätige An- gehörige sind mit Konflikten zwischen den Anforderungen der Pflege des Betroffe- nen und denen am Arbeitsplatz konfrontiert. Durch Konzentrationsverlust und Müdigkeit am Arbeitsplatz sehen sie sich mit einer Gefährdung in ihrer beruflichen Zukunft bedroht. Die Aufgabe der beruflichen Tätigkeit durch die Kündigung kann zu erheblichen finanziellen Einkommensverlusten und Belastungen führen. Die finanziellen Auswirkungen auf die Angehörigen, die die Hilfe von ambulanten Pfle- gediensten für den Tumorkranken in Anspruch nimmt, belaufen sich in drei Mona- ten auf durchschnittliche Kosten in Höhe von Euro 4678.32 (Stets, 2001).
Angehörige geben oft an, mehr Angst vor dem Ende des Lebens zu haben, als die Betroffenen selber (Axelsson, Sjöden, 1998). Mit starken Belastungen fühlen sich die Angehörigen durch die Angst, den Familienangehörigen oder Partner unbeaufsichtigt zu haben, wenn der Tod eintritt, konfrontiert. Angehörige geben an, dass sie sich kurz vor dem Eintritt des Todes des geliebten Familienmitgliedes oder den geliebten Partner versammeln und ihn nicht mehr allein lassen möchten. Die Angehörigen wollen den sterbenden Menschen bis zu seinem Tod würdevoll begleiten und ihm bis zum Ende seines Lebens bei Seite stehen.
Im Vordergrund steht für die Angehörigen, die Wünsche des geliebten Familien- mitgliedes oder des Partners ernst zu nehmen und ihm im Sterben Schmerzfrei- heit, Ruhe und Geborgenheit zu schenken. Des Weiteren verspüren die Angehöri- gen eine Unsicherheit vor der Verantwortung, die Unterstützung der Pflege des Sterbenden zu übernehmen. Nach der Meinung von Leitich (2010) ergeben sich durch die Krebserkrankung des Familienmitgliedes oder Partners für die Angehö- rigen zusätzliche Aufgaben, der Alltag verändert sich, Neuorientierung und Flexibi- lität sind gefordert. Die Angehörigen werden vor schwierige Herausforderungen gestellt, da sie sich wünschen für das schwerkranke bzw. sterbende Familienmit- glied oder dem Partner eine Hilfe und Stütze zu sein. Häufig übersteigern diese Anforderungen die eigenen Kräfte der Angehörigen (Leitich, 2010).
Die Angehörigen nehmen die Belastungen durch den Geruch von Verfall und Tod wahr, da die Lebenskraft des sterbenden Familienmitgliedes schwindet und die Körperfunktionen vermehrt ausfallen. Die Angehörigen sind teilweise mit dem Ge- fühl des Ekels konfrontiert und spüren, dass der Betroffene am Ende des Lebens angekommen ist. Die Belastungen für die Angehörigen verstärken sich, wenn sie feststellen, dass das Leiden des Betroffenen ansteigt, da dieser das Gefühl der Scham verspürt, da er den Ekel bei seinen Angehörigen auslöst. In diesem Zu- sammenhang wird bei den Angehörigen das Gefühl der Hoffnungslosigkeit ausge- löst. Es folgen Schlafstörungen, traurige Verstimmung, Depressionen, Rückzug und Vitalitätsverlust. Durch diese Symptome der Niedergeschlagenheit tritt bei den Angehörigen die Grenze der Belastbarkeit ein und es folgen Verzweiflung und Ohnmacht. Die Angehörigen bedürfen in diesen existentiellen Zustand dringend der fachlicher Beratung und Behandlung (Baldauf, Waldenberger, 2008). Angehö- rige sind durch Angst vor der begrenzten verbleibenden Zeit und durch die Trauer um ihr Familienmitglied oder Partner belastet. Wenn die Phasen der Trauer vorbei sind, akzeptieren die Angehörigen die unheilbare Erkrankung. Die Angehörigen stehen vor der schwierigen Entscheidung, einerseits halten sie an der Hoffnung auf eine Heilung fest und andererseits wünschen sie die Behandlung der Erkran- kung durch die aggressive Chemotherapie und die Hilfe der Palliativmedizin (Kim et al., 2005).
Laut Friess (2011) wird die „palliative“ Chemotherapie eingesetzt, wenn sich Me- tastasen in der Lunge etc. gebildet haben. Das Ziel der Chemotherapie ist die Ver- längerung des Lebens und die Verbesserung der Lebensqualität. Eine Heilung ist in den meisten Fällen nicht möglich. In einigen Fällen reduziert die Chemotherapie die Metastasen bis diese chirurgisch entfernbar werden. Die Nebenwirkungen der Chemotherapie sind Übelkeit und Erbrechen. Durch die prophylaktische Gabe von Antiemetika kann die Übelkeit unterdrückt werden. Des Weiteren können Appetit- losigkeit, Geschmacksstörungen und Durchfälle auftreten. Eine für viele Patienten belastende Nebenwirkung stellt der Haarausfall, die Alopezie, dar. Nach dem En- de der Chemotherapie sind die Nebenwirkungen aufgehoben und das Wachstum der Haare setzt ein (Friess, 2011). Bei der Durchführung der Chemotherapie mit palliativem Therapieziel ist nach Röder (2004) eine Heilung nicht mehr möglich und eine gute Risiko- Nutzenabwägung notwendig, da eine die Verbesserung der Lebensqualität im Vordergrund steht. Durch die Chemotherapie wird bei den Pati- enten eine Alopezie ausgelöst, die von den Patienten meist gut toleriert wird. Für die Angehörigen steigen die Belastungen durch den Haarausfall und die Chemo- therapie. Zu Beginn der Chemotherapie kann ein Haarteil angefertigt werden, dass helfen kann, die Lebensqualität zu verbessern. Während der Chemotherapie wird das Alltagsleben der Familien stark belastet, da die Angehörigen für die Be- troffenen viele Tätigkeiten übernehmen und Hilfe bei der Mobilität anbieten müs- sen. Aufgrund von Polyneuropathie können die Betroffenen Tätigkeiten, wie das Zuknöpfen von Kleidungsstücken nicht mehr ausführen und die Schmerzen, schränken sie in ihrer Selbstständigkeit und Mobilität ein (Röder, 2004). Das kon- krete Handeln ist für die Angehörigen oft eine entlastende Copingstrategie, die dem Gefühl der Hilflosigkeit entgegenwirkt. In ihrer Studie betonen die Probanden geschlechtsspezifisch unterschiedliche Formen der Hilfeerbringung und Unterstüt- zungsleistungen. Die Männer bieten vermehrt emotionale Unterstützung für die Betroffenen an und weibliche Angehörige haben eine wichtige Funktion bei der praktischen Umsetzung bei der Änderung des Lebensstils und übernehmen all- tagspraktische und pflegerische Aufgaben. Als Hinweis für eine hohe Belastung wird von den Fachkräften eine Überaktivität gewertet (Schöneberger et al., 2002).
2.5 Begriffsdefinitionen
Um ein einheitliches Begriffsverständnis zu gewährleisten werden einleitend die Begriffe „Palliative Care“, „Lebensqualität“ , „Angehörige“ und „Mobiles Palliativteam“ mithilfe wissenschaftlicher Literatur erklärt und Zusammenhänge aufgeführt, um den theoretischen Kontext verständlich darzustellen.
2.5.1 Palliative Care
Die WHO (2002) definiert die Palliative Care als einen Ansatz, der die Lebensqua- lität der Patienten und Angehörigen bei Vorliegen einer tödlichen Erkrankung, durch die Linderung von Schmerzen und weiteren belastenden Symptomen ver- bessert. Palliative Care bejaht das Leben und betrachtet das Sterben als einen normalen Prozess. Den Patienten und Angehörigen wird Unterstützung angebo- ten, um sie während des Sterbeprozesses und in ihrer Trauer zu begleiten (WHO, 2002).
Die Palliative Care ist ein weltweit verbreitetes Konzept, dass sich multidisziplinär um die Versorgungsprobleme dieser Klienten und ihrer Angehörigen kümmert (Pleschberger, 2001). Die Palliative Care berücksichtigt die körperlichen, sozialen, spirituellen und psychischen Belastungen von schwerstkranken Menschen und ihrer Angehörigen. Unterstützt wird die Palliative Care durch ehrenamtliche Hospizhelfer (Müller-Mundt, 2004).
2.5.2 Lebensqualität
Swensen et al. (1993) geben an, dass die Lebensqualität der Angehörigen sich auf den gesundheitlichen Zustand Betroffenen bezieht. Güthlin (2006) beklagt, dass es keine allgemein gültige Definition des Begriffes Lebensqualität gibt. In der Literatur wird der Begriff Lebensqualität häufig im Zusammenhang mit somati- schen Beschwerden und Funktionseinbußen erwähnt. Des Weiteren fehlen Ab- grenzungen zu den diversen Bereichen, wie der Stimmung und dem Gesundheits- zustand.
Die Adaption an eine Krankheit hat jeweils unterschiedliche Bedeutung für den Betroffenen. Die Evaluation der eigenen Lebensqualität findet in Abhängigkeit von Umgebungsvariablen, wie die Anwesenheit kranker und sterbender Menschen statt (Güthlin, 2006). Lebensqualität ist laut Calaminus et al. (2000) ebenso wich- tig, wie die körperliche Gesundung der Betroffenen. Unter der Lebensqualität ver- stehen Porzsol und Rist (1997) den Lebenskomfort und in der Medizin die ge- sundheitsbezogene Lebensqualität. Stephan (2009) gibt an, dass Lebensqualität ein subjektives, individuelles und situatives Konzept darstellt, wodurch sich für die Palliative Care die Notwendigkeit ergibt, die individuelle Bedeutung der Lebens- qualität bei den Betroffenen zu erheben. Die Kontrolle der Symptome der Be- troffenen stellt ein Konzept zur Verbesserung und Förderung der Lebensqualität dar (Stephan, 2009). In soziologischen Studien gilt die Lebensqualität als Maß für Versorgung einer definierten Population und für die Güte der Lebenssituation. In der Medizin wird die Lebensqualität definiert vom Betroffenen erlebte Funktionsfä- higkeit und erlebte Empfindlichkeit. Des Weiteren gilt die Lebensqualität als Fähig- keit Rollen im Leben zu übernehmen und alle sozialen, psychischen, funktionalen und körperlichen Aspekte von menschlichem Verhalten und Erleben, wie die Le- bensqualität von den Menschen selbst berichtet wird (Bullinger, 1997). Die Le- bensqualität der Patienten und ihrer Angehörigen kann durch umfassende Bera- tung, Begleitung, medizinische und pflegerische Behandlung entscheidend ver- bessert werden. Die Krankenhausaufenthalte können durch die MPT vermieden werden (Caritas, 2008 b). Unter diesen Gesichtspunkten wäre es wünschenswert, wenn die festgestellte Tendenz, die Definitionen für Lebensqualität neu zu über- denken, sich durchsetzt.
2.5.3 Angehörige
Der Fachausdruck für pflegende Angehörige wird in der Literatur unterschiedlich definiert. Lamura et al. (2006) definieren pflegende Angehörige als Personen, die einen Menschen über 65 Jahre mindestens vier Stunden, im häuslichen Umfeld oder in einer Seniorenanlage, in der Woche unterstützen und sich als Pfleger be- zeichnen. Bleimund (2002) spricht von pflegenden Angehörigen als Personen, die betagte Menschen pflegen und mit ihnen einen gemeinsames Leben gestalten.
[...]
- Quote paper
- Magistra der Pflegewissenschaften Claudia Machreich (Author), 2012, Auswirkungen der Palliative Care auf die Lebensqualität der Angehörigen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/199552