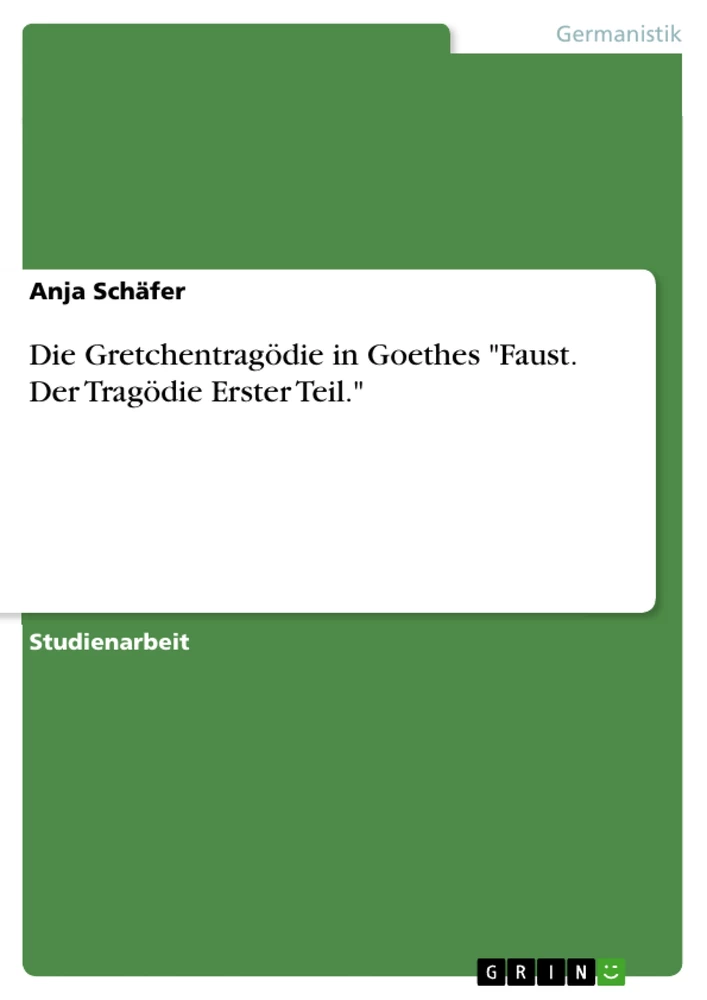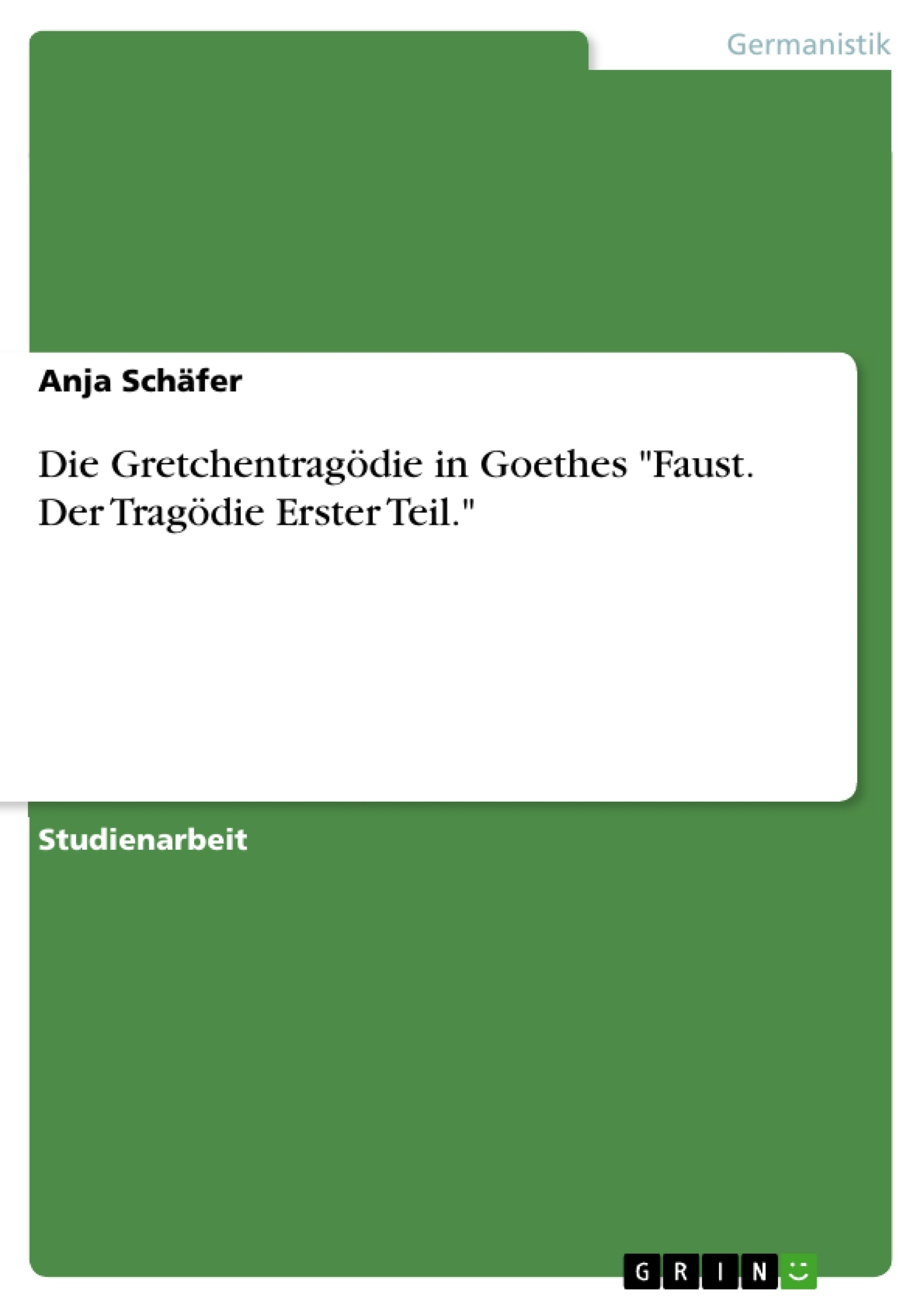Johann Wolfgang von Goethes „Faust. Der Tragödie Erster Teil“, 1808 veröffentlicht, greift die Geschichte des historischen „Doktor Johannes Faustus“ auf, die in der europäischen Literatur seit dem 16. Jahrhundert vielfach verarbeitet wurde. Obwohl die Gretchentragödie nicht zum festen Bestand des Faust-Stoffes der Tradition gehört, steht sie bei Goethe – bereits im „Urfaust“ – fast gleichwertig neben der Gelehrtentragödie, was ihre Bedeutung und Selbstständigkeit für die Gesamtkonzeption unterstreicht. Der Autor selbst hat das Gretchendrama 1826 als „zweiten Akt“ bezeichnet, in dem neben dem „Schicksal des Gelehrten und seiner Erkenntnisproblematik […], das des Bürgers und seines sozialen Aufstiegs“ behandelt werden sollte. „[D]em Schicksal des Mannes zwischen enthusiastischem Aufschwung und tragischem Scheitern sollte das Schicksal der Frau zwischen Liebe und Zerbrechen an gesellschaftlichen Regelungen an die Seite gestellt werden.“
In der folgenden Interpretation soll nun anhand der Herkunft des Namens „Gretchen“ erläutert werden, welche Themen und Gattungen für die Tragödie entscheidend sind. Neben der Kindsmordthematik, für die sicherlich die Hinrichtung der Frankfurter Dienstmagd Susanna Margaretha Brandt (1772) herangezogen werden kann, spiegeln sich zwei literarische Gattungen aus dem 16. und dem 18. Jahrhundert in Goethes „Faust“ wieder: Das Bürgerliche Trauerspiel, das mit Lessings „Miß Sara Sampson“, 1755, im deutschsprachigen Raum eingeführt wurde, bestimmt die vordergründige Handlung. Hier geht es um den sozialen Aufstiegswunsch des Kleinbürgertums, der exemplarisch anhand der verführten jungen Frau dargestellt wird, und den Preis, der dafür gezahlt werden muss. „[I]m Hintergrund spielt sich zwischen einer neuen Heiligen Margarete und dem Teufel ein Legendendrama ab“ , „das im Meisterdrama und im Schultheater des 16. Jahrhunderts gepflegt wurde.“
Der anschließende Teil der Arbeit wird sich näher mit den bisher genannten themen- und gattungsspezifischen Aspekten beschäftigen und das Geschehen im „Faust“ Szene für Szene entschlüsseln.
Abschließend bleibt nur noch die Frage nach der Schuld an dem Vergehen der weiblichen Protagonistin zu beantworten. Obwohl Gretchen die ganze Verantwortung alleine auf sich nimmt, sollte dennoch geklärt werden, welche Rolle Faust in der Tragödie zukommt. Denn er ist sicherlich nicht ganz unschuldig am Untergang seiner Geliebten und am Mord seines eigenen Kindes.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Herkunft des Namens „Gretchen“
- Die Kindsmordthematik
- Das Bürgerliche Trauerspiel
- Das Legendenstück
- Die doppelte Symbolik des Namens: Perle und Blume
- Szeneninterpretation:
- Faustus Eintritt in die „kleine Welt“: Beginn des bürgerlichen Trauerspiels
- Gretchens Ausbruch in die „große Welt“
- Gretchens Untergang: Ende des bürgerlichen Trauerspiels
- Die Schuldfrage
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Gretchentragödie in Goethes „Faust. Der Tragödie Erster Teil“. Ziel ist es, die Bedeutung der Gretchentragödie für die Gesamtkonzeption des Werks zu beleuchten und die entscheidenden Themen und Gattungen zu analysieren. Die Interpretation konzentriert sich auf die Herkunft des Namens „Gretchen“ und die Einbettung der Tragödie in literarische Traditionen.
- Die Bedeutung des Namens „Gretchen“ und seine vielschichtigen Bezüge
- Die Einbettung der Gretchentragödie in die Gattungen des Bürgerlichen Trauerspiels und des Legendenstücks
- Die Rolle der Kindsmordthematik und ihre gesellschaftlichen Hintergründe
- Die Darstellung der Schuldfrage und die Verantwortung von Faust und Gretchen
- Analyse der Szenen und ihrer Bedeutung für die Gesamtkomposition
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Gretchentragödie in Goethes „Faust I“ ein. Sie betont die Bedeutung des Gretchendrama für die Gesamtkomposition und hebt die gleichwertige Stellung neben der Gelehrtentragödie hervor. Goethes eigene Bezeichnung des Dramas als „zweiter Akt“, der das Schicksal des Bürgers und seines sozialen Aufstiegs neben dem des Gelehrten behandelt, wird zitiert. Die Arbeit kündigt eine Interpretation an, die die Herkunft des Namens „Gretchen“ und die relevanten Themen und Gattungen beleuchtet. Die Bedeutung des Bürgerlichen Trauerspiels und des Legendenstücks wird als Grundlage für die folgende Analyse eingeführt.
Die Herkunft des Namens „Gretchen“: Dieses Kapitel befasst sich mit den Gründen für Goethes Namenswahl. Es werden drei Aspekte hervorgehoben: Goethes erste große Liebe, der Fall der Kindsmörderin Susanna Margaretha Brandt (1772) und die damit verbundene Kindsmordthematik sowie die literarischen Traditionen des Bürgerlichen Trauerspiels und des Legendenstücks, die in der Figur der Gretchen ihren Niederschlag finden. Die Analyse verweist auf die juristische Tätigkeit Goethes und seine detaillierte Kenntnis des Falls Brandt. Die öffentlichen Kirchenbußen des 18. Jahrhunderts werden als gesellschaftlicher Hintergrund kritisch beleuchtet und mit dem Schicksal Gretchens in Verbindung gebracht. Goethes Ziel, humanes Verständnis für die verführten Frauen zu schaffen, wird als Motivation für seine Darstellung des Dramas hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Gretchen, Faust I, Goethe, Bürgerliches Trauerspiel, Legendenstück, Kindsmordthematik, Schuldfrage, soziale Ächtung, gesellschaftliche Normen, Namensdeutung.
Goethes Faust I: Gretchen-Tragödie - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Gretchentragödie in Goethes „Faust. Der Tragödie Erster Teil“. Sie untersucht die Bedeutung der Tragödie für das Gesamtwerk und analysiert zentrale Themen und Gattungen.
Welche Aspekte werden im Einzelnen betrachtet?
Die Analyse konzentriert sich auf die Herkunft des Namens „Gretchen“, die Einbettung der Tragödie in literarische Traditionen (Bürgerliches Trauerspiel und Legendenstück), die Kindsmordthematik, die Schuldfrage und die Szeneninterpretation.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Gretchentragödie für die Gesamtkonzeption von Goethes Faust I und analysiert die entscheidenden Themen und Gattungen. Ein Fokus liegt auf der Herkunft des Namens „Gretchen“ und seinen vielschichtigen Bezügen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Herkunft des Namens „Gretchen“, ein Kapitel zur Szeneninterpretation, ein Kapitel zur Schuldfrage und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Bedeutung des Gretchendrama neben der Gelehrtentragödie heraus. Das Kapitel zur Namensherkunft beleuchtet Goethes Motiv für die Namenswahl, den Fall Susanna Margaretha Brandt und die damit verbundene Kindsmordthematik sowie literarische Traditionen. Die Szeneninterpretation analysiert Gretchens Weg vom Eintritt in die „kleine Welt“ bis zu ihrem Untergang. Die Schuldfrage wird gesondert behandelt.
Welche literarischen Gattungen spielen eine Rolle?
Die Arbeit analysiert die Gretchentragödie im Kontext des Bürgerlichen Trauerspiels und des Legendenstücks. Diese Gattungen werden als Grundlage für die Interpretation der Tragödie verwendet.
Welche Rolle spielt die Kindsmordthematik?
Die Kindsmordthematik wird als wichtiger Aspekt der Gretchentragödie betrachtet. Der Fall der Kindsmörderin Susanna Margaretha Brandt und die damit verbundenen gesellschaftlichen Hintergründe werden im Kontext der Analyse beleuchtet.
Wie wird die Schuldfrage behandelt?
Die Arbeit untersucht die Schuldfrage und die Verantwortung sowohl von Faust als auch von Gretchen. Die gesellschaftlichen Normen und die soziale Ächtung werden dabei mitberücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gretchen, Faust I, Goethe, Bürgerliches Trauerspiel, Legendenstück, Kindsmordthematik, Schuldfrage, soziale Ächtung, gesellschaftliche Normen, Namensdeutung.
- Quote paper
- Anja Schäfer (Author), 2010, Die Gretchentragödie in Goethes "Faust. Der Tragödie Erster Teil.", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/198322