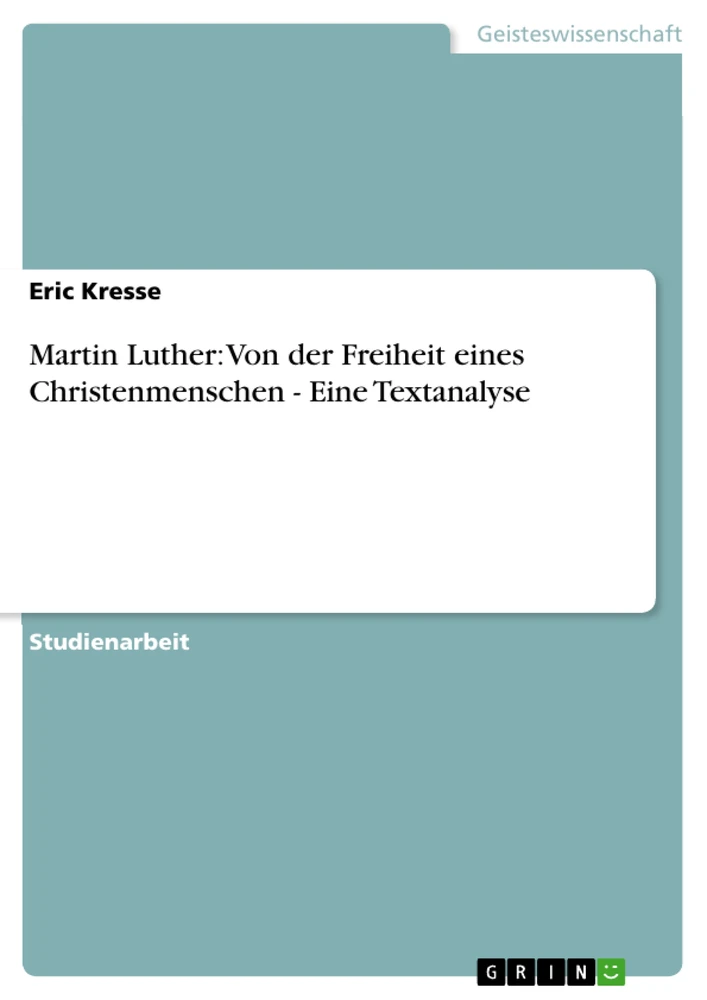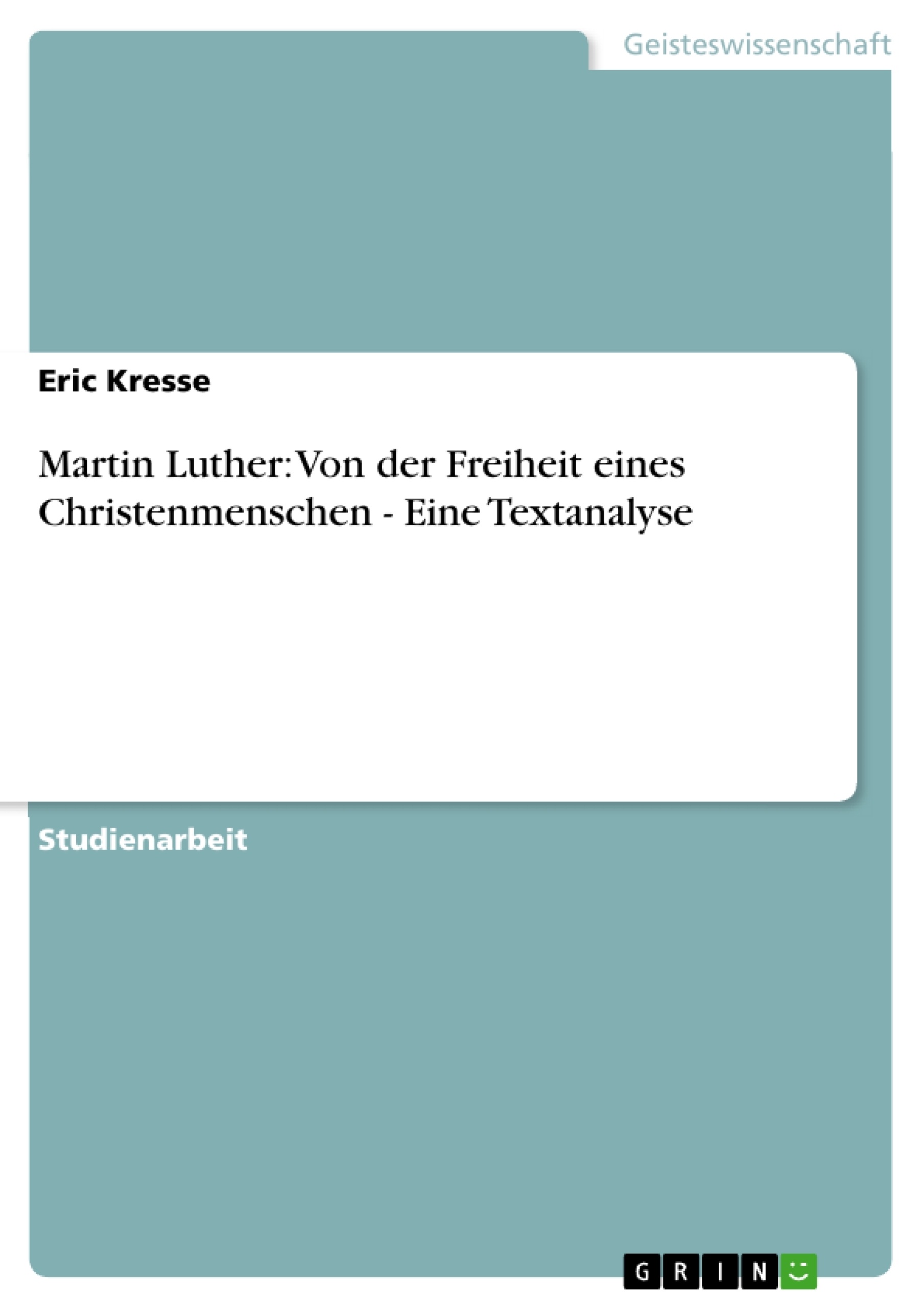Weltweit leben heute etwa eine halbe Milliarde bekennende Protestanten. Nach dem Katholizismus und dem Islam ist der Protestantismus die drittgrößte monotheistische Bewegung. Sich rasch im abendländischen Christentum ausbreitend, ging sie im 16.Jahrhundert aus Kontroversen über das Evangelium hervor. Einzig die Heilige Schrift sollte das Fundament des Glaubens bilden, was zu einem unausweichlichen Bruch mit dem Papst führte. Anhänger des Protestantismus sahen und sehen die Kirche in sich selbst, indem sie durch die Taufe zu Priestern werden.
Dieser Verantwortung gerecht zu werden, weiß der Protestant um seinen fehlenden Einfluss auf sein Heil und findet die Säulen seines Glaubens in der Heiligen Schrift und der Gnade Gottes. Somit kann er die Erlösung nicht durch Verdienste, Werke und Ämter erlangen, sondern einzig als eine Gabe Gottes. Im Gegensatz glauben Katholiken an ein durch Gott an den Menschen weitergegebenes Heilwirken: „Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein.“ (Matth. 16,19)
Kann nun ein geweihter Priester Beichte hören und in Gottes Namen vergeben, sodass auch Gott vergibt? Nicht im Protestantismus, der das Werk Gottes ohne menschliches Zutun durch Institutionen oder Ämter beschreibt. Dieser theologische Unterschied hatte die Differenzierung beider Konfessionen zu Folge. Der Glaube bedarf keines irdischen Mittlers, da sich die Heilige Schrift in absoluter Klarheit manifestiert hat. So sind evangelische Pfarrer Prediger, die das Wort Gottes an ihre Gemeinde richten und keinesfalls heilige Handlungen verrichten.
Doch um den Protestantismus zu verstehen, ist es nötig seine Geschichte zu verstehen und somit auch die Eckpfeiler. Die freie Interpretation der Heilige Schrift durch einen jeden Gläubigen führt diese Religion in einen stetigen Wandel. So definiert sich der Protestantismus primär als Kirchenreform , legt aber auch Wert auf seinen Ausdruck der gelebten und andauernden Entwicklung seit der Renaissance.
Der Umbruch im 16.Jahrundert war gewaltig: Martin Luthers Kritik an Praktiken des katholischen Glaubens, welche vielfach aus Rom diktiert wurden, erregte enormes Aufsehen und fand im deutschen Volk gleichsam viel Zuspruch. Im Streit mit dem Vatikan verfasste Luther die Schrift, welche in dieser Arbeit thematisiert werden soll: „Von der Freiheit eines Christenmenschen“.
Inhaltsverzeichnis
- Der Protestantismus - einleitende Betrachtungen
- Der Reformator Martin Luther
- Luthers Doppelthese
- Vom geistlichen Menschen
- Vom leiblichen Menschen
- Die ethische Richtlinie der Nächstenliebe
- Zusammenfassende Gedanken: Luthers Werk unter neuzeitlicher Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Textanalyse befasst sich mit Martin Luthers Schrift "Von der Freiheit eines Christenmenschen" und analysiert diese im Kontext der protestantischen Theologie des 16. Jahrhunderts. Sie will die zentralen Thesen Luthers im Werk herausarbeiten und ihre Bedeutung für den Protestantismus und die heutige Zeit erörtern.
- Luthers Doppelthese von Freiheit und Untertanenschaft des Christenmenschen
- Die Unterscheidung zwischen geistlichem und leiblichem Menschen
- Die Rolle des Evangeliums und der Gnade Gottes in der Rechtfertigung des Menschen
- Die Kritik am Ablasshandel und die Bedeutung der Heiligen Schrift
- Die ethische Implikation der Nächstenliebe
Zusammenfassung der Kapitel
- Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit dem Protestantismus als einer der drei großen monotheistischen Religionen. Er erklärt die Entstehung des Protestantismus aus der Reformation und beleuchtet die zentralen Unterschiede zwischen Katholizismus und Protestantismus. Der Abschnitt betont die Rolle der Heiligen Schrift als Grundlage des protestantischen Glaubens und die Bedeutung der Gnade Gottes für die Erlösung des Menschen.
- Das zweite Kapitel stellt Martin Luther als Reformator vor und beleuchtet seine Biografie und seine theologischen Auseinandersetzungen. Die Analyse konzentriert sich auf Luthers Kritik am Ablasshandel und seine frühen Schriften, die zu seiner Exkommunikation führten. Der Abschnitt thematisiert auch Luthers Beschäftigung mit der Frage der Rechtfertigung des Menschen vor Gott.
- Das dritte Kapitel behandelt die Doppelthese, die als zentrale Aussage der Schrift "Von der Freiheit eines Christenmenschen" angesehen werden kann. Die These postuliert, dass der Christenmensch sowohl frei als auch untertan ist. Luther erläutert diesen scheinbaren Widerspruch, indem er die Unterscheidung zwischen geistlichem und leiblichem Menschen hervorhebt.
- Das vierte Kapitel analysiert Luthers Gedanken zum geistlichen Menschen und betont die Unabhängigkeit des seelischen Zustands von äußeren Einflüssen. Die Analyse beleuchtet Luthers Kritik an den klerikalen Verhältnissen seiner Zeit und argumentiert, dass das Verhältnis zu Gott durch den Geist und nicht durch den Körper bestimmt wird.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Textanalyse sind: Protestantismus, Reformation, Martin Luther, "Von der Freiheit eines Christenmenschen", Doppelthese, geistlicher Mensch, leiblicher Mensch, Evangelium, Gnade Gottes, Rechtfertigung, Ablasshandel, Heilige Schrift, Nächstenliebe.
- Quote paper
- Eric Kresse (Author), 2009, Martin Luther: Von der Freiheit eines Christenmenschen - Eine Textanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/198221