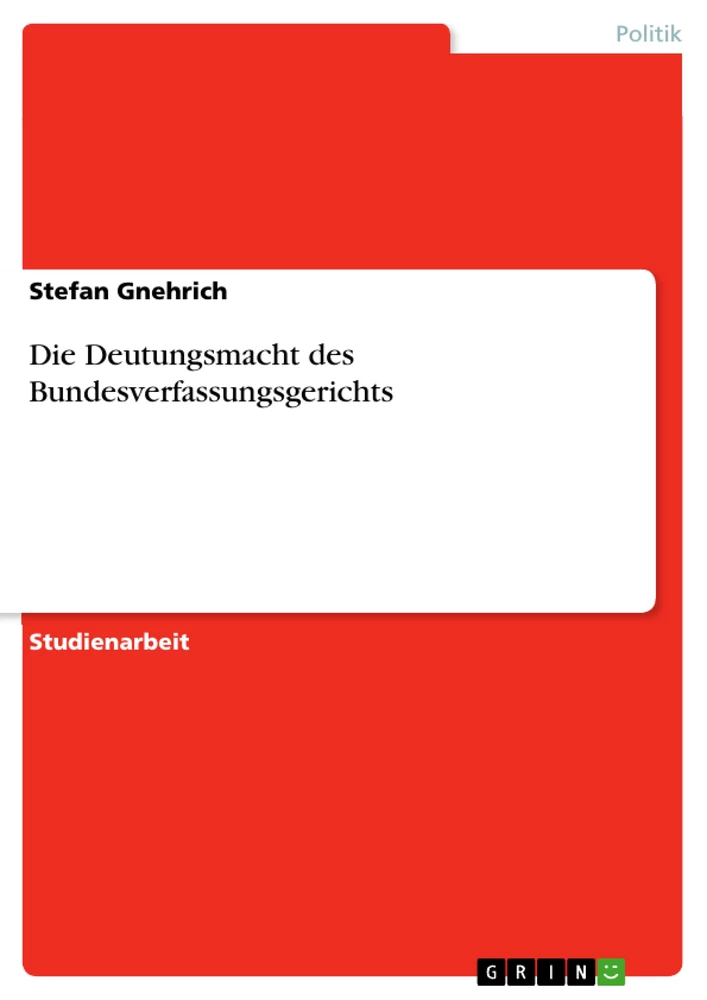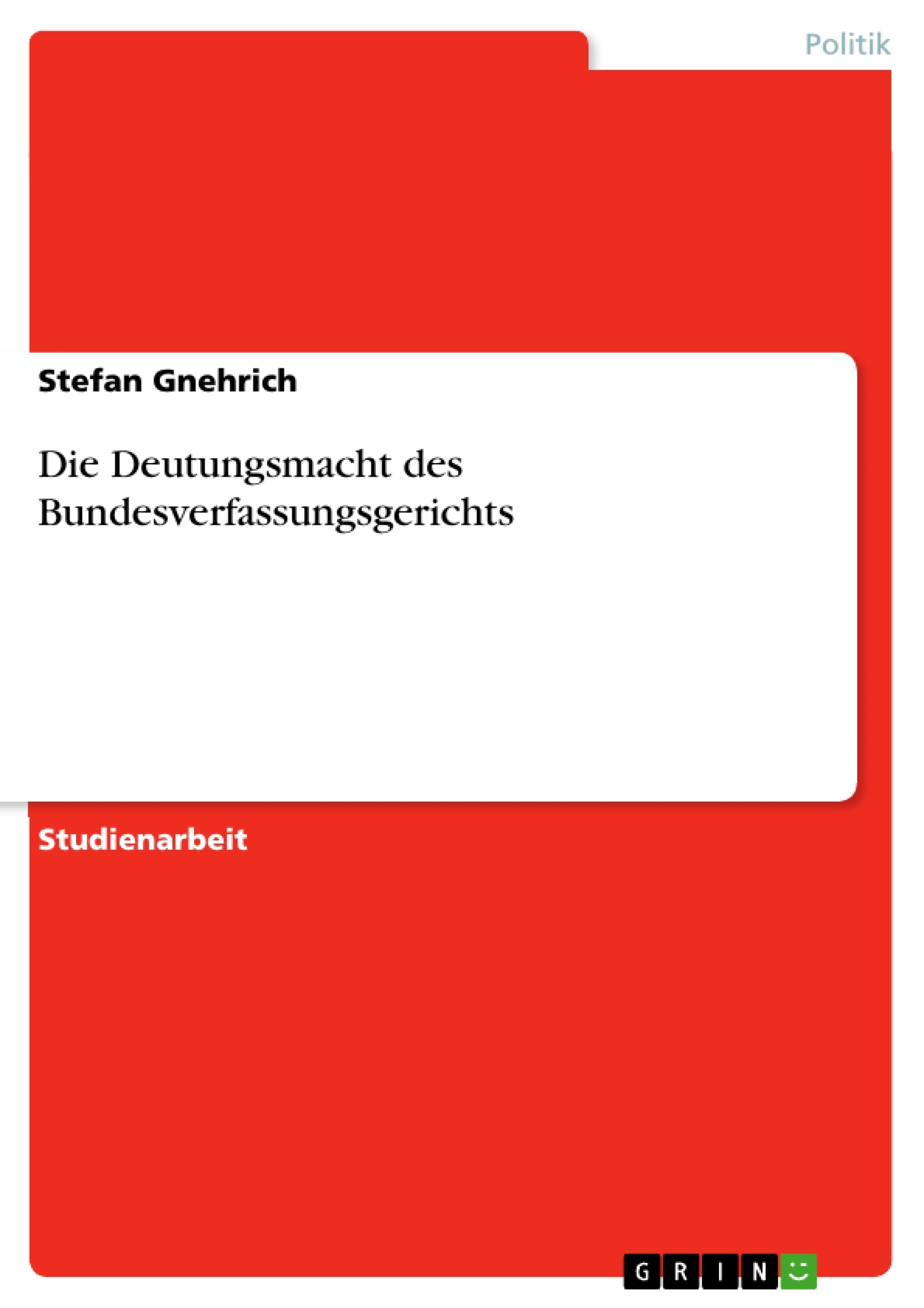„Deutschland braucht Europa, aber Europa braucht auch Deutschland.“
Theodor Heuss, der erste deutsche Bundespräsident, beschreibt in diesem historischen Zitat vortrefflich die schwierige Situation Europas hinsichtlich des Lissabon-Vertrags in den Jahren 2008 und 2009. Dem vorausgegangen waren Bestrebungen, die europäische Union infolge des Vertrags von Lissabon zu reformieren und gleichsam schlanker in ihrer Administration auszugestalten. Die Vertreter der 27 Mitgliedsstaaten unterzeichneten den Lissabon-Vertrag am 13. Dezember 2007. Aufgrund von immensen Schwierigkeiten bezüglich der Ratifikation, so etwa besonders durch das ablehnende Referendum Irlands, konnte der Vertrag erst knappe zwei Jahre später, am 01. Dezember 2009, völkerrechtlich anerkannt werden.
Auch in Deutschland führten die Zustimmungen zu den Reformierungsbestrebungen durch den Deutschen Bundestag und Bundesrat zu erheblichen Schwierigkeiten, denen schlussendlich ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts folgen sollte. Anlässlich beider mehrheitlicher Einwilligungen durch die genannten Organe wurden im Mai 2008 insgesamt sechs Verfahren durch Abgeordnete des Deutschen Bundestags sowie durch die Fraktion DIE LINKE beim Bundesverfassungsgericht eingeleitet. Sie begründeten ihre Klagen hinsichtlich des Verstoßes gegen die Artikel 20 Absatz I und II, 23 Absatz I, 79 Absatz III GG sowie gegen die Rechte des Bundestags als legislatives Organ und beantragten gleichsam den Erlass einer einstweiligen Anordnung sowie den Erlass auf andere Abhilfe. Aufgrund dessen musste das Bundesverfassungsgericht ein Grundsatzurteil in Bezug auf die Bedingungen und Grenzen der europäischen Union fällen. Es galt, den Vertrag von Lissabon sowie das deutsche Begleitgesetz auf die Vereinbarkeit mit dem deutschen Grundgesetz zu überprüfen. Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass jenes Grundsatzurteil eine Entscheidung darstellt, „die das Verhältnis zwischen nationalstaatlicher Souveränität und europäischer Integration zu justieren sucht.“ Jenes Verhältnis wird im folgenden Teil dieser Arbeit genauer analysiert und dargestellt, sodass Aussagen hinsichtlich der Deutungsmacht der Instanz Bundesverfassungsgericht generiert werden.
Inhalt
1. Einleitung
2. Die Deutungsmacht des Bundesverfassungsgerichts
2.1 Die Definition der Deutungsmacht
2.2 Diskussion zur Deutungsmacht am Fallbeispiel der „Lissabon-Entscheidung“
3. Fazit
4. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Deutschland braucht Europa, aber Europa braucht auch Deutschland.“[1]
Theodor Heuss
Theodor Heuss, der erste deutsche Bundespräsident, beschreibt in diesem historischen Zitat vortrefflich die schwierige Situation Europas hinsichtlich des Lissabon-Vertrags in den Jahren 2008 und 2009. Dem vorausgegangen waren Bestrebungen, die europäische Union infolge des Vertrags von Lissabon zu reformieren und gleichsam schlanker in ihrer Administration auszugestalten. Die Vertreter der 27 Mitgliedsstaaten unterzeichneten den Lissabon-Vertrag am 13. Dezember 2007. Aufgrund von immensen Schwierigkeiten bezüglich der Ratifikation, so etwa besonders durch das ablehnende Referendum Irlands, konnte der Vertrag erst knappe zwei Jahre später, am 01. Dezember 2009, völkerrechtlich anerkannt werden.
Auch in Deutschland führten die Zustimmungen zu den Reformierungsbestrebungen durch den Deutschen Bundestag und Bundesrat zu erheblichen Schwierigkeiten, denen schlussendlich ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts folgen sollte. Anlässlich beider mehrheitlicher Einwilligungen durch die genannten Organe wurden im Mai 2008 insgesamt sechs Verfahren durch Abgeordnete des Deutschen Bundestags sowie durch die Fraktion DIE LINKE beim Bundesverfassungsgericht eingeleitet. Sie begründeten ihre Klagen hinsichtlich des Verstoßes gegen die Artikel 20 Absatz I und II, 23 Absatz I, 79 Absatz III GG sowie gegen die Rechte des Bundestags als legislatives Organ und beantragten gleichsam den Erlass einer einstweiligen Anordnung sowie den Erlass auf andere Abhilfe.[2] Aufgrund dessen musste das Bundesverfassungsgericht ein Grundsatzurteil in Bezug auf die Bedingungen und Grenzen der europäischen Union fällen. Es galt, den Vertrag von Lissabon sowie das deutsche Begleitgesetz auf die Vereinbarkeit mit dem deutschen Grundgesetz zu überprüfen. Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass jenes Grundsatzurteil eine Entscheidung darstellt, „die das Verhältnis zwischen nationalstaatlicher Souveränität und europäischer Integration zu justieren sucht.“[3] Jenes Verhältnis wird im folgenden Teil dieser Arbeit genauer analysiert und dargestellt, sodass Aussagen hinsichtlich der Deutungsmacht der Instanz Bundesverfassungsgericht generiert werden.
2. Die Deutungsmacht des Bundesverfassungsgerichts
Um die Deutungsmacht des Bundesverfassungsgerichts am Beispiel der Lissabon-Entscheidung darzustellen, empfiehlt es sich, jene in zwei Bereiche zu kategorisieren. So lassen sich eine nationale sowie eine internationale Tendenz der Deutungsmacht konstatieren. Zunächst sollte jedoch der zentrale Gegenstand dieser Thematik klar definiert werden.
2.1 Die Definition der Deutungsmacht
Hans Vorländer beschreibt die Deutungsmacht als Bestimmung der verfassungsrichterlichen Machtbasis folgendermaßen: „Deutungsmacht kann (…) als eine spezifische Form von Macht verstanden werden, die sich auf symbolische und kommunikative Geltungsressourcen stützt und die sich in der Durchsetzung von Leitideen und Geltungsansprüchen manifestiert.“[4] Somit verleiht das Bundesverfassungsgericht grundlegenden Ordnungskonstruktionen des politischen Gemeinwesens Ausdruck. Es ist davon auszugehen, dass die Deutungsmacht vor allem auf der Autorität des Bundesverfassungsgerichts als autoritativer Verfassungsinterpret beruht. Das Gericht entscheidet aufgrund des hohen Abstraktionsgrades unter mehreren Bedeutungen der Verfassung. Sobald diese Deutungsangebote und Geltungsansprüche durchgesetzt und befolgt werden, besteht seitens des Bundesverfassungsgerichts ausgeübte Deutungsmacht.[5] Des Weiteren ist zu benennen, dass die Autorität des Gerichts von zweierlei Faktoren abhängt. Zum einen entscheidet jene Instanz im Sinne der Verfassung, sodass davon auszugehen ist, dass die Autorität mit der Wirkungsmacht der Verfassung eng verbunden ist. Zum anderen sollten sich die verfassungsrichterlichen Entscheidungen nicht zu weit von der mehrheitlichen gesellschaftlichen Akzeptanz verorten, da eben auch die Autorität von genau dieser Akzeptanz abhängt. Schließlich konstruiert sich „über eine Folge von zustimmungsfähigen Entscheidungen (...) ein generalisiertes Vertrauen in die Institution der Verfassungsgerichtsbarkeit (...).“[6] Abschließend ist auf die Wirkung dieser verfassungsgerichtlichen Deutungsmacht einzugehen, da jene in der angeschlossenen Darstellung den Kern aller Aussagen bildet. So bleibt zu konstatieren, dass es sich um eine weiche, aber dennoch nachhaltige Form[7] der Machtausübung handelt, deren „Wirkung in der Stabilisierung von Leitideen über die Herstellung von Dauerhaftigkeit“[8] liegt. Letztlich verfügt jenes Organ auch nur dann über eine hohe Deutungsmacht, wenn durch die Institution an sich sowie deren Entscheidungen die legitime politische Kultur repräsentiert wird.[9] Demnach wird deutlich, dass das Bundesverfassungsgericht über keinerlei Sanktionsmittel, ähnlich der vollziehenden Gewalt, verfügt, sondern dass es seine Autorität einzig aus der Wirkung als autoritativer Verfassungsinterpret bezieht. Dennoch entscheidet es gleichsam über verschiedene Handlungsabläufe und kann dadurch die Akteure des politischen Systems wirkungsvoll an seine Entscheidungen binden.
Anhand dieser Darstellungen sollen nun im folgenden Teil der vorliegenden Arbeit Aussagen hinsichtlich der Deutungsmacht des Bundesverfassungsgerichts am Fallbeispiel der „Lissabon-Entscheidung“ getroffen werden.
[...]
[1] http://www.zitate.de/db/ergebnisse.php?sz=2&stichwort=&kategorie=Euro&autor= (letzter Zugriff am 22. Februar 2012).
[2] Vgl. BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009, S. 2 ff., http://www.bverfg.de/entscheidungen/es 20090630_2bve000208.html (letzter Zugriff am 22. Februar 2012).
[3] Vorländer, Hans: Regiert Karlsruhe mit? Das Bundesverfassungsgericht zwischen Recht und Politik, in: APuZ 35-36 (2011), S. 17.
[4] Vorländer, Hans: Die Deutungsmacht der Verfassungsgerichtsbarkeit, Wiesbaden 2006, S. 17.
[5] Vgl. Schulz, Daniel: Theorien der Deutungsmacht. Ein Konzeptualisierungsversuch im Kontext des Rechts, in: Vorländer, Hans (Hrsg.): Die Deutungsmacht der Verfassungsgerichtsbarkeit, Wiesbaden 2006, S. 67.
[6] Vorländer, Hans: Regiert Karlsruhe mit? Das Bundesverfassungsgericht zwischen Recht und Politik, in: APuZ 35-36 (2011), S. 18.
[7] Vgl. Ebd. S. 18 f.
[8] Schulz, Daniel: Theorien der Deutungsmacht. Ein Konzeptualisierungsversuch im Kontext des Rechts, in: Vorländer, Hans (Hrsg.): Die Deutungsmacht der Verfassungsgerichtsbarkeit, Wiesbaden 2006, S. 67 f.
[9] Vgl. Schubert, Sophia / Kosow, Hannah: Das Konzept der Deutungsmacht. Ein Beitrag zur gegenwärtigen Machtdebatte in der Politischen Theorie?, in: ÖZP 36 (2007), S. 42.
- Quote paper
- Stefan Gnehrich (Author), 2012, Die Deutungsmacht des Bundesverfassungsgerichts, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/198183