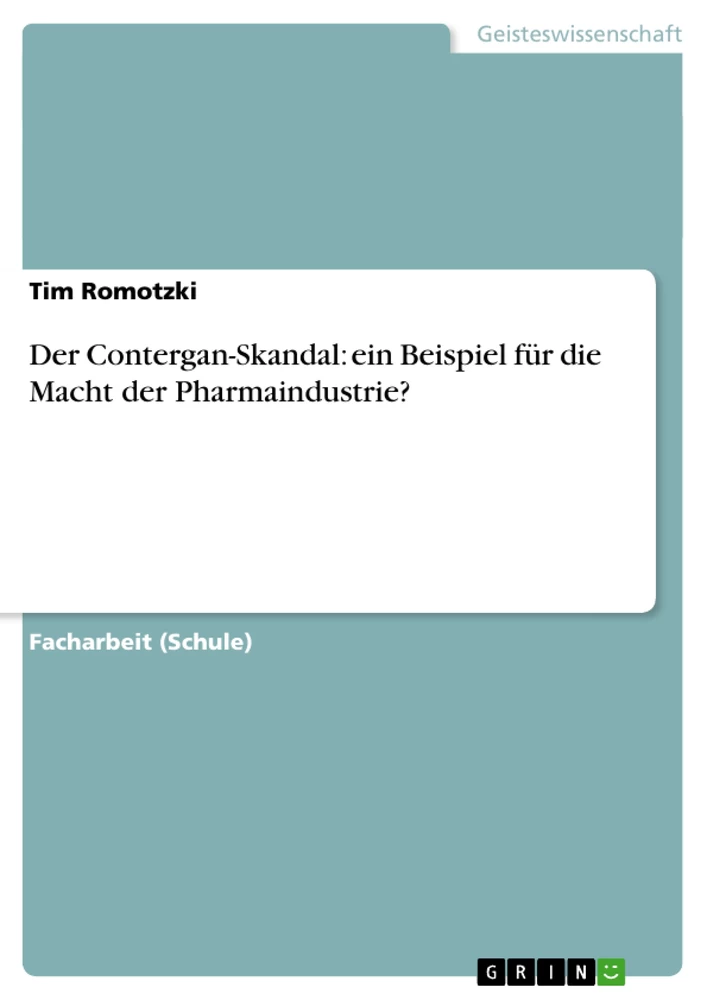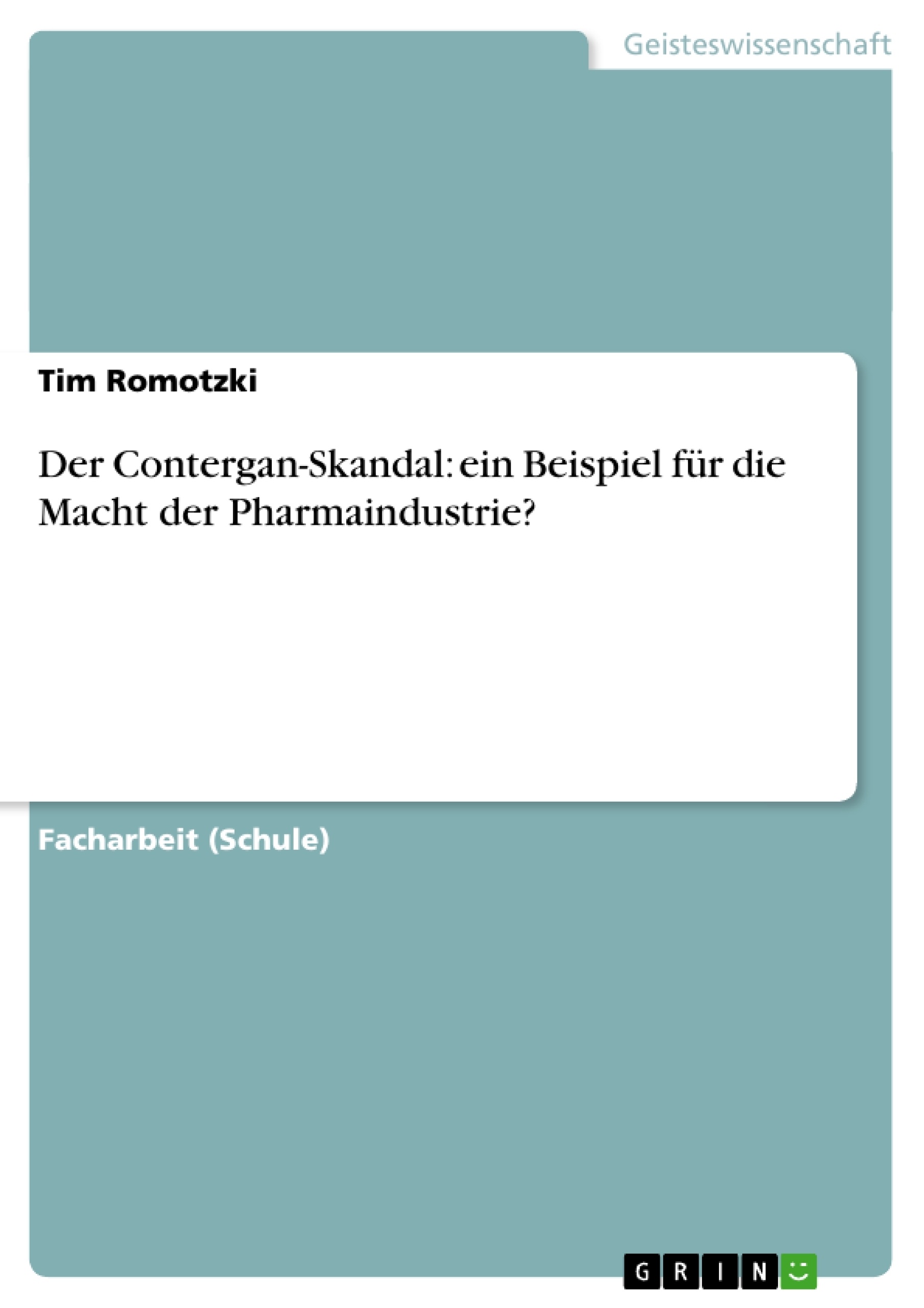Die 60er Jahre. Ein ereignisreiches Jahrzehnt voller Konflikte Errungenschaften Umbrüche und revolutionären Strömungen mit weltverändernden Auswirkungen. „Mauerbau, Mondlandung, Studentenproteste, der Besuch des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy in Berlin und dessen Ermordung – Bilder, die sich im kollektiven Gedächtnis für die 60er Jahre eingebrannt haben“. Kaum einem ist aber der größte Medizinskandal der Nachkriegszeit ein Begriff. Die Umstände des sogenannten Conterganskandals sind bis zum heutigen Tage sehr undurchsichtig und unzureichend geklärt worden. Wirkungsmechanismen, Verantwortlichkeiten und Schuldfragen geben Rätsel auf. Somit muss man die Frage gestatten, ob „ Der Contergan Skandal: ein Beispiel für die Macht der Pharmaindustrie? “ist. Diese Arbeit beschäftigt sich also damit, dem Leser einen Eindruck der Vorkommnisse zu vermitteln und auf dieser Basis zu erörtern, ob und falls dem so sein sollte, warum der Conterganskandal die Macht der Pharmaindustrie zum Ausdruck bringt.
Inhaltsverzeichnis
Präambel
1. Vorgeschichte und Entdeckung
1.1. Entwicklung des Wirkstoffes Thalidomid
1.2. Markteinführung Contergan S. 1
1.3. Arzneimittelgesetz und die freiwillige Selbstkontrolle
2. Bedeutung für die „Grünenthal-Chemie“
2.1. Vermarktung
2.2. Contergan als Umsatzgarant
2.3. Risiken und Nebenwirkungen
2.4. Die Rollen Schulte-Hillen und Dr. Lenz
3. Die Geschädigten und ihre Schäden
3.1 Nervenstörungen
3.2 Aplasien/Dysmelien
4. Der dreifache Skandal
4.1. Contergan und „Grünenthal“
4.2. Contergan und die Justiz
4.2.1. Der Prozess
4.3. Contergan, die Opfer und der Streitfaktor Geld
4.4. Nachwirkungen
Resümee
Literaturverzeichnis
Präambel
Die 60er Jahre. Ein ereignisreiches Jahrzehnt voller Konflikte Errungenschaften Umbrüche und revolutionären Strömungen mit weltverändernden Auswirkungen. „Mauerbau, Mondlandung, Studentenproteste, der Besuch des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy in Berlin und dessen Ermordung - Bilder, die sich im kollektiven Gedächtnis für die 60er Jahre eingebrannt haben"[1]. Kaum einem ist aber der größte Medizinskandal der Nachkriegszeit ein Begriff. Die Umstände des sogenannten Conterganskandals sind bis zum heutigen Tage sehr undurchsichtig und unzureichend geklärt worden. Wirkungsmechanismen, Verantwortlichkeiten und Schuldfragen geben Rätsel auf. Somit muss man die Frage gestatten, ob „ Der Contergan Skandal: ein Beispiel für die Macht der Pharmaindustrie?[2] "ist. Diese Arbeit beschäftigt sich also damit, dem Leser einen Eindruck der Vorkommnisse zu vermitteln und auf dieser Basis zu erörtern, ob und falls dem so sein sollte, warum der Conterganskandal die Macht der Pharmaindustrie zum Ausdruck bringt.
1. Vorgeschichte und Entdeckung
1.1 Entwicklung des Wirkstoffes Thalidomid
Mitte der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts erfand die 1947 gegründete Firma „Chemie Grünenthal“ den Wirkstoff Thalidomid. Durch Zufall entdeckten die Erfinder Dr. Dr. Keller und Dr. Kunz im Jahre 1954 den besagten Wirkstoff sowie dessen einschläfernde Wirkung und gaben ihm aufgrund seiner chemischen Substanz den Namen, beziehungsweise das Kürzel „K17“. Erst später wurde es in „Contergan“ umgetauft und unter diesem Namen deutschlandweit vertrieben. Vorangegangene Versuchsreihen an Nagetieren zeigten keine nennenswerten negativen Auffälligkeiten. Darüber hinaus fiel positiv auf, dass die tödliche Dosis, die sogenannte „dosis letalis“, nahezu ausgeschlossen sei - ein absolutes Novum für Beruhigungs/Schlafmittel zu dieser Zeit. Die Erprobung des Wirkstoffes am menschlichen Körper verlief ohne unerwartete Nebenwirkungen und wurde interessanterweise nicht intensiviert, war doch der genaue Wirkungsmechanismus im Körper fast gänzlich unbekannt. Bereits Ende 1955 galt es betriebsintern als „klinisch getestet“ und wurde schon Anfang 1956 vom Forschungsleiter Dr. Mückter inoffiziell für den Verkauf freigegeben[3].
1.2 Markteinführung Contergan
Der bereits im Jahre 1955 vorbereitete Verkaufsstart von Contergan verzögerte sich unter anderem aufgrund von kritischen Stimmen von Prüfern auf dem ConterganSymposium 1956 bis ins Jahr 1957. Am 1. Oktober 1957 war es dann soweit. Contergan wurde in den Arzneimittelmarkt eingeführt und war fortan in Deutschland und auch in vielen Regionen der Erde rezeptfrei erhältlich. „Contergan“ - „Contergan forte“, so die deutschen Betitelungen des Thalidomidpräparates, waren in Apotheken in Form von Tabletten, Saft, Tropfen oder Zäpfchen erhältlich und versprachen eine sedative Wirkung bei völliger Ungiftigkeit und Gefahrenlosigkeit.[4] Mit der Zeit erfreute sich das Mittel immer größerer Beliebtheit und wurde auch von Ärzten und Apothekern aufgrund seiner guten Verträglichkeit gerne empfohlen und verschrieben. Anfangs noch eines von vielen, tat sich Contergan alsbald als Kundenmagnet hervor und nahm somit eine marktführende Position ein.
1.3 Arzneimittelgesetz und die freiwillige Selbstkontrolle
Anders als medial oft berichtet existierte bis Anfang der 1960er Jahre kein gesetzlich festgelegtes Arzneimittelgesetz. Alle entwickelten Medikamente waren also frei von jeglicher Prüfung, abgesehen von der durch die Pharmaindustrie sich selbst auferlegte freiwillige Selbstkontrolle, welche lediglich Maßstäbe für die prüfenden Verfahrens- und Kontrollvorgänge ausgelotet hatte. Untersuchungen von übergeordneten und vor allem unabhängigen Instanzen waren für Pharmaunternehmen nicht festgelegt.
2. Bedeutung für die „Chemie-Grünenthal“
2.1 Vermarktung
Die Vermarktungsstrategie des neuen „Wundermittels“ Contergan, baute grundsätzlich auf der besonders guten Verträglichkeit für alle Altersklassen sowie auf der hohen Sicherheit und seinen geringen Nebenwirkungen auf. Die sehr oft mit Metaphern gespickten Slogans lanciertem dem Leser Paradiesisches(siehe Anhang: Abb. 1). Diese wohlklingenden Parolen wurden oft begleitet von idyllischen Bildnissen und ruhig und friedlich anmutenden Naturschauspielen, was die Harmlosigkeit Contergans unterstreichen sollte. Einen weiteren Faktor stellt in diesem Zusammenhang die Mutter-Kind-Beziehung dar, denn Contergan bot als erstes Schlafmittel überhaupt Eltern die Möglichkeit ihren Kleinsten mit ruhigem Gewissen das Einschlafen zu erleichtern oder das Einschlafen einfach zu beschleunigen. Das elterliche Motiv bot sich zudem optimal als Werbeträger an, da ein kinderfreundliches Medikament sicherlich keine negativen Auswirkungen auf den Körper eines Erwachsenen oder auf den einer schwangeren Frau haben könne, so der damalige Glauben. Das Kindeswohl als Werbeträger[5] sowie die Schlagworte „‘ungiftig‘ [,] ‘gefahrlos‘ [und] ‘atoxisch‘“[6], aber vor allem die oftmals stolz verkündete Aussage, dass Contergan „‘unschädlich wie Zuckerplätzchen‘“[7] sei, verfehlten ihre Wirkung nicht und so wurde Contergan auch werdenden Müttern gegen die morgendliche Schwangerschaftsübelkeit empfohlen und fand auch davon abgesehen einen florierenden Ansatzmarkt.
2.2 Contergan als Umsatzgarant
Ausgehend von dem kleinen rheinländischen Städtchen Stolberg bei Aachen, dem Firmensitz der Grünenthal-Chemie, entwickelte sich das Thalomidpräparat, einzusetzen bei „Schlafstörungen, (...), Nervosität, Migräne und den sogenannten Befindlichkeitsstörungen“[8], als ein weltweiter Verkaufsschlager der dem kleinen Familienunternehmen viel Geld in die Kassen spülte. Hatten sich die Einnahmen bisher über den Verkauf von Antibiotika definiert, entwickelte sich Contergan nach und nach zum Umsatzgaranten und brachte der Firma zeitweise einen monatlichen „Netto- Verkaufserlös(...)[von] 1.364.458 Mark“[9] ein. Nahmen im Jahre 1959 350.000 Bundesbürger Contergan täglich ein, waren es im Oktober 1960 bereits 700.000, also das Doppelte. Als nur ein Jahr später bereits über eine Millionen Bundesdeutsche täglich Gebrauch vom Hypnotikum - wie es im Beipackzettel heißt - machten, avancierte Contergan zum Lieblingsschlafmittel der Deutschen, wenn es so etwas gibt.[10] In einem Zeitraum von nur vier Jahren betrug der „Contergan-Umsatz der Firma Grünenthal(...)24.197.144 Mark“[11] was einen „Anteil von 46 Prozent des barbituratfreien Schlafmittelmarktes“[12] ausmachte. Der Höhenflug Contergans schien keine Grenze zu kennen. Lizenzen wurden gewinnbringend an Unternehmen im Ausland verkauft, der Export machte mehr als ein Viertel des Umsatzes aus und die Forschungsleitung begann Thalidomid mit anderen Wirkstoffen, beispielsweise dem des Aspirin zu kombinieren um durch die entstehenden sogenannten Kombinationspräparate ein breiteres Verbraucherspektrum ansprechen zu können und dadurch den Absatzmarkt zu vergrößern.[13] Es schien so als habe Grünenthal mit dem Thalidomid eine unerschöpfliche „Goldgrube“ gefunden, allerdings mussten alle Beteiligten später feststellen, dass dem nicht so war.
2.3 Risiken und Nebenwirkungen
Erste Berichte über Nebenwirkungen tauchten bereits in der Erprobungsphase Contergans zwischen 1955 und 1957 auf, als man einigen wenigen Ärzten den Auftrag erteilte, Contergan in Form von Testreihen an Patienten zu erproben, die Ergebnisse zu protokollieren und die Grünenthal-Chemie umfassend zu informieren. Den bei einigen Patienten auftretenden Schwindel nahm man nicht wirklich ernst und vermutete persönliche Überempfindlichkeit oder unangepasste Dosierung als Ursache dessen. Mit steigenden Verkaufszahlen stieg einerseits die Anzahl der positiven Berichte über Contergan, andererseits aber auch die Anzahl der Berichte über Nebenwirkungen wie „ Verwirrtheit, Benommenheit, Verlust des Gedächtnisses, Blutdruckabfall“[14] und weiteren Symptomen ausgesprochen stark an. Firmenintern kamen Zweifel auf ob das Informationsdefizit bezüglich der Wirkungsweise, den Einflüssen auf den Stoffwechsel sowie den Auswirkungen für Organe, wie beispielsweise der Leber, in Zukunft zu akzeptieren sei. Nach Außen hin, das heißt der Öffentlichkeit gegenüber, gab sich Grünenthal allerdings stets selbstbewusst, überzeugt und souverän was Contergan betraf und man propagierte weiter die außerordentlich gute Verträglichkeit und betrachtete Nebenwirkungen weiterhin als nahezu ausgeschlossen. Selbst nachdem Ende 1959 vielen Ärzte und Apotheker über die beobachtete sogenannte Polyneuritis klagten, welche Sie auf die Einnahme von Contergan bzw. Thalidomid zurückführten, stieß man bei Grünenthal auf taube Ohren. Das „prickelnde(...) Gefühl in den Extremitäten [und die] Empfindungen der Taubheit und Kälte(Parästhesie)“[15] können man nicht auf die Einnahme von thalidomidhaltigen Medikamenten ableiten, so die Meinung der Grünenthal-Verantwortlichen. Dennoch musste der Pharmakonzern die ab August 1961 eingeführte Rezeptpflicht in einigen Bundesländern in Kauf nehmen. Die stetige diskrete Anpassung des Beipackzettels reichte nicht mehr aus. So musste sich Grünenthal auch aufgrund von über 1600 Berichten von Ärzten, Patienten und Apothekern, welche von mal mehr mal weniger schwerwiegenden Nebenwirkungen berichteten, damit abfinden, dass Contergan eben doch keine fehlerfreies Wundermittel war, sondern auch Risiken birgt. Demun- geachtet bestritt der Konzern den Zusammenhang zwischen Polyneuritis und Contergan vehement und verwies in Bezug auf eine mögliche Toxizität des Präparats auf verleumderische Kampagnen der Konkurrenz.
[...]
[1] http://www.daserste.de/60erjahre/, 29.05.2011, 13:31
[2] Klaus Rockmann
[3] Vgl. Gero Gembella, Der dreifache Skandal, Hamburg 1993, S.15-19
[4] Vgl. Catia Monser, Contergan/Thalidomid: Ein Unglück kommt selten allein, Düsseldorf 1993, S.12-14
[5] H.Sjöström & R. Nilsson, Contergan oder die Macht der Arzneimittelkonzerne, Harmondsworth, Middlesex, England 1972, S. 43
[6] DER SPIEGEL 49/1962, 05.12.1962, S.72, http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45125108.html, 16. Mai 2011, 17.13 Uhr
[7] DER SPIEGEL 49/1962, ebda., S.72
[8] Catia Monser, ebda., S.17
[9] Gero Gemballa, ebda., S.25
[10] DER SPIEGEL 49/1962, ebda., S.72
[11] DER Spiegel, 23/1968, 03.06.1968, S.47 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46039709.html, 16.05.2011, 20:23Uhr
[12] L.Zichner M.A. Rauschmann K.-D. Thomann, Die Contergankatastrophe-Eine Bilanz nach 40 Jahren, Darmstadt 2005, S.3
[13] H.Sjöström & R. Nilsson, Contergan oder die Macht der Arzneimittelkonzerne, Harmondsworth, Middlesex, England 1972, S. 43
[14] H. Sjöström & R. Nilsson, ebda., S.55
[15] H. Sjöström & R. Nilsson, ebda., S.56
- Quote paper
- Tim Romotzki (Author), 2011, Der Contergan-Skandal: ein Beispiel für die Macht der Pharmaindustrie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/197830