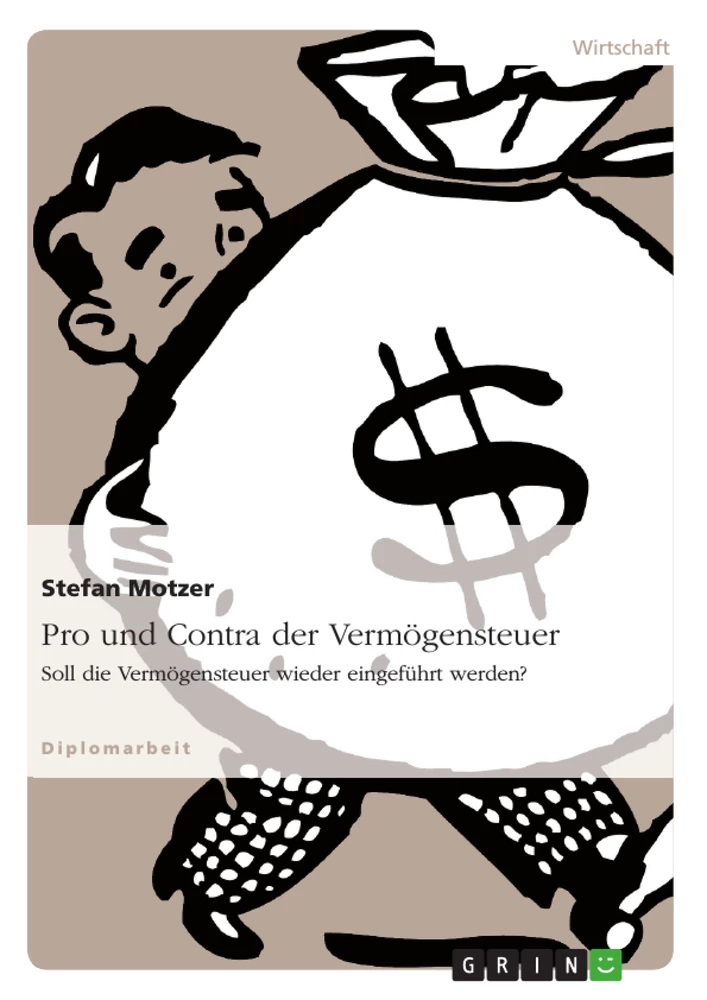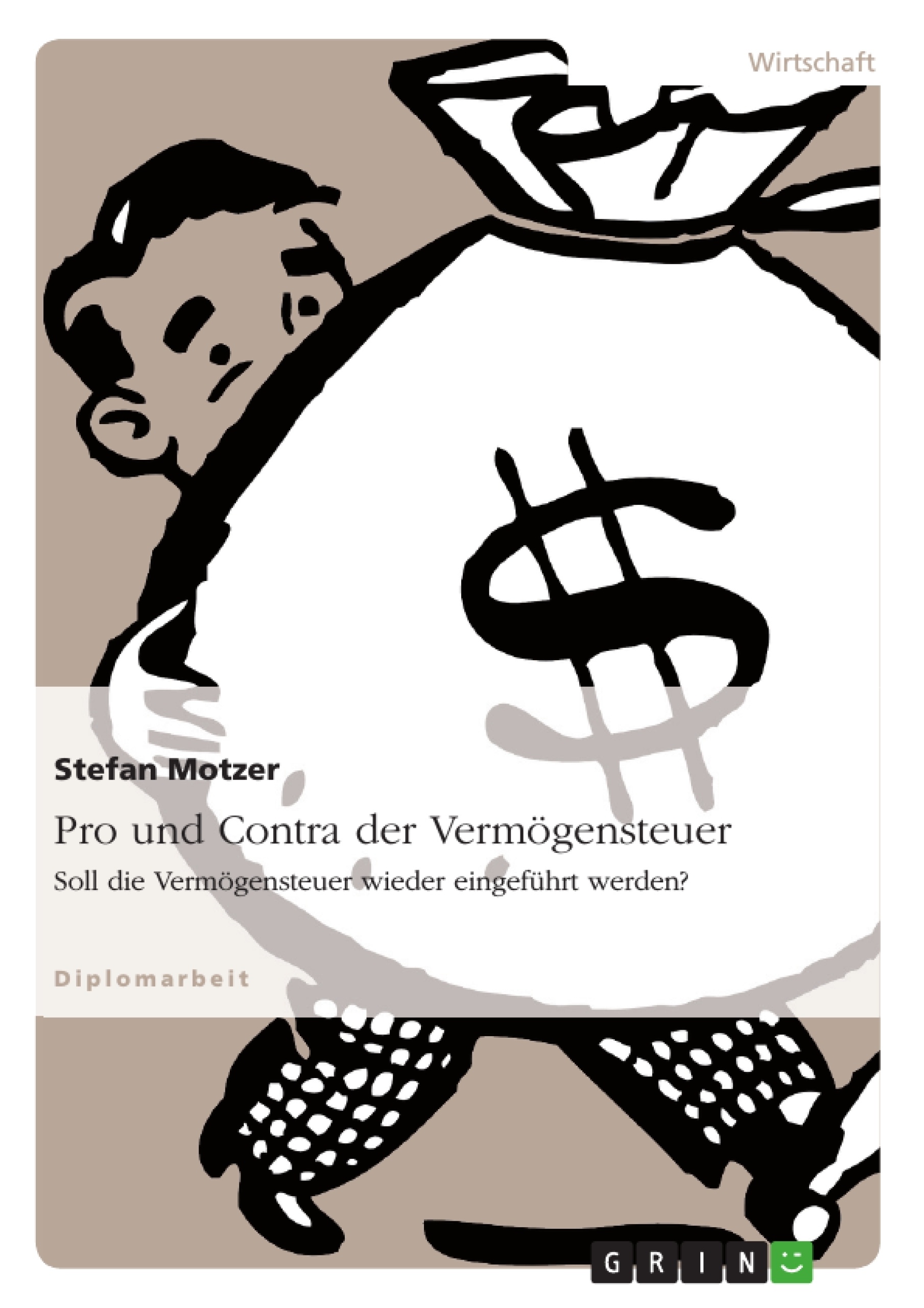Die Frage nach einer möglichen Wiedereinführung der Vermögensteuer in Deutschland sorgt seit ihrer Aussetzung im Jahre 1997 für kontroverse Diskussionen. Dabei erfahren die Fürsprecher von der Öffentlichkeit eine breite Zustimmung. Es darf in dieser Angelegenheit jedoch nicht übersehen werden, dass die meisten Bürger nicht zu dem von der Vermögenssteuererhebung betroffenen Personenkreis gehören.
Unabhängig von dem vorherrschenden Meinungsbild soll in diesem Buch untersucht werden, welche Argumente für und welche gegen die Wiedereinführung der Vermögensteuer sprechen könnten. Dabei wird lediglich auf eine Vermögensteuer für natürliche, nicht aber für juristische Personen eingegangen.
Nach einer kurzen Charakterisierung der „nominellen Vermögensteuer“ und deren Abgrenzung zur „realen Vermögensteuer“ werden sowohl die Argumente, die für die Vermögensteuer angeführt werden, als auch die Contra-Argumente dargestellt und jeweils unmittelbar danach auf ihre Stichhaltigkeit untersucht.
Im Anschluss daran wird der sog. „Einheitswert-Beschluss“ des BVerfG vom 22.06.1995 einer kritischen Betrachtung unterzogen.
Dabei wird vor allem auf den darin installierten Halbteilungsgrundsatz und der mit ihm verbundenen Schwierigkeiten in Bezug zu einer möglichen Wiedereinführung der Vermögensteuer eingegangen – ein Punkt, der in Literatur, Politik und Presse für viel Aufsehen gesorgt hatte.
Es folgt ein internationaler Vergleich innerhalb der OECD-Mitgliedstaaten, der aufzeigt, welche Staaten überhaupt eine nominelle Vermögensteuer erheben und welche Tendenz in den letzten Jahrzehnten ersichtlich ist.
Eine kurze Übersicht über das Stimmungsbild innerhalb der Politik zeigt die Positionen der einzelnen Parteien auf.
Die Schlussbetrachtung aller genannten Pro- und Contra-Argumente gibt Antwort auf die zu Anfang aufgeworfene Frage, ob die Vermögensteuer wieder eingeführt werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Charakterisierung der „,nominellen Vermögensteuer“
- 3. Argumente für die Vermögensteuer
- 3.1 Argumente der Belastungsgerechtigkeit
- 3.1.1 Rechtfertigung mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip
- 3.1.1.1 Definition des Leistungsfähigkeitsprinzips
- 3.1.1.2 Fundierungstheorie
- 3.1.1.3 Vermögensbesitztheorie
- 3.1.1.4 Theorie des mühelosen Ertrages
- 3.1.1.5 Freizeittheorie
- 3.1.2 Rechtfertigung mit dem Äquivalenzprinzip
- 3.1.2.1 Definition des Äquivalenzprinzips
- 3.1.2.2 Rechtfertigung
- 3.2 Nachholfunktion der Vermögensteuer
- 3.3 Kontrollfunktion der Vermögensteuer
- 3.4 Haushaltsbedarf (der Länder)
- 3.5 Umverteilungsargument
- 3.6 Motivations- und Lenkungsfunktion
- 3.7 Vermögensteuer als Vorauserhebung auf die künftige Erbschaftsteuer
- 3.8 Vermögensteuer als Ergänzung zur Umsatzsteuer
- 3.9 Ehrwürdiges Alter der Steuer
- 4. Argumente gegen die Vermögensteuer
- 4.1 Begriffs- und Abgrenzungsproblematik
- 4.2 Bewertungsproblematik
- 4.3 Verwaltungs- und Befolgungskosten
- 4.4 Erfassungs- und Vollzugsproblematik
- 4.5 Steuerausweichmöglichkeiten
- 4.6 Probleme infolge des Sollertragscharakters der Vermögensteuer
- 5. Einheitswert-Beschluss des BVerfG
- 5.1 Billigung der Vermögensteuer
- 5.2 Tenor bzgl. des vorgelegten Prüfgegenstandes
- 5.3 Äußerungen zur zukünftigen Verfassungskonformität
- 5.3.1 Bewertungsvorgaben
- 5.3.2 Persönlicher Freibetrag
- 5.3.3 Schutz des Vermögensstammes
- 5.3.4 „Halbteilungsgrundsatz“
- 5.3.4.1 Verfassungsrechtliche Kritik
- 5.3.4.2 Auslegungsschwierigkeiten
- 5.3.4.2.1 Ausdeutung der Bemessungsgrundlage „Sollertrag“
- 5.3.4.2.2 Einzubeziehende Steuern auf den Sollertrag
- 5.3.4.2.3 Grenz- oder Durchschnittssteuersatz
- 5.3.4.3 Bewertung
- 5.4 Konsequenzen des Beschlusses bei einer zukünftigen Erhebung
- 5.4.1 Aufkommen
- 5.4.2 Umverteilungsargument
- 5.4.3 Verwaltungskosten
- 6. Vergleich innerhalb der OECD-Mitgliedstaaten
- 7. Stimmungsbild in der Politik
- 8. Zusammenfassung und Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und in welcher Form eine Vermögensteuer in Deutschland gerechtfertigt und sinnvoll wäre. Sie beleuchtet die Argumente für und gegen eine solche Steuer sowie die verfassungsrechtlichen und ökonomischen Aspekte.
- Die Rechtfertigung der Vermögensteuer durch das Leistungsfähigkeitsprinzip und das Äquivalenzprinzip.
- Die ökonomischen Auswirkungen einer Vermögensteuer auf die Wirtschaft und die Vermögensverteilung.
- Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit und die praktischen Herausforderungen bei der Umsetzung einer Vermögensteuer.
- Die internationale Perspektive auf die Vermögensteuer im Vergleich zu anderen OECD-Mitgliedstaaten.
- Die aktuelle politische Debatte und die verschiedenen Standpunkte zur Einführung einer Vermögensteuer in Deutschland.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Vermögensteuer und deren aktuelle Relevanz. Anschließend wird die „nominelle Vermögensteuer“ näher charakterisiert und deren Funktionsweise erläutert. Im dritten Kapitel werden die Argumente für die Vermögensteuer beleuchtet. Hierbei werden insbesondere die Argumente der Belastungsgerechtigkeit, die Nachholfunktion, die Kontrollfunktion und das Umverteilungsargument hervorgehoben.
Kapitel vier beschäftigt sich mit den Argumenten gegen die Vermögensteuer. Es werden die Problematiken der Bewertung, der Verwaltungs- und Befolgungskosten, sowie die Erfassungs- und Vollzugsproblematik diskutiert.
Im fünften Kapitel wird der Einheitswert-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 1995 analysiert. Dieser Beschluss befasst sich mit der Verfassungsmässigkeit der Vermögensteuer und beinhaltet wichtige Aussagen zur zukünftigen Erhebung dieser Steuer.
Kapitel sechs bietet einen Vergleich der Vermögensteuer innerhalb der OECD-Mitgliedstaaten und beleuchtet die unterschiedlichen Systeme und deren Auswirkungen.
Das siebte Kapitel stellt die aktuelle Stimmungslage in der Politik zur Vermögensteuer dar und analysiert die unterschiedlichen Positionen von Parteien und politischen Akteuren.
Schlüsselwörter
Vermögensteuer, Belastungsgerechtigkeit, Leistungsfähigkeitsprinzip, Äquivalenzprinzip, Einheitswert, Bundesverfassungsgericht, OECD, Umverteilung, Steuerausweichung, Bewertungsproblematik, Verwaltungsaufwand, politische Debatte.
- Quote paper
- Stefan Motzer (Author), 2002, Pro und Contra der Vermögensteuer, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/19771