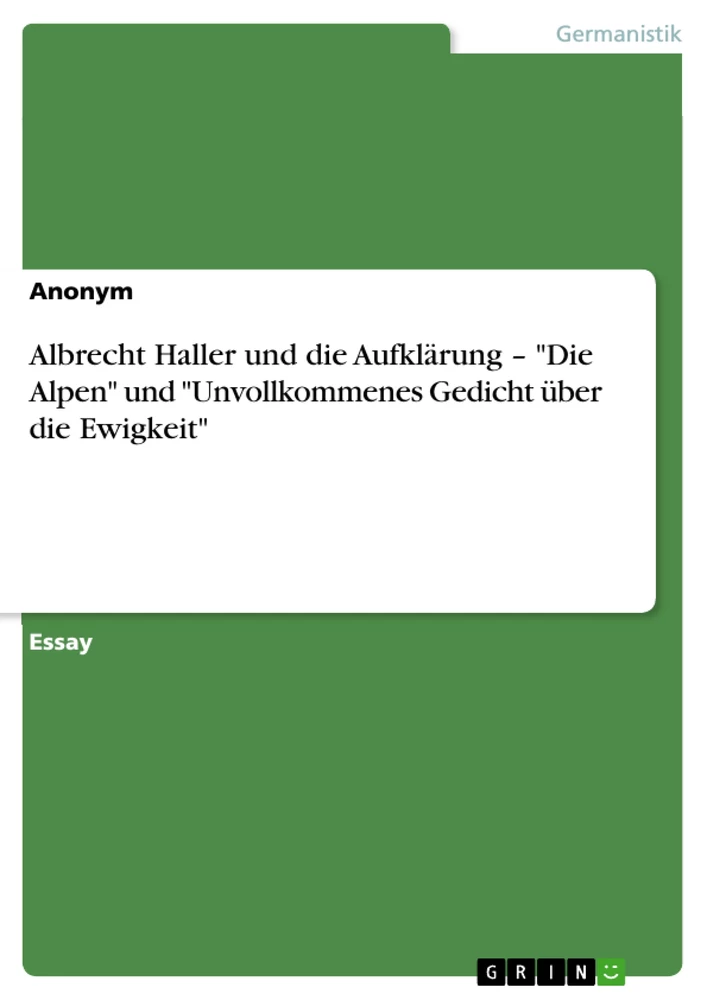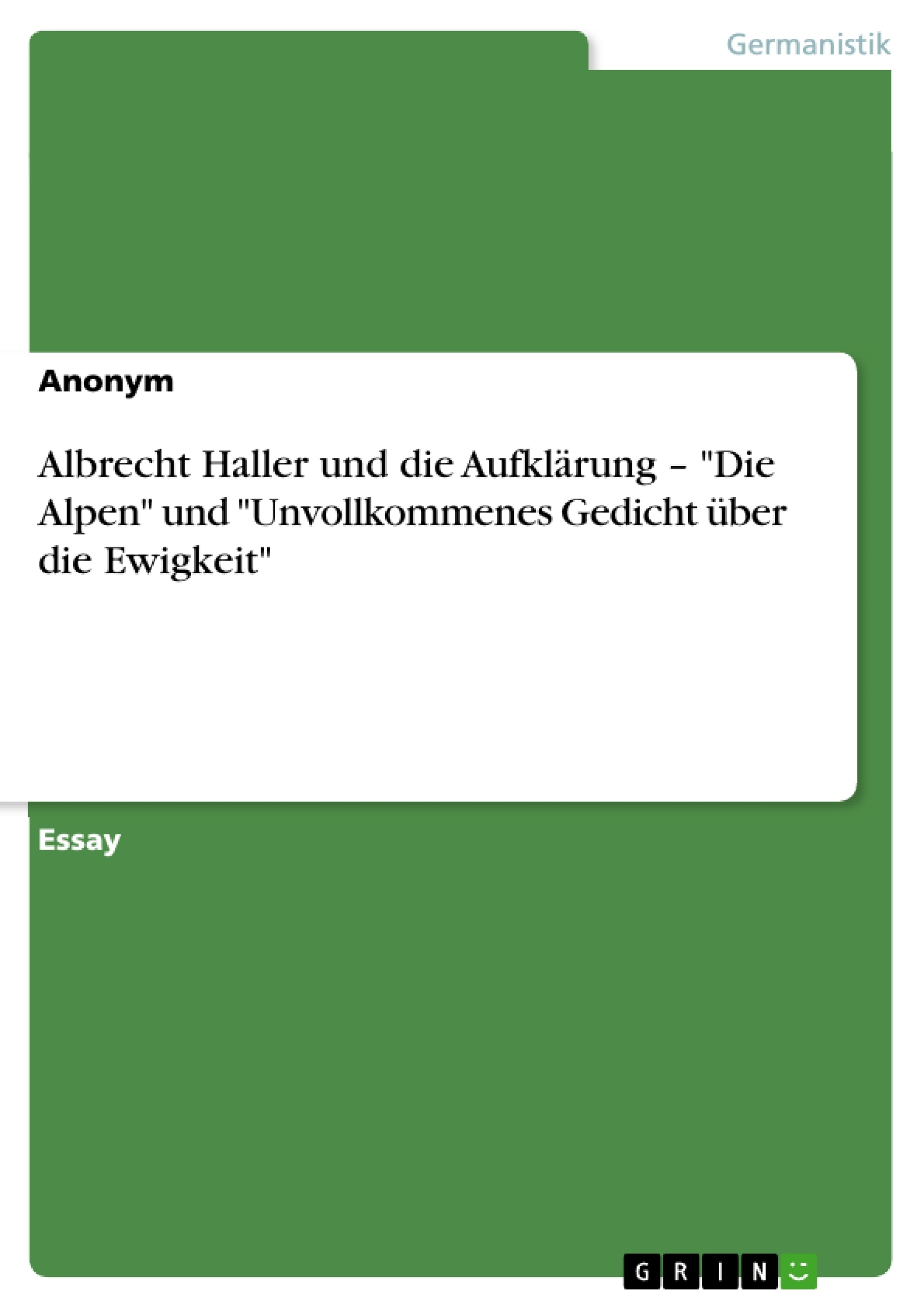Das folgende Essay widmet sich dem Berner Naturwissenschaftler und Schriftsteller ALBRECHT VON HALLER (1708-1777). Es verfolgt das Ziel, den aktuellen Forschungsstand zum Schweizer „Universalgelehrten“ (RÉMI 2010: 265) aufzuzeigen. Zunächst wird auf seine Biographie und die literarische Aufklärung allgemein eingegangen. Dem folgen eine Charakterisierung HALLERS berühmtesten Werkes Die Alpen, das in Bezug zu seiner Biographie und Epoche gesetzt wird. Daraufhin wird knapp auf Unvollkommenes Gedicht über die Ewigkeit eingegangen.
Albrecht Haller und die Aufklärung –
Die Alpen und Unvollkommenes Gedicht über die Ewigkeit
Das folgende Essaywidmet sich dem Berner Naturwissenschaftler und Schriftsteller Albrecht von Haller (1708-1777). Es verfolgt das Ziel, den aktuellen Forschungsstand zum Schweizer „Universalgelehrten“ (Rémi 2010: 265) aufzuzeigen.
Zunächst wird auf seine Biographie und die literarische Aufklärung allgemein eingegangen. Dem folgen eine Charakterisierung Hallers berühmtesten Werkes Die Alpen, das in Bezug zu seiner Biographie und Epoche gesetzt wird. Daraufhin wird knapp auf Unvollkommenes Gedicht über die Ewigkeit eingegangen. Abgerundet wird die Arbeit durch ein Fazit der erarbeiteten Ergebnisse.
Biographie
Albrecht von Haller wurde am 16.Oktober 1708 in Bern geboren. Von 1723-1727 studierte er Medizin und Naturwissenschaften in Tübingen. In den Jahren 1736-1753 hatte er eine Professur für Anatomie, Chirurgie und Botanik in Göttingen inne. In diesem Zeitraum wurde er von Kaiser Franz I. in den Adelsstand erhoben. Als reformierter Christ gründete er die evangelisch-reformierte Gemeinde an der Universität Göttingen und betreute den Bau der dort entstehenden Kirche. Bekannt wurde Haller v.a. als anatomischer Wissenschaftler (Präformationslehre)[1] und Begründer der modernen experimentellen Physiologie.[2] Literarische Berühmtheit erlangte er durch seine 1732 erschienene Gedichtsammlung Versuch Schweizerischer Gedichte, die bereits 1734 eine zweite Auflage erhielt. In diesem Gedichtband finden sich u.a . Die Alpen und Unvollkommenes Gedeicht über die Ewigkeit.Trotz des großen Erfolges seiner Gedichte machten Hallers literarische Werke lediglich einen kleinen Teil seines Schaffens aus (vgl. Rémi 2010: 266; so auch Mahlmann-Bauer/ Lütteken 2007).
1777 starb er nach längerer Krankheit in seiner Geburtsstadt Bern.
Abriss zur literarischen Aufklärung
Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit der Charakterisierung der literarischen Aufklärung. Ein Bezug zum Leben Hallers erfolgt hier nicht, da zunächst die zeitlichen Umstände an sich näher beleuchtet werden sollen.Hierbei wird keine erschöpfende Erörterung dieser Epoche, sondern lediglich eine Darstellung ihrer Grundzüge vorgenommen, was m.E. für den vorliegenden Kontext ausreichend ist.[3]
Als Voraussetzung der literarischen Aufklärung gilt nach Baasnerdie Aufwertung der deutschen Sprache bei gleichzeitiger Reduktion der Bedeutung der lateinischen Sprache in der Gelehrtenwelt (vgl. Baasner 2006: 62). Unter anderem Leibniz und Thomasius kritisierten die Hochachtung des Lateinischen. Zudem wurde die Gleichartigkeit der deutschen Kultur v.a. in Bezug auf die französische postuliert (vgl. ebd.). Allerdings geht Baasner davon aus, dass erst ab dem Sturm und Drang von einer „konkurrenzfähigen nationalen Literatursprache“ (ebd.: 64) gesprochen werden kann.
Prägend für die literarische Aufklärung war eine Verurteilung des barocken „Schwulstes“ (u.a. Gottsched[4], Triller[5] ) und somit auch der zweiten schlesischen Dichterschule, deren prominentestes Mitglied vonLohenstein(„lohensteinischer Schwulst“) war. An dessen Stelle traten „Forderungen nach Klarheit und Deutlichkeit, nach grammatischer Einfachheit und Anderes“ (ebd.: 70). Dadurch ist es möglich, dass Literatur sowohl nützlich als auch angenehm ist (Horaz, Gottsched: „prodesse et delectare“). Über den Aspekt der Nützlichkeit erhält sie u.a. einen didaktischen Auftrag, sodass Lehrgedichten und Fabeln, die meist durch ein moralisches Schwarz-weiß-Denken gekennzeichnet sind, zur Zeit der Aufklärung besondere Bedeutung zugemessen wurde (vgl. ebd.: 71).
Dass die Aufklärung als Epoche des Intellektualismus (Rationalismus, Empirismus, aber auch Sensualismus) und als Zeitalter des Lichts („Age ofEnlightenment“) verstanden wird, in der die Vernunft und die Freiheit des Subjekts als höchste Güter galten, wird als bekannt vorausgesetzt, sodass auf die geistesgeschichtlichen Hintergründe nicht weiter eingegangen wird. Daher soll die prägnante Zusammenfassung Proß´(Proß 2008: 421) genügen:
Die größte Leistung der Aufklärung liegt wohl darin, dass sie den Typus des modernen Intellektuellen geschaffen hat: eine Denkhaltung, die bereit ist, alle Gegenstände wahrzunehmen, ob sie sich den eigenen Wahrnehmungs- und Ordnungsrastern einfügen oder nicht; die versucht, alle Meinungen zu diskutieren, egal ob sie mit den eigenen Überzeugungen übereinstimmen oder nicht, und die sich darum bemüht, einmal den eigenen Standpunkt zu verlassen, um zu begreifen, wie es möglich ist, dass andere anders denken.
Die Alpen – Annäherung
Im folgenden Abschnitt soll erörtert werden, inwiefern sich die eben aufgeführten Charakteristika der literarischen Aufklärung bei Hallersumfangreichsten Gedicht Die Alpen wiederfinden.Es entstand 1729 und wurde zunächst anonym in der Gedichtsammlung Versuch schweizerischer Gedichte 1732 veröffentlicht wurde, besteht aus 49 Strophen mit jeweils zehn jambischen Alexandrinern (vgl. Deupmann 2009). Aufgrund seiner Rezeptionsgeschichte (vgl. unten) gilt es als Hallersbekanntestes literarisches Werk (vgl. Baasner: 132), was sich auch an der Anzahl der Neuauflagen zeigt: Der Gedichtband Versuch schweizerischer Gedichte erschien bis zu seinem Tod in elf Neuauflagen (vgl. Mahlmann-Bauer/Lütteken 2007). Ferner war Die Alpen das erste deutsche Werk, das ins Französische übersetzt wurde (vgl.Lafond-Kettlitz 2009: 940).
Die Forschungsliteratur hebt auf inhaltlicher Seite meist die Dichotomie von Stadt- und Landleben hervor (vgl. Deupmann; Hentschel 1998: 184; Proß: 440). LediglichMergenthaler betont in der gesichteten Literatur, dass – quantitativ betrachtet – nahezu ausschließlich die Darstellung der Alpen im Zentrum des Werkes steht (vgl. Mergenthaler 2004: 282). Nichtsdestotrotz ist mit beiden Forschungspositionen – unabhängig vom Zentrum des Gedichtes – sein Inhalt erfasst: die Darstellung der Alpen samt ihrer Bewohner und ihr Unterschied zu den Stadtbewohnern.
[...]
[1] Haller ging in seiner Präformationslehre davon aus, dass alle Körperteile zweckmäßig aufeinander abgestimmt sind. In dieser Ordnung der Natur meinte er, Gott erkennen zu können (vgl. Proß2008: 423f. 454). Daher waren für Haller Naturwissenschaften und Religion, genauer das Christentum, nicht diametral gegenübergestellt, sondern komplementär (vgl. Rémi 2010: 270). Aufgrund dieses Befundes lässt sich Haller als Physikotheologe charakterisieren.
[2] An vielen noch lebenden Tieren wies er durch Experimente bspw. die Differenzierung von Muskeln und Nerven nach (vgl. Pfeifer 2008: 115f.). Seine Ergebnisse publizierte er u.a. in Anfangsgründe der Physiologie des menschlichen Körpers (Haller 1759-1776).
[3] Für eine ausführliche Charakterisierung der Epoche sei auf die Deutsche Literaturgeschichte des Metzler-Verlages verwiesen.
[4] Gottsched, Johann Christoph: Versuch einer critischen Dichtkunst vor die Deutschen. In: Steinmetz, Horst (Hg.): Schriften zur Literatur. Stuttgart 1972.
[5] Triller, Daniel Wilhelm: Lobgedichte, auf den unsterblichen Poeten, Martin Opitz von Boberfeld. In: ders.: Martin Opitz von BoberfeldTeutsche Gedichte, in vier Bände abgetheilet, Von neuem sorgfältig übersehen, allenthalben fleißig ausgebessert, mit nöthigen Anmerkungen erläutert. Frankfurt am Main 1746.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2012, Albrecht Haller und die Aufklärung – "Die Alpen" und "Unvollkommenes Gedicht über die Ewigkeit", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/197584