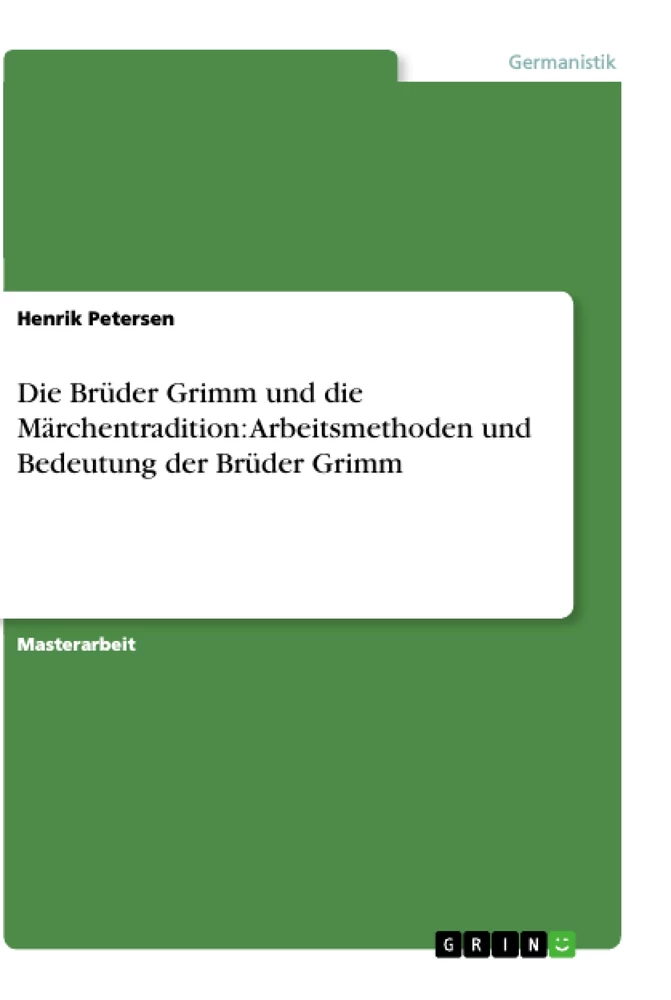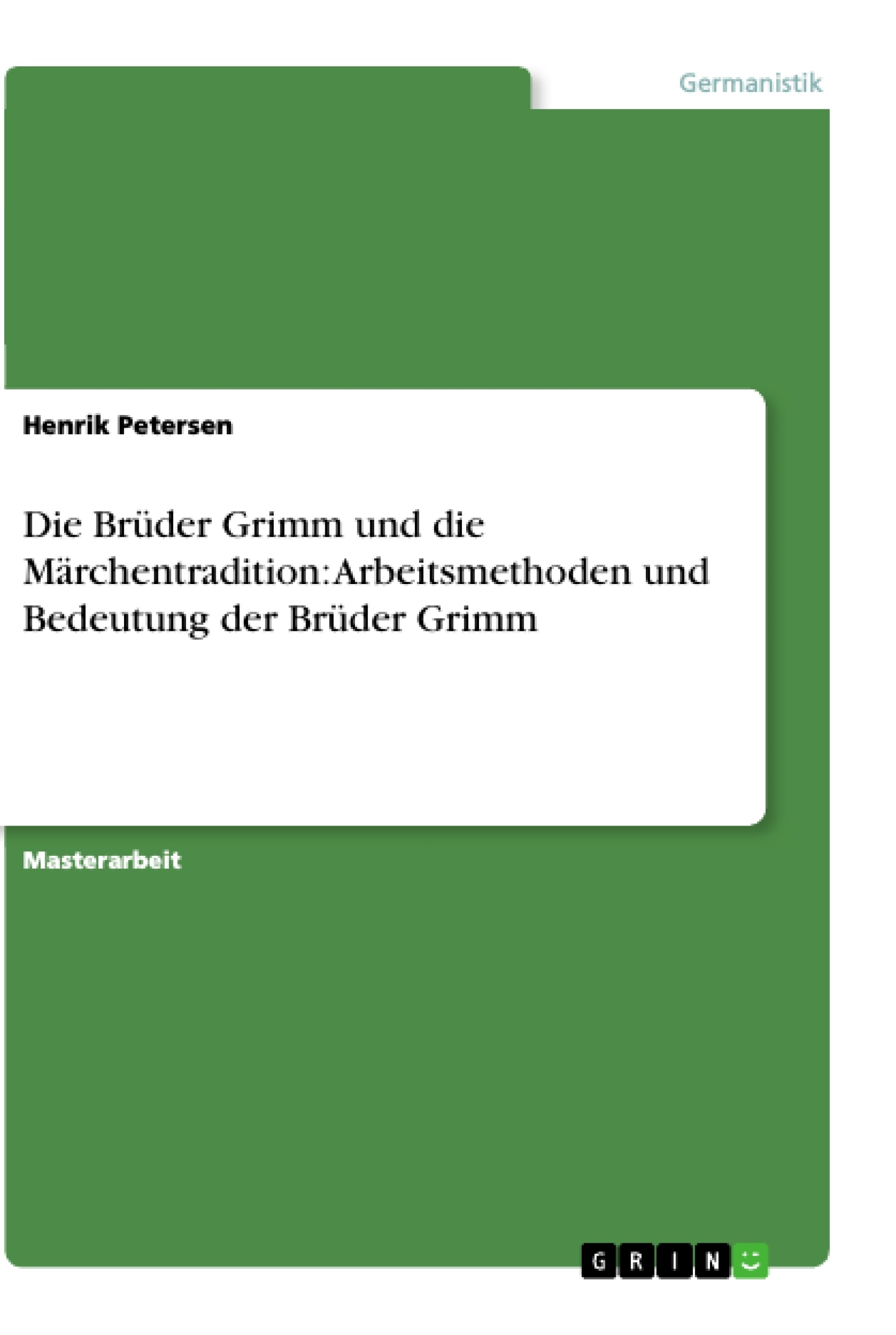Aus dieser Studie geht hervor, dass die offiziellen Behauptungen der Brüder Grimm zu ihrer Sammeltätigkeit und Vorgehensweisen in offensichtlichem Widerspruch zu ihren tatsächlichen Arbeitsmethoden stehen. Ein kritischer Blick auf Inhalt und Aufbau der Vorrede zu „Kinder- und Hausmärchen“ lässt bereits erahnen, dass die Grimms nicht die ganze Wahrheit erzählten, sondern lediglich Bruchstücke ihres großen Fachwissens vermittelten, die sich mit der romantischen Auffassung von einer sich im Absterben befindlichen deutschen Erzähltradition und den Forderungen des angehenden Biedermeiers deckten.
Das Ideal der Brüder Grimm bestand aus der romantischen Vorstellung einer reinen und unmittelbaren Volksdichtung, die sich seit einer zeitlich unbestimmbaren Vergangenheit unter einfachen und ungebildeten Menschen auf dem Lande erhalten hätte. Weil die Grimms ihre Märchen für ihre eigene Gegenwart vermittelten, spielte die romantische Trauer darüber, dass der naiv-kindliche Glückszustand inzwischen vergangen sei, für sie eine entscheidende Rolle. Dabei erkennt man ebenfalls bei den Brüdern Grimm die dem Romantiker auszeichnende wundersam herablassende Einstellung zur reinen Volksüberlieferung: Was ihnen fragmentarisch und unvollkommen vorkam, wurde ausgetauscht oder aus Fragmenten verschiedener Herkunft zu einer neuen Ganzheit zusammengeschrieben.
Die Brüder Grimm sind jedoch niemals – wie z.B. ihr dänischer Nachfolger Evald Tang Kristensen – Märchen sammelnd von Dorf zu Dorf gewandert. Entgegen ihrer eigenen Behauptungen erhielten sie die bekanntesten Stoffe nicht aus dem einfachen Volke, sondern aus dem frankophilen Bildungsbürgertum ihrer Heimatstadt Kassel oder von den Adelsfamilien Haxthausen und Droste-Hülshoff. Die verlorene Tradition, die sie bewahren wollten, mussten die Brüder Grimm daher zuerst selbst erschaffen. Durch ihren Einsatz ist auf diese Weise zwar eine unschätzbare deutsche Erzähltradition noch rechtzeitig schriftlich festgehalten worden; sowohl ihr Qualitätsanspruch als auch ihre literarischen Ambitionen bewirkten jedoch, dass das Unmittelbare der mündlichen Erzählungen, wie sie in ihrer Märchensammlung präsentiert wurden, für immer verloren ging.
Inhaltsverzeichnis
- Über die Arbeitsmethoden der Brüder Grimm bei der Ausarbeitung von Kinder- und Hausmärchen
- Ihre Rolle als Begründer des Mythos über das deutsche Volksmärchen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Arbeitsmethoden der Brüder Grimm bei der Sammlung und Bearbeitung von Kinder- und Hausmärchen und analysiert ihre Rolle bei der Konstruktion des Mythos vom deutschen Volksmärchen. Die Arbeit beleuchtet den Entstehungsprozess der Märchen und hinterfragt die gängige Vorstellung von den Grimms als bloße Aufzeichner traditionellen Volksguts.
- Arbeitsmethoden der Brüder Grimm
- Bearbeitungsprozesse der Märchen
- Konstruktion des Mythos "Deutsches Volksmärchen"
- Einfluss der Grimms auf die Märchenrezeption
- Verhältnis zwischen Original und Bearbeitung
Zusammenfassung der Kapitel
Über die Arbeitsmethoden der Brüder Grimm bei der Ausarbeitung von Kinder- und Hausmärchen: Dieses Kapitel analysiert detailliert die Arbeitsweise der Brüder Grimm, von der Sammlung der mündlich überlieferten Erzählungen bis hin zur schriftlichen Fixierung und Bearbeitung. Es beleuchtet die verschiedenen Quellen, die die Grimms nutzten, ihre Auswahlkriterien und die Veränderungen, die sie an den Erzählungen vorgenommen haben. Besonderes Augenmerk wird auf die Methoden der Bearbeitung gelegt, wie z.B. die Strukturierung, die Stilisierung und die Anpassung an die damalige Leserschaft. Die Analyse soll zeigen, dass die Grimms nicht einfach nur passiv Aufzeichner waren, sondern aktiv an der Gestaltung der Märchen beteiligt waren. Die verschiedenen Versionen einzelner Märchen werden verglichen, um den Umfang der Eingriffe der Grimms zu verdeutlichen. Der Einfluss der Romantik auf die Bearbeitung wird ebenfalls diskutiert.
Ihre Rolle als Begründer des Mythos über das deutsche Volksmärchen: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Brüder Grimm bei der Entstehung und Verbreitung des Mythos vom "deutschen Volksmärchen". Es analysiert, wie die Grimms durch ihre Auswahl, Bearbeitung und Präsentation der Märchen zum Bild eines nationalen, authentischen und traditionellen Erzählguts beitrugen. Die Arbeit beleuchtet die ideologische Funktion der Märchen im Kontext der deutschen Nationalbewegung und die Konstruktion eines nationalen Selbstverständnisses durch die Verknüpfung mit der Vorstellung eines unverfälschten, urchristlichen Volksgutes. Die Rezeption der Grimmschen Märchen und deren Einfluss auf spätere Interpretationen des deutschen Volksmärchens werden diskutiert, wobei der Fokus auf der Frage liegt, inwieweit die Grimms selbst zu der Legendenbildung um das "deutsche Volksmärchen" beigetragen haben.
Schlüsselwörter
Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen, Volksmärchen, Arbeitsmethoden, Bearbeitung, Mythos, deutsche Nationalbewegung, Mündliche Überlieferung, Romantik, Märchenforschung, Nation, Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: "Die Brüder Grimm und der Mythos vom deutschen Volksmärchen"
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Arbeitsmethoden der Brüder Grimm bei der Sammlung und Bearbeitung ihrer Kinder- und Hausmärchen und analysiert deren Rolle bei der Konstruktion des Mythos vom deutschen Volksmärchen. Sie hinterfragt die gängige Vorstellung der Grimms als bloße Aufzeichner traditionellen Volksguts und beleuchtet den aktiven Gestaltungsprozess der Märchen durch die Brüder Grimm.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Arbeitsmethoden der Brüder Grimm, die Bearbeitungsprozesse der Märchen, die Konstruktion des Mythos "Deutsches Volksmärchen", den Einfluss der Grimms auf die Märchenrezeption und das Verhältnis zwischen Original und Bearbeitung. Dabei werden die verschiedenen Quellen, Auswahlkriterien und Veränderungen der Erzählungen analysiert, sowie der Einfluss der Romantik auf die Bearbeitung der Märchen diskutiert.
Wie werden die Arbeitsmethoden der Brüder Grimm untersucht?
Das Kapitel zu den Arbeitsmethoden der Brüder Grimm analysiert detailliert ihren Weg von der Sammlung mündlich überlieferter Erzählungen bis zur schriftlichen Fixierung und Bearbeitung. Es beleuchtet die genutzten Quellen, die Auswahlkriterien und die vorgenommenen Veränderungen an den Erzählungen. Besonderes Augenmerk liegt auf Methoden wie Strukturierung, Stilisierung und Anpassung an die damalige Leserschaft. Verschiedene Versionen einzelner Märchen werden verglichen, um den Umfang der Eingriffe der Grimms zu verdeutlichen.
Welche Rolle spielten die Brüder Grimm bei der Entstehung des Mythos vom "deutschen Volksmärchen"?
Das Kapitel zur Rolle der Brüder Grimm beim Mythos vom "deutschen Volksmärchen" untersucht, wie sie durch Auswahl, Bearbeitung und Präsentation der Märchen zum Bild eines nationalen, authentischen und traditionellen Erzählguts beitrugen. Es beleuchtet die ideologische Funktion der Märchen im Kontext der deutschen Nationalbewegung und die Konstruktion eines nationalen Selbstverständnisses. Die Rezeption der Grimmschen Märchen und deren Einfluss auf spätere Interpretationen werden diskutiert, mit Fokus auf den Beitrag der Grimms zur Legendenbildung um das "deutsche Volksmärchen".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst zwei Hauptkapitel: "Über die Arbeitsmethoden der Brüder Grimm bei der Ausarbeitung von Kinder- und Hausmärchen" und "Ihre Rolle als Begründer des Mythos über das deutsche Volksmärchen". Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen, Volksmärchen, Arbeitsmethoden, Bearbeitung, Mythos, deutsche Nationalbewegung, Mündliche Überlieferung, Romantik, Märchenforschung, Nation, Identität.
- Quote paper
- Henrik Petersen (Author), 2012, Die Brüder Grimm und die Märchentradition: Arbeitsmethoden und Bedeutung der Brüder Grimm, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/197124