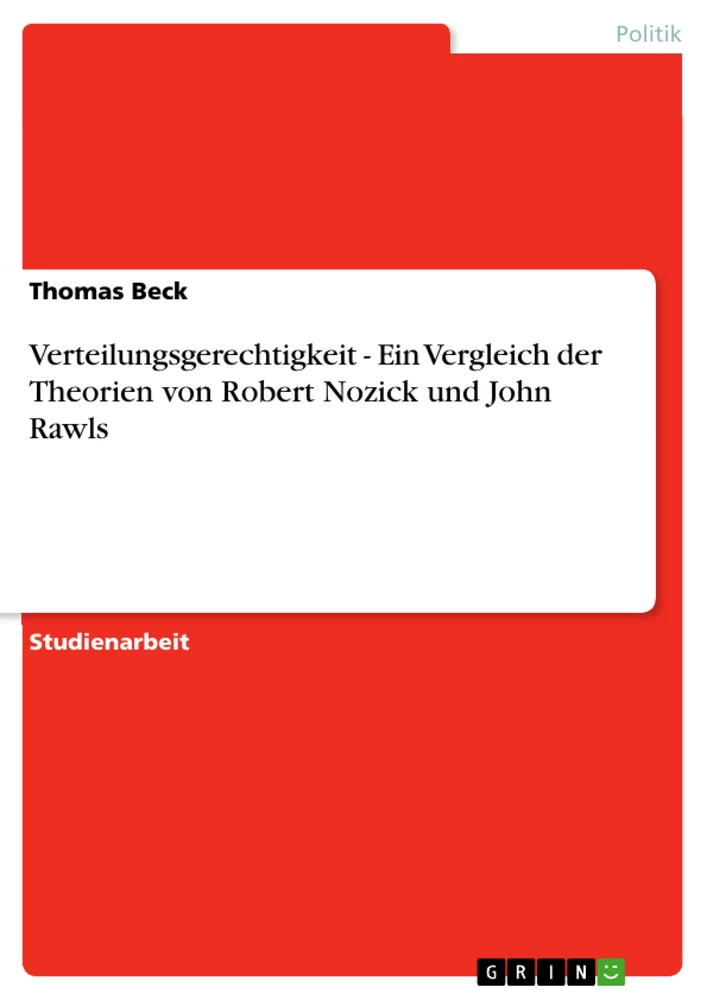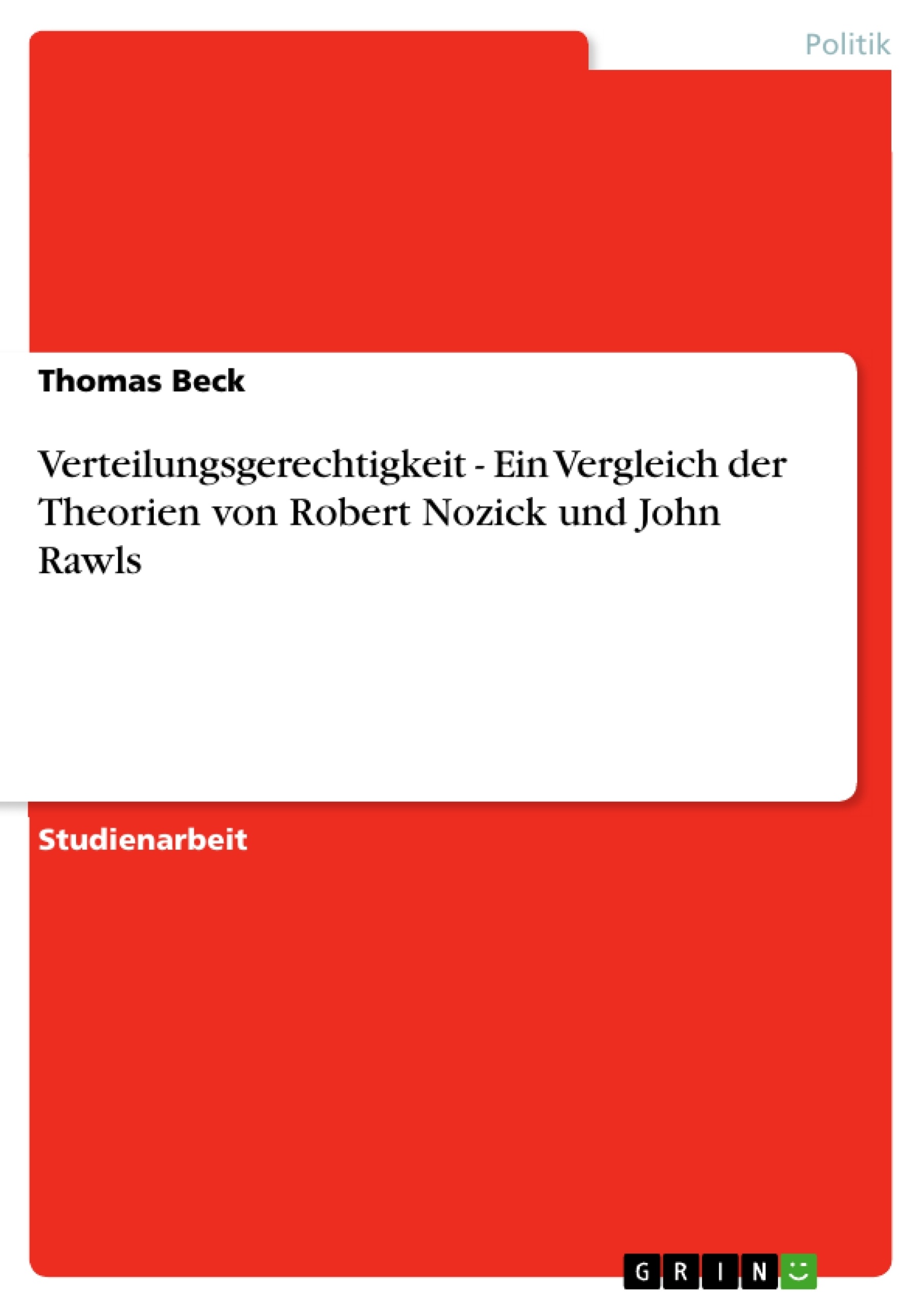Die Geschichte der Gerechtigkeit ist alt. Vielleicht genau so alt, wie die der Menschheit selbst. Als Bewertungsmaßstab für eine gesellschaftliche und damit politische Ordnung trat der Begriff erstmals nennenswert in der griechischen Mythologie in Erscheinung. Der übermächtige Zeus war es, der dort einst den olympischen Naturzustand, den von Fehden und Freveln geprägten Alltag seiner Ahnen, überwinden konnte und mittels machtvoll durchgesetzter Gerechtigkeit erstmals Frieden im Olymp schuf. Mit der Reflexion solcher mythologischen Vorstellungen durch antike Philosophen und dem partiellen Einfluss der griechischen Mythologien auf die gesellschaftlichen und politischen Ordnungsvorstellungen ihrer Zeit entstand zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit auch ein philosophischer Diskurs, der Gerechtigkeit als Maßstab, als Ideal und Leitprinzip einer Ordnung begriff, indem er Kriterien aufzuzählen versuchte mit denen gerechte von ungerechten politischen Ordnungen unterschieden werden konnten.
Die Reflexion des Politischen (‚episteme politike´), d.h. des Ideals guten und gerechten politischen Handelns war geboren und setze seinen Siegeszug durch das Mittelalter über die Neuzeit bis tief in die Moderne hinein fort, wo die Frage der Gerechtigkeit zum universalen Wertmaßstab westlicher Staatsphilosophien wurde. „Die Gerechtigkeit ist einer der angesehensten Begriffe unserer geistigen Welt. Ob Gläubiger oder Ungläubiger, Konservativer oder Revolutionär, jeder beruft sich auf die Gerechtigkeit und niemand wagt, sie zu verleugnen. (...) Man ruft sie an, um die bestehende Ordnung zu schützen und um revolutionäre Umstürze zu rechtfertigen. So verstanden ist die Gerechtigkeit ein universaler Wert“ , erklärt der Philosoph und Universitätsprofessor Chaim Perelman in seiner philosophischen Abhandlung über den Geltungsbereich der Gerechtigkeit.
Inhaltsverzeichnis
- Begriffstheoretische Einführung
- Gerechtigkeit
- Verteilungsgerechtigkeit
- 1. John Rawls und die Theorie der Gerechtigkeit
- 1.1 Gerechtigkeitstheoretischer Kontraktualismus
- 1.2 Naturzustand und Schleier des Nichtwissens
- 1.3 Gleichheit und Ungleichheit – Zwei Gerechtigkeitsprinzipien
- 1.4 Nachträgliche Korrektur der Vermögensverteilung
- 2. Robert Nozick und die Anspruchstheorie
- 2.1 Theorieprämissen und Legitimationsgrundlage des Staates
- 2.1.1 Überwindung des Naturzustandes
- 2.1.2 Von der Schutzgemeinschaft zum Minimalstaat
- 2.2 Ein historisches Anrecht auf Eigentum - Nozicks Antwort auf die Frage der Verteilungsgerechtigkeit
- 2.3 Umverteilung im Nachtwächterstaat
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Frage der Verteilungsgerechtigkeit und stellt dazu die Theorien von Robert Nozick und John Rawls einander gegenüber. Ziel ist es, die unterschiedlichen Standpunkte der beiden Philosophen zu beleuchten und ihre Konzepte hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit auf die moderne Gesellschaft zu bewerten.
- Gerechtigkeitsprinzipien in modernen Gesellschaften
- Theorien der Verteilungsgerechtigkeit
- Das Verhältnis von Freiheit und Gleichheit
- Der Einfluss von Eigentum auf die gesellschaftliche Ordnung
- Legitimität von Umverteilung
Zusammenfassung der Kapitel
Begriffstheoretische Einführung
Das erste Kapitel führt in die Konzepte von Gerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit ein. Es werden die historischen Wurzeln des Begriffs Gerechtigkeit und die verschiedenen Arten von Gerechtigkeit betrachtet, darunter kommutative, distributive und legale Gerechtigkeit. Die Diskussion führt zur Frage, wie die Verteilung materieller Güter in einer Gesellschaft gerecht geregelt werden kann.
1. John Rawls und die Theorie der Gerechtigkeit
Das zweite Kapitel behandelt John Rawls' Theorie der Gerechtigkeit, die auf dem Prinzip des Kontraktualismus basiert. Rawls argumentiert, dass die Gerechtigkeitsgrundsätze einer Gesellschaft aus einem Urzustand abgeleitet werden sollten, in dem die Individuen hinter einem Schleier des Nichtwissens über ihre eigenen Fähigkeiten und Lebensumstände stehen. Dieses Konzept führt zu zwei Gerechtigkeitsprinzipien: das Prinzip der Freiheit und das Prinzip der Differenz.
2. Robert Nozick und die Anspruchstheorie
Im dritten Kapitel wird Robert Nozicks Anspruchstheorie der Gerechtigkeit vorgestellt. Nozick argumentiert, dass eine Verteilung von Gütern dann gerecht ist, wenn sie aus einer ursprünglichen gerechten Verteilung hervorgegangen ist und durch freiwillige Transaktionen zustande gekommen ist. Er lehnt staatliche Umverteilung ab und plädiert für einen Minimalstaat.
Schlüsselwörter
Verteilungsgerechtigkeit, Gerechtigkeitstheorien, Kontraktualismus, Anspruchstheorie, Naturzustand, Schleier des Nichtwissens, Freiheit, Gleichheit, Eigentum, Umverteilung, Minimalstaat, John Rawls, Robert Nozick.
- Quote paper
- Thomas Beck (Author), 2010, Verteilungsgerechtigkeit - Ein Vergleich der Theorien von Robert Nozick und John Rawls, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/196348