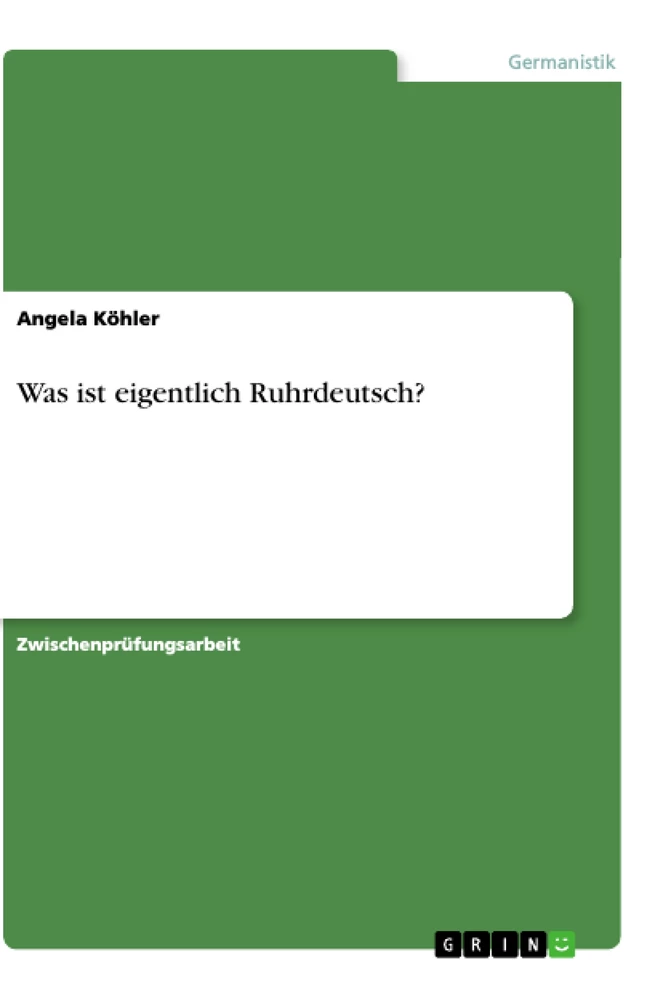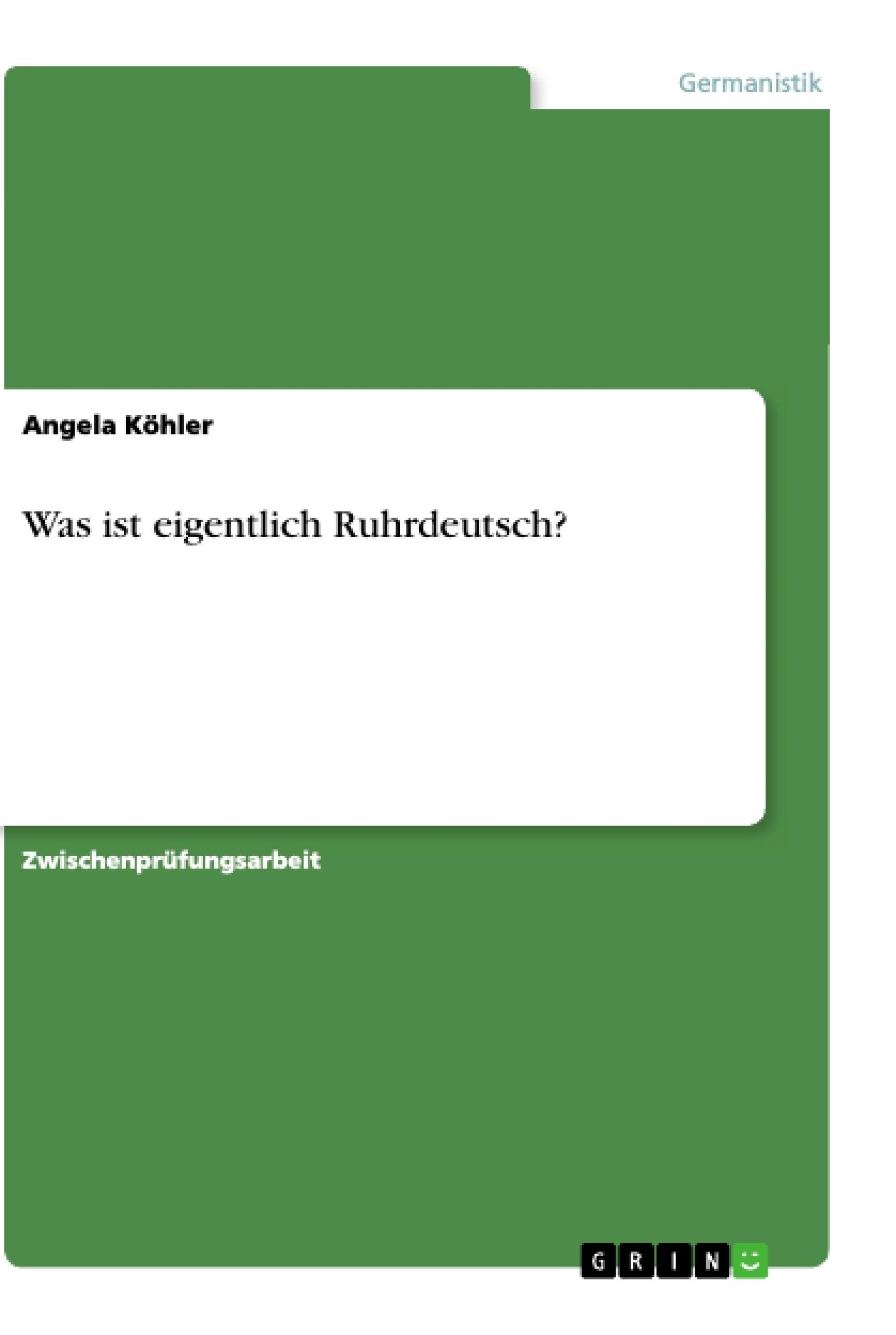“Hömma, wat is aintlich Ruhrdeutsch?” würde ein Sprecher der Sprache an der
Ruhr den Titel dieser Arbeit aussprechen. Dass dieser Satz so anders als die hochdeutsche
Fassung klingt, sollte schnell auffallen. Jedoch wurde das Ruhrdeutsch in
der Linguistik trotzdem lange Zeit vernachlässigt und hat es “bis heute schwer, als
eigenständige Varietät wissenschaftlich anerkannt”1 (Die Zitate in dieser Arbeit sind
nach der alten Rechtschreibregelung verfasst, der Text jedoch nach neuer Regelung,
A.K.) zu werden. So schreibt Menge 1977 noch: “Linguistisch gesehen ist das
Ruhrgebiet noch kaum erforscht.”2 Der Sprachwissenschaftler Udo Thies stellt sogar
noch in einem Aufsatz von 1985 fest, dass das Ruhrgebiet bei früheren linguistischen
Untersuchungen als “weißer Fleck”3 erscheint. Der Grund für diese Vernachlässigung
der jungen Varietät Ruhrdeutsch ist darin zu sehen, dass sich die Sprachforscher viel
mehr mit dem Sammeln alter Dialekte beschäftigten, weil sie befürchteten, dass diese
aussterben würden, bevor sie sie beschreiben konnten.
Immerhin nahmen sich in den letzten rund 15 Jahren schon mehr Wissenschaftler
des Ruhrdeutschen an als in der ganzen Zeit zuvor: “Erst in letzter Zeit scheint das
Interesse zu wachsen, wobei allerdings zu beobachten ist, daß der Akzent weniger auf
der Sprachbeschreibung [...]”4, liegt. Der Grund der Zuwendung zum Ruhrdeutschen
könnte
“sich vor allem aus einer veränderten Einstellung zur lokalen und regionalen
Geschichte - einschließlich der Geschichte der Sprache, die für die Menschen dieser
Region von großer Bedeutung ist [ergeben, A.K.].”5 [...]
1 Volmert, Johannes 1990: Jugend und Ruhrgebietssprache. Die regionale Varietät in der Freizeit -
und als Unterrichtsgegenstand? In: Ehlich, Konrad/Noltenius, Rainer (Hg.):Sprache und Literatur im
Ruhrgebiet 1993, Essen, S. 1
2 Menge, Heinz 1977: Regionalsprache Ruhr: Grammatische Variation ist niederdeutsches Substrat.
In: Mihm, Arend (Hg.) 1985: Sprache an Rhein und Ruhr, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, S. 194
3 Thies, Udo 1985: Die gesprochene Sprache im Ruhrgebiet - eine “Monovarietät”? Korpus und
Analysebeschreibung des Bochumer Projekts. In: Mihm, Arend (Hg.) 1985: Sprache an Rhein und
Ruhr, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, S. 108
4 Menge 1977, S. 195
5 Volmert 1990, S. 14
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Die vernachlässigte Varietät des Ruhrgebietes
- 2. Ruhrdeutsch: Regionale Umgangssprache oder Dialekt?
- 2.1. Standardsprache, Regionale Umgangssprache und Dialekt
- 2.2. Die Einordnung des Ruhrdeutschen
- 3. Besondere Merkmale des Ruhrdeutschen
- 3.1. Phonetik und Phonologie
- 3.2. Lexik
- 3.2.1. Einflüsse auf die Lexik des Ruhrdeutschen
- 3.2.1.1. Einflüsse des Niederdeutschen
- 3.2.1.2. Einflüsse der Bergmannssprache
- 3.2.1.3. Einflüsse des Polnischen (und Jiddischen)
- 3.2.2. Die Anschaulichkeit ruhrdeutscher Wörter
- 3.2.1. Einflüsse auf die Lexik des Ruhrdeutschen
- 3.3. Phraseologie
- 3.4. Morphologie und Syntax
- 3.4.1. Morphologische Besonderheiten
- 3.4.2. Syntaktische Besonderheiten
- 4. Das Ruhrdeutsch in der öffentlichen Darstellung
- 4.1. Kumpel Anton
- 4.2. Dr. Antonia Cervinski-Querenburg
- 4.3. Adolf Tegtmeier
- 5. Welche Zukunft hat das Ruhrdeutsch? Ausblick und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Sprachvarietät „Ruhrdeutsch“ und beleuchtet deren linguistische Einordnung sowie besondere Merkmale. Ziel ist es, einen Überblick über den Forschungsstand und die Charakteristika dieser oft vernachlässigten Sprachform zu geben.
- Linguistische Einordnung des Ruhrdeutschen (Dialekt vs. regionale Umgangssprache)
- Besondere phonetische, phonologische, lexikalische, phraseologische, morphologische und syntaktische Merkmale
- Einflüsse verschiedener Sprachen auf das Ruhrdeutsch
- Darstellung des Ruhrdeutschen in der Öffentlichkeit und Literatur
- Zukunftsaussichten des Ruhrdeutschen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die vernachlässigte Varietät des Ruhrgebietes: Die Einleitung stellt die lange Vernachlässigung des Ruhrdeutschen in der Linguistik fest und begründet dies mit dem Fokus der Sprachforschung auf dem Erhalt alter Dialekte. Sie hebt den wachsenden, aber noch unzureichenden Forschungsstand hervor und problematisiert die ungenaue Eingrenzung des Ruhrgebietes als Sprachraum. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf die terminologische Einordnung, die Beschreibung besonderer Merkmale und die Darstellung des Ruhrdeutschen in der Öffentlichkeit konzentriert, bevor ein Ausblick auf die Zukunftsperspektiven folgt.
2. Ruhrdeutsch: Regionale Umgangssprache oder Dialekt?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Schwierigkeit, das Ruhrdeutsch eindeutig als Dialekt oder regionale Umgangssprache zu klassifizieren. Es differenziert zwischen Standardsprache, regionaler Umgangssprache und Dialekt und untersucht die Position des Ruhrdeutschen in diesem System. Die Problematik einer eindeutigen Zuordnung wird hervorgehoben, da das Ruhrdeutsch Merkmale beider Kategorien aufweist und die Grenzen fließend sind.
3. Besondere Merkmale des Ruhrdeutschen: Der Hauptteil der Arbeit beschreibt die spezifischen Merkmale des Ruhrdeutschen. Es werden Besonderheiten in der Phonetik und Phonologie, der Lexik (inklusive der Einflüsse des Niederdeutschen, der Bergmannssprache und des Polnischen), der Phraseologie sowie der Morphologie und Syntax detailliert dargestellt und anhand von Beispielen illustriert. Der Abschnitt betont die sprachliche Vielfalt und die komplexen Einflüsse, die das Ruhrdeutsch prägen.
4. Das Ruhrdeutsch in der öffentlichen Darstellung: Dieses Kapitel widmet sich der Darstellung des Ruhrdeutschen in der Öffentlichkeit und Literatur. Anhand von Beispielen aus verschiedenen literarischen Werken wird die Vielfältigkeit der Ruhrdeutsch-Darstellung gezeigt, was die Bedeutung der Sprache für die regionale Identität und die kulturelle Vielfalt hervorhebt. Die ausgewählten Beispiele verdeutlichen verschiedene Aspekte und Facetten der Sprache im öffentlichen Diskurs.
Schlüsselwörter
Ruhrdeutsch, Regionale Umgangssprache, Dialekt, Sprachvarietät, Phonetik, Phonologie, Lexik, Phraseologie, Morphologie, Syntax, Niederdeutsch, Bergmannssprache, Polnisch, Jiddisch, Sprachraum, Ruhrgebiet, Linguistik, Dialektologie, regionale Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Ruhrdeutsch: Eine linguistische Untersuchung"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Sprachvarietät „Ruhrdeutsch“ umfassend. Sie beleuchtet die linguistische Einordnung des Ruhrdeutschen, beschreibt seine besonderen Merkmale und analysiert seine Darstellung in der Öffentlichkeit und Literatur. Ein Ausblick auf die Zukunftsperspektiven des Ruhrdeutschen rundet die Arbeit ab.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, linguistische Einordnung des Ruhrdeutschen, Beschreibung besonderer Merkmale (Phonetik, Phonologie, Lexik, Phraseologie, Morphologie, Syntax), Darstellung des Ruhrdeutschen in der Öffentlichkeit und Literatur, sowie Ausblick und Fazit. Jedes Kapitel wird durch eine Zusammenfassung begleitet, um den Lesefluss zu erleichtern.
Wie wird das Ruhrdeutsch linguistisch eingeordnet?
Die Arbeit diskutiert die schwierige Einordnung des Ruhrdeutschen als Dialekt oder regionale Umgangssprache. Sie differenziert zwischen Standardsprache, regionaler Umgangssprache und Dialekt und untersucht die Position des Ruhrdeutschen innerhalb dieses Systems. Aufgrund seiner Merkmale beider Kategorien ist eine eindeutige Zuordnung problematisch.
Welche besonderen Merkmale des Ruhrdeutschen werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt detailliert die phonetischen, phonologischen, lexikalischen, phraseologischen, morphologischen und syntaktischen Besonderheiten des Ruhrdeutschen. Dabei werden auch die Einflüsse des Niederdeutschen, der Bergmannssprache und des Polnischen (sowie des Jiddischen) auf die Lexik des Ruhrdeutschen beleuchtet und anhand von Beispielen illustriert.
Wie wird das Ruhrdeutsch in der Öffentlichkeit dargestellt?
Das vierte Kapitel analysiert die Darstellung des Ruhrdeutschen in der Öffentlichkeit und Literatur. Anhand von Beispielen (u.a. Kumpel Anton, Dr. Antonia Cervinski-Querenburg, Adolf Tegtmeier) wird die Vielfältigkeit der Ruhrdeutsch-Darstellung und deren Bedeutung für die regionale Identität gezeigt. Die ausgewählten Beispiele verdeutlichen verschiedene Aspekte und Facetten der Sprache im öffentlichen Diskurs.
Welche Zukunftsaussichten hat das Ruhrdeutsch?
Das fünfte Kapitel gibt einen Ausblick auf die Zukunftsperspektiven des Ruhrdeutschen. Es wird die Bedeutung dieser oft vernachlässigten Sprachform für die regionale Identität betont und möglicherweise auch Herausforderungen für seinen Erhalt angesprochen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ruhrdeutsch, Regionale Umgangssprache, Dialekt, Sprachvarietät, Phonetik, Phonologie, Lexik, Phraseologie, Morphologie, Syntax, Niederdeutsch, Bergmannssprache, Polnisch, Jiddisch, Sprachraum, Ruhrgebiet, Linguistik, Dialektologie, regionale Identität.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an alle, die sich für das Ruhrdeutsch, Linguistik und regionale Sprachvarietäten interessieren. Sie ist besonders relevant für Studierende der Linguistik, Dialektologie und Germanistik sowie für alle, die sich mit der sprachlichen Vielfalt des Ruhrgebietes auseinandersetzen möchten.
- Quote paper
- Angela Köhler (Author), 2003, Was ist eigentlich Ruhrdeutsch?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/19593