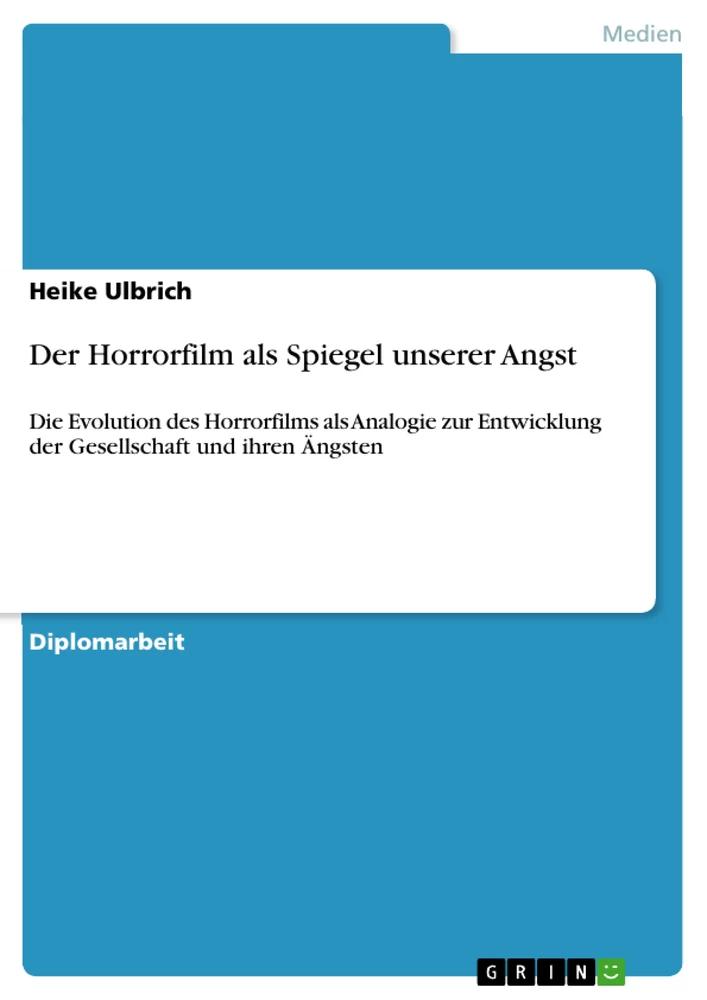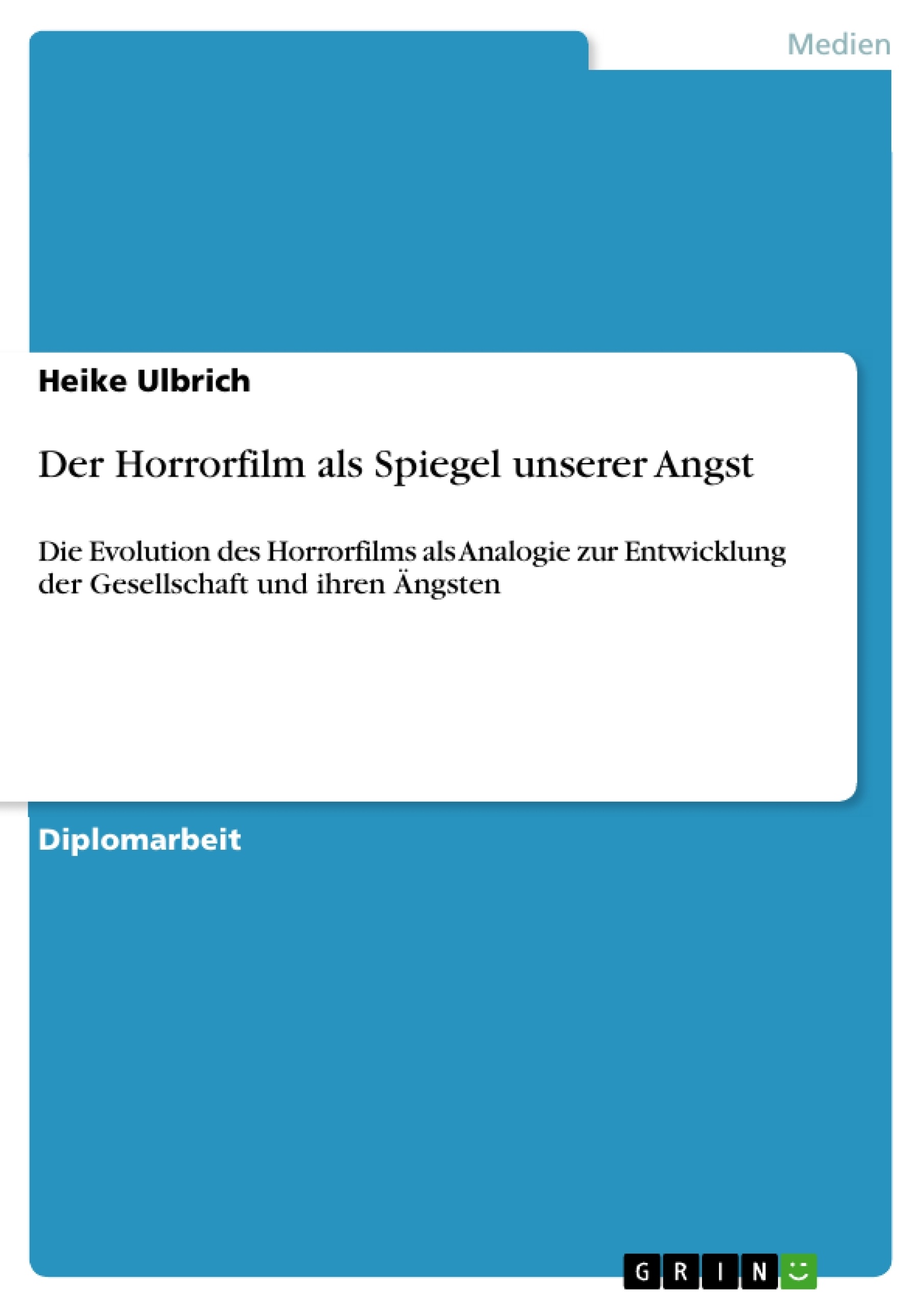Das Genre des Horrorfilms fasziniert. Nicht nur sein Fandom oder das Mainstream-Publikum, sondern vor allem auch seine Kritiker und Analytiker haben ein großes Interesse an diesem Kunstgenre. Für die Einen ist es gute Unterhaltung, für die Anderen schlechte Unterhaltung und für wieder Andere einfach nur die Gefährdung des jugendlichen Rezipienten. Doch was genau macht das Horrorgenre so faszinierend? Die grauenerregenden Geschichten und Gestalten bringen uns Zuschauer dazu, im Kinosessel zusammenzuzucken, vor Entsetzen zu erstarren oder unsere Hände schützend vor die Augen zu halten, obwohl wir doch auch gleichzeitig nur zu gern sehen wollen, was uns da so ängstigt. Es mag paradox erscheinen, dass etwas derart Unangenehmes wie Angst, Schauer, Schrecken oder Ekel etwas sehr viel Angenehmeres wie Unterhaltung erzeugen kann.
Die Zuschauer lassen sich gerade wegen der Ängste unterhalten, die der Horrorfilm in ihnen auslöst. Das Horrorgenre ist untrennbar mit den Ängsten seines Publikums verbunden. Genau genommen versucht es gezielt, diese Emotion in uns zu evozieren. Der Horrorfilm sowie jedes andere Medium des fiktionalen Horrors lebt von diesen negativen Emotionen der Menschen. Sobald nichts mehr existiert, was uns Menschen ängstigen oder ekeln würde, wäre das Genre zu jenem Tod verdammt, den es eigentlich selbst so gern im Scheinwerferlicht zelebriert. Durch die Erzeugung der Emotionen führt uns das Horrorgenre diese Emotionen vor Augen. Betrachtet man die Entwicklung des Horrorfilms seit seinen Anfängen über die Jahrzehnte hinweg, so kommt die Vermutung auf, dass die modernen und aktuellen Werke mit anderen Ängsten arbeiten als es die klassischen Filme getan haben. Wenn wir uns heute Friedrich Wilhelm Murnaus
Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens von 1922 ansehen, können wir recht wenig Beängsti-
gendes entdecken, wohingegen uns ein Film wie Blair Witch Project (The Blair Witch Project, Daniel Myrick, Eduardo Sánchez, 1999) einen kalten Schauer über den Rücken jagt. Es ist also anzunehmen, dass der Horrorfilm sich nicht nur auf immer gleiche Weise der menschlichen Urängste bedient. In der Annahme, dass Filme im Allgemeinen die gesellschaftlichen Bedingungen ihrer Entstehungszeit behandeln und reflektieren, liegt es nicht fern, den Horrorfilm als Spiegel der vorwiegenden, durch diese Bedingungen geschaffenen Ängste zu sehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Horrorgenre
- 2.1 Terminologie und Definition von Horror
- 2.2 Einordnung in die Phantastik und Abgrenzung zu anderen Genres
- 2.3 Charakteristik des Horrorgenres
- Exkurs: Horror in anderen Medien
- 2.3.1 Das Unheimliche nach Sigmund Freud
- 2.3.2 Archetypen des Horrors
- 2.3.3 Klassifizierung der Motive des Horrors
- 2.3.3.1 Klassifizierung nach Lovecraft
- 2.3.3.2 Klassifizierung nach Armstrong
- 2.3.3.3 Klassifizierung nach McKee
- 2.3.3.4 Klassifizierung nach Seeßlen und Jung
- 2.3.3.5 Klassifizierung nach Baumann
- 2.3.4 Erzählweise des Horrors
- 2.3.5 Entwicklung des Horrorgenres
- 2.3.5.1 Gothischer und moderner Horror
- 2.3.5.2 Von der antiken Mythologie bis zum Horrorfilm
- 2.4 Der Horrorfilm
- 2.4.1 Subgenres des Horrorfilms
- 2.4.2 Ästhetik des Horrorfilms
- 2.4.2.1 Dramaturgie
- 2.4.2.2 Visuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- 2.4.2.3 Auditive Gestaltungsmöglichkeiten
- 2.4.3 Akzeptanz des Horrorfilms
- 2.4.3.1 Kritik am Horrorfilm
- 2.4.3.2 Zensur
- 3 Horror und Angst
- 3.1 Psychologie der Angst
- 3.1.1 Definition der Emotion Angst und Abgrenzung zu anderen Begriffen
- 3.1.2 Theorie der Angst nach Sigmund Freud
- 3.1.3 Merkmale der Angst
- 3.1.4 Weitere relevante Emotionen
- 3.2 Angsterleben durch Fiktion und Realität
- 3.3 Phänomen der Angstlust
- 3.4 Wie der Horrorfilm Angst schürt
- 3.4.1 Intention des Filmemachers
- 3.4.2 Durch das Dargestellte
- 3.4.3 Durch die Darstellung
- 3.4.4 Relevanz der Rezeptionssituation
- 3.1 Psychologie der Angst
- 4 Horror und Gesellschaft
- 4.1 Einfluss der gesellschaftlichen Situation auf das Horrorgenre
- 4.2 Einfluss des Horrorgenres auf die Gesellschaft
- 4.3 Die Gesellschaft im 20. Jahrhundert
- 5 Historische Entwicklung von Horrorfilm und Gesellschaft – Eine Parallelbetrachtung
- 5.1 Die klassische Periode – Zerrüttet von zwei Weltkriegen (1910 bis 1953)
- 5.1.1 Stummes Grauen in Deutschland (1913 bis 1927)
- 5.1.2 Stummes Grauen in den USA (1910 bis 1935)
- 5.1.3 Europäische Tonfilme (1927 bis 1953)
- 5.1.4 Horrorklassiker Hollywoods (1931 bis 1953)
- 5.2 Die experimentelle Periode – Die bipolare Welt (1954 bis 1969)
- 5.2.1 Der Horrorfilm in den USA
- 5.2.2 Der Horrorfilm in Europa
- 5.3 Die nihilistische Moderne – Die Konsumgesellschaft in der Depression (1970 bis 1979)
- 5.3.1 Der Horrorfilm in den USA
- 5.3.2 Der Horrorfilm in Europa
- 5.4 Die moderne Wirklichkeit – Die Leistungsgesellschaft und zerbrechende Familien (1980 bis 1989)
- 5.4.1 Der Horrorfilm in den USA
- 5.4.2 Der Horrorfilm in Europa
- 5.5 Die metaphysische Postmoderne – Globalisierung und Kommunikationsgesellschaft (1990 bis 1999)
- 5.6 Rebooten des Genres – Die Jahrtausendwende als Umbruchphase (2000 bis 2008)
- 5.7 Und was bringt die Zukunft?
- 5.1 Die klassische Periode – Zerrüttet von zwei Weltkriegen (1910 bis 1953)
- 6 Fazit
- 7 Anhang
- 7.1 Filmographie
- 7.2 Bibliographie und Sonstige Quellen
- 7.3 Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Parallelen zwischen der Entwicklung des Horrorfilms und der Entwicklung der Gesellschaft und ihren Ängsten. Die Arbeit zielt darauf ab, aufzuzeigen, inwiefern die Motive, Inhalte und Darstellungsweisen des filmischen Horrors als Analogien zu den gesellschaftlichen Ängsten verstanden werden können, die sich aus wirtschaftlichen, politischen und soziokulturellen Aspekten und Problemen ergeben.
- Die Evolution des Horrorgenres im 20. Jahrhundert
- Der Horrorfilm als Spiegel gesellschaftlicher Ängste
- Die Beziehung zwischen Angst, Horror und gesellschaftlichen Veränderungen
- Analyse der Ästhetik und Dramaturgie des Horrorfilms
- Die Akzeptanz und Kritik am Horrorfilm im gesellschaftlichen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie die Faszination des Horrorgenres und die Verbindung zwischen Horrorfilmen und den Ängsten des Publikums beleuchtet. Sie skizziert die Forschungsfrage, die sich mit den Parallelen zwischen der Entwicklung des Horrorfilms und der gesellschaftlichen Entwicklung auseinandersetzt und die Vorgehensweise der Arbeit erläutert. Der Fokus liegt auf dem Wirkungsdreieck von Horrorgenre, Angst und Gesellschaft.
2 Das Horrorgenre: Dieses Kapitel definiert und charakterisiert das Horrorgenre, insbesondere den Horrorfilm. Es behandelt die Terminologie, die Einordnung in die Phantastik und die Abgrenzung zu anderen Genres. Die Kapitel beleuchten die archetypischen Motive des Horrors, verschiedene Klassifikationen dieser Motive und die Entwicklung des Genres vom gothischen zum modernen Horror, inklusive einer Übersicht der Entwicklung des Horrors in verschiedenen Medien.
3 Horror und Angst: Dieses Kapitel erörtert die enge Verbindung zwischen Horror und Angst. Es beleuchtet die Psychologie der Angst, inklusive verschiedener Definitionen, Freuds Angsttheorie und Merkmale von Angst. Es werden weitere relevante Emotionen wie Ekel und Abscheu diskutiert, und es wird der Unterschied zwischen Angsterleben in der Fiktion und Realität beleuchtet. Schließlich wird das Phänomen der Angstlust und die Frage, wie Horrorfilme Angst schüren, detailliert behandelt.
4 Horror und Gesellschaft: Dieses Kapitel beschreibt die wechselseitige Beeinflussung von Gesellschaft und Horrorgenre. Es wird erläutert, wie gesellschaftliche Bedingungen den Horrorfilm beeinflussen und wie das Genre wiederum auf die Gesellschaft einwirken kann. Das Kapitel endet mit einer Betrachtung der wichtigsten gesellschaftlichen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts, die den Horrorfilm beeinflusst haben.
5 Historische Entwicklung von Horrorfilm und Gesellschaft – Eine Parallelbetrachtung: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert die historische Entwicklung des Horrorfilms parallel zur gesellschaftlichen Entwicklung, aufgeteilt in verschiedene Epochen. Für jede Epoche werden exemplarische Filme analysiert, um die These der Arbeit zu untermauern. Die Analyse umfasst die klassische Periode, die experimentelle Periode, die nihilistische Moderne, die moderne Wirklichkeit und die metaphysische Postmoderne, mit einem Ausblick auf die Zukunft des Genres.
Schlüsselwörter
Horrorfilm, Angst, Gesellschaft, Entwicklung, 20. Jahrhundert, Gotischer Horror, Moderner Horror, Psychologie, Ästhetik, Dramaturgie, Medien, Zensur, Gesellschaftliche Ängste, Konsumgesellschaft, Leistungsgesellschaft, Globalisierung, Terrorismus, Klimawandel, Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Horrorfilm und Gesellschaft
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Parallelen zwischen der Entwicklung des Horrorfilms und der Entwicklung der Gesellschaft im 20. Jahrhundert. Sie analysiert, wie Motive, Inhalte und Darstellungsweisen des Horrorfilms die gesellschaftlichen Ängste und Probleme jener Zeit widerspiegeln.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Evolution des Horrorgenres, den Horrorfilm als Spiegel gesellschaftlicher Ängste, die Beziehung zwischen Angst, Horror und gesellschaftlichen Veränderungen, eine Analyse der Ästhetik und Dramaturgie des Horrorfilms, sowie die Akzeptanz und Kritik am Horrorfilm im gesellschaftlichen Kontext. Besonders im Fokus steht die historische Entwicklung des Horrorfilms in verschiedenen Epochen des 20. Jahrhunderts und deren Parallelen zu den jeweiligen gesellschaftlichen Entwicklungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition und Charakterisierung des Horrorgenres, ein Kapitel zu Horror und Angst (Psychologie der Angst, Angstlust etc.), ein Kapitel zu Horror und Gesellschaft, ein zentrales Kapitel zur historischen Parallelbetrachtung von Horrorfilm und gesellschaftlicher Entwicklung (unterteilt in verschiedene Epochen des 20. Jahrhunderts), und abschließend ein Fazit. Zusätzlich enthält die Arbeit einen Anhang mit Filmografie, Bibliografie und Abbildungsverzeichnis.
Welche Epochen der Horrorfilmgeschichte werden untersucht?
Die historische Analyse umfasst die klassische Periode (1910-1953), die experimentelle Periode (1954-1969), die nihilistische Moderne (1970-1979), die moderne Wirklichkeit (1980-1989), die metaphysische Postmoderne (1990-1999), die Jahrtausendwende als Umbruchphase (2000-2008), sowie einen Ausblick auf die Zukunft des Genres. Innerhalb dieser Epochen werden sowohl der amerikanische als auch der europäische Horrorfilm betrachtet.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet eine analytische Methode, die die historische Entwicklung des Horrorfilms parallel zur gesellschaftlichen Entwicklung betrachtet. Exemplarische Filme werden analysiert, um die These der Arbeit – die Verbindung zwischen Horrorfilm und gesellschaftlichen Ängsten – zu untermauern. Die Analyse umfasst die Betrachtung der Ästhetik, Dramaturgie und Motive der Filme im Kontext der jeweiligen gesellschaftlichen Situation.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Horrorfilm, Angst, Gesellschaft, Entwicklung, 20. Jahrhundert, Gotischer Horror, Moderner Horror, Psychologie, Ästhetik, Dramaturgie, Medien, Zensur, Gesellschaftliche Ängste, Konsumgesellschaft, Leistungsgesellschaft, Globalisierung, Terrorismus, Klimawandel und Identität.
Wo finde ich weitere Informationen?
Der Anhang der Arbeit enthält eine detaillierte Filmografie, Bibliografie und ein Abbildungsverzeichnis, welche weitere Quellen und Informationen zum Thema bieten.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern können die Motive, Inhalte und Darstellungsweisen des filmischen Horrors als Analogien zu den gesellschaftlichen Ängsten verstanden werden, die sich aus wirtschaftlichen, politischen und soziokulturellen Aspekten und Problemen ergeben?
- Quote paper
- Heike Ulbrich (Author), 2007, Der Horrorfilm als Spiegel unserer Angst, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/195023