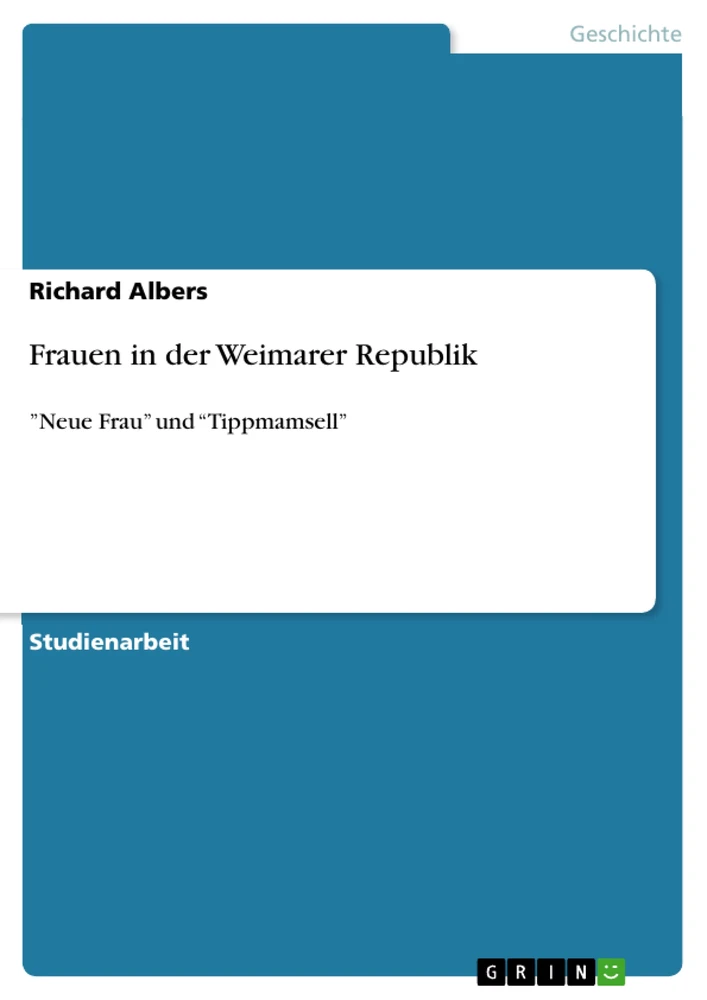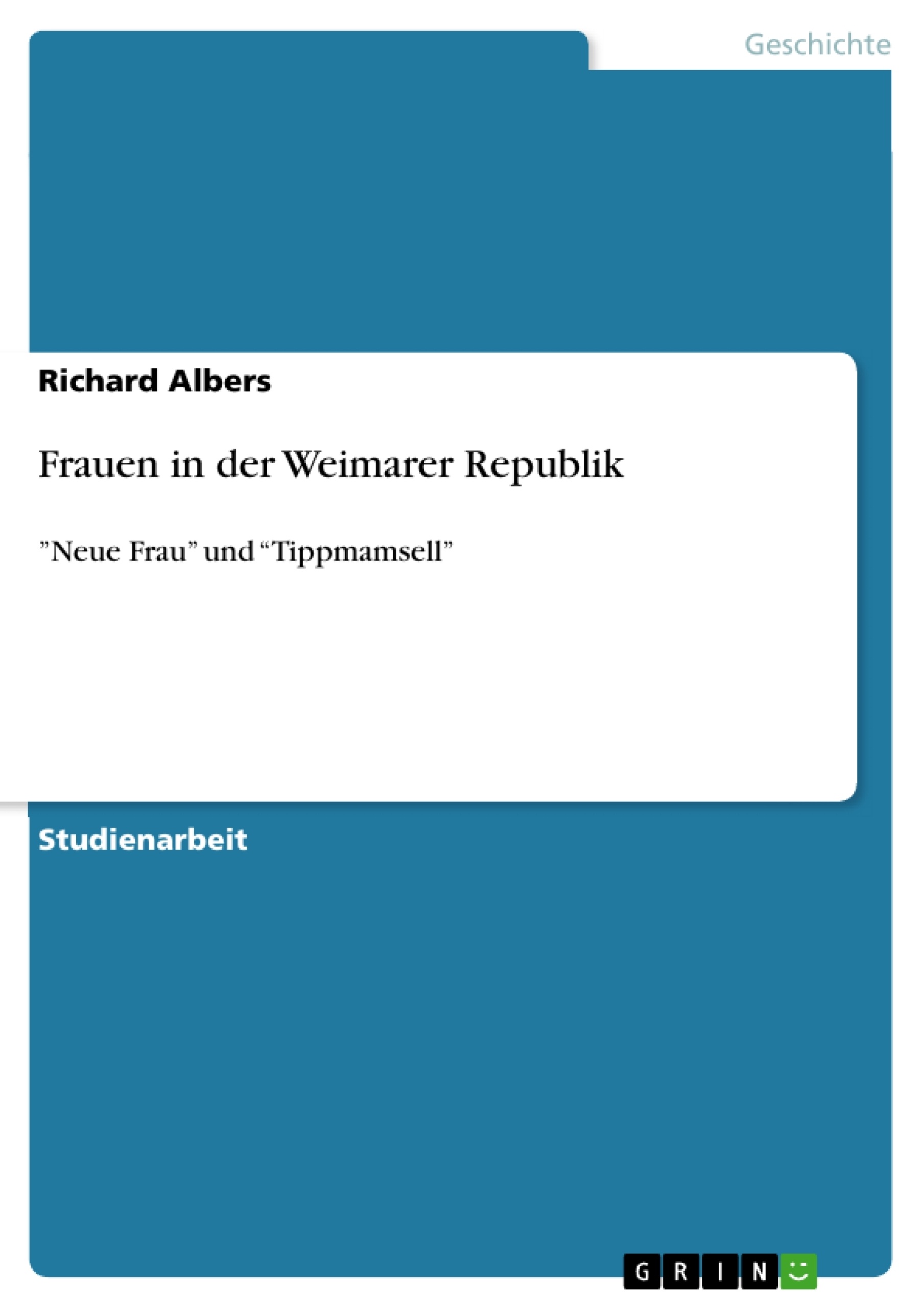Das Ende des Ersten Weltkriegs am 11. November 1918 bedeutete für Deutschland tiefgreifende politische, finanzielle und nicht zuletzt soziale Veränderungen.1 Der Kaiser ist in der Novemberrevolution gestürzt worden und Philipp Scheidemann rief die Deutsche Republik aus, deren erster Reichskanzler Friedrich Ebert wird. Der jungen demokratischen Republik wird mit dem Versailler Vertrag sodann direkt eine schwere Hypothek angelastet. Die vereinbarten Reparationszahlungen und die politischen Bestimmungen, die Kriegsschuldanerkennung und die internationale Gleichberechtigungsverweigerung im besonderen, führen zu einer politischen und wirtschaftlichen Krise, die Deutschland bis 1923 fest im Griff haben wird. Zwischen 1918 und 1923 kommt es zu zwei Putschversuchen der Rechten und des Militärs und einer massiven Geldentwertung, die 1923 in der Hyperinflation gipfelt. Mit Matthias Erzberger und Walter Rathenau wurden zwei Politiker Opfer rechtsradikaler Attentäter. 1919 wurde in Weimar bei der ersten Tagung der deutschen Nationalversammlung eine Verfassung verabschiedet, welche eine der fortschrittlichsten ihrer Zeit war und Wegbereiter einer liberalen Demokratie werden sollte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Veränderte Umstände nach dem Ersten Weltkrieg
- 3. Verschiedene "Frauentypen"?
- 4. "Neue Frauen" - Was macht sie aus?
- 4.1. Das Leben
- 4.1.1. Sport
- 4.1.2. Mode
- 4.1.3. Sexualität
- 4.2. Der Beruf
- 4.2.1. Beruf und Ehe
- 4.2.2. Die weibliche Angestellte
- 4.1. Das Leben
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die soziokulturellen Veränderungen in der Stellung der Frau in der Weimarer Republik. Sie analysiert die Entstehung des Konzepts der "Neuen Frau" und vergleicht das idealisierte Bild mit der Realität der Frauen in dieser Zeit. Die Arbeit konzentriert sich auf die Veränderungen im Leben und Beruf der Frauen, im Besonderen auf die Rolle der Frau als Angestellte.
- Veränderte gesellschaftliche Rolle der Frau nach dem Ersten Weltkrieg
- Entstehung und Charakterisierung des Typus der "Neuen Frau"
- Vergleich zwischen idealisiertem Bild und Realität der Lebenswirklichkeit von Frauen
- Einfluss von Mode, Sport und Sexualität auf das Selbstverständnis der Frauen
- Die "Neue Frau" im Beruf, insbesondere als Angestellte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg, geprägt von politischen und wirtschaftlichen Umbrüchen. Sie führt in das Thema der "Neuen Frau" ein und skizziert die Forschungsfragen der Arbeit. Die tiefgreifenden Veränderungen in Deutschland nach dem Krieg bilden den Ausgangspunkt für die Analyse der sich verändernden Rolle der Frau in der Gesellschaft. Die wirtschaftliche Krise und die politische Instabilität werden als Hintergrund für die soziokulturellen Entwicklungen dargestellt, die den Fokus der Arbeit bilden.
2. Veränderte Umstände nach dem Ersten Weltkrieg: Dieses Kapitel beleuchtet die Einführung des Frauenwahlrechts und die garantierte Gleichberechtigung in der Weimarer Verfassung. Es unterstreicht die bemerkenswerte Stellung Deutschlands in Europa in Bezug auf Frauenrechte und die hohe Wahlbeteiligung von Frauen. Weiterhin wird der Anstieg der weiblichen Erwerbstätigkeit und die Verschiebung der Arbeitsfelder in den tertiären Sektor detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf dem Aufstieg der Frau im Angestelltenbereich, insbesondere als "Tippmamsell" in Verbindung mit der technischen Entwicklung und Rationalisierung. Die zunehmende Akademisierung von Frauen wird ebenfalls erwähnt, wobei auf die einschränkenden Faktoren und die geringe Anzahl an Professorinnen hingewiesen wird.
3. Verschiedene "Frauentypen"? : Das Kapitel diskutiert die unterschiedlichen Vorstellungen von "Frauentypen" in den 1920er Jahren. Es analysiert den Artikel "Drei Frauen stehen heute vor uns", welcher die drei Typen "Gretchen", "Girl" und "Garçonne" unterscheidet und ihre Charakteristika beschreibt. Der traditionelle Typus "Gretchen" wird als konservativ und den alten Rollenmustern verhaftet dargestellt, im Gegensatz zu den modernen Typen "Girl" und "Garçonne". Die verschiedenen Charakterisierungen spiegeln die vielfältigen und sich wandelnden Vorstellungen von Weiblichkeit in der Gesellschaft wieder. Die Beschreibung des "Gretchen"-Typs als reaktionäre Faschistin deutet auf einen politischen Unterton hin, der die Entwicklungen der Zeit widerspiegelt.
4. "Neue Frauen" - Was macht sie aus?: Dieses Kapitel beleuchtet die Lebensweise und die berufliche Tätigkeit der "Neuen Frauen". Es untersucht die Veränderungen in den Bereichen Sport, Mode und Sexualität, die für das Selbstverständnis der "Neuen Frau" kennzeichnend waren. Die Vereinbarkeit von Beruf und Ehe wird kurz angeschnitten, wobei der Fokus auf dem Beruf der Angestellten liegt, als klassischem Beispiel für den Typus der "Neuen Frau". Die Zusammenfassung der Lebensweise liefert gleichzeitig eine demografische Beschreibung des Typus. Das Kapitel schließt mit einem Vergleich zwischen dem gesellschaftlichen Bild der "Neuen Frau", geprägt durch Medien und Kunst, und der Realität.
Schlüsselwörter
Neue Frau, Weimarer Republik, Frauenwahlrecht, Gleichberechtigung, soziokulturelle Veränderungen, Frauen im Beruf, Angestellte, Mode, Sport, Sexualität, gesellschaftliche Rollen, Idealbild, Realität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Soziokulturelle Veränderungen in der Stellung der Frau in der Weimarer Republik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die soziokulturellen Veränderungen in der Stellung der Frau in der Weimarer Republik. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Entstehung des Konzepts der "Neuen Frau" und einem Vergleich zwischen dem idealisierten Bild und der Realität der Frauen in dieser Zeit. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Veränderungen im Leben und Beruf der Frauen, insbesondere der Rolle der Frau als Angestellte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die veränderte gesellschaftliche Rolle der Frau nach dem Ersten Weltkrieg, die Entstehung und Charakterisierung des Typus der "Neuen Frau", ein Vergleich zwischen idealisiertem Bild und der Realität der Lebenswirklichkeit von Frauen, den Einfluss von Mode, Sport und Sexualität auf das Selbstverständnis der Frauen und die "Neue Frau" im Beruf, insbesondere als Angestellte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Veränderte Umstände nach dem Ersten Weltkrieg, Verschiedene "Frauentypen"?, "Neue Frauen" - Was macht sie aus?, und Fazit. Die Einleitung beschreibt den Kontext der Weimarer Republik und führt in das Thema ein. Kapitel 2 beleuchtet die rechtlichen und wirtschaftlichen Veränderungen nach dem Krieg. Kapitel 3 diskutiert verschiedene "Frauentypen" der 1920er Jahre. Kapitel 4 analysiert die Lebensweise und berufliche Tätigkeit der "Neuen Frau". Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die genauen Quellen werden in der vollständigen Arbeit aufgeführt. Die Zusammenfassung erwähnt explizit einen Artikel mit dem Titel "Drei Frauen stehen heute vor uns", der drei Frauentypen ("Gretchen", "Girl", "Garçonne") unterscheidet und analysiert. Weitere Quellen werden implizit durch die Analyse von Mode, Sport und Sexualität sowie der Rolle der Frau als Angestellte angedeutet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Neue Frau, Weimarer Republik, Frauenwahlrecht, Gleichberechtigung, soziokulturelle Veränderungen, Frauen im Beruf, Angestellte, Mode, Sport, Sexualität, gesellschaftliche Rollen, Idealbild, Realität.
Welche Aspekte des Lebens der "Neuen Frau" werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des Lebens der "Neuen Frau", darunter ihre Lebensweise (Sport, Mode, Sexualität), ihre berufliche Tätigkeit (insbesondere als Angestellte) und den Vergleich zwischen dem idealisierten Bild und der Realität ihrer Lebenssituation. Die Vereinbarkeit von Beruf und Ehe wird ebenfalls kurz angesprochen.
Wie wird der Begriff "Neue Frau" definiert und analysiert?
Die Arbeit analysiert den Begriff "Neue Frau" durch die Untersuchung der soziokulturellen Veränderungen nach dem Ersten Weltkrieg, die Entstehung verschiedener "Frauentypen" und den Vergleich zwischen dem idealisierten Bild (z.B. in Medien und Kunst) und der tatsächlichen Lebenssituation von Frauen. Der Fokus liegt dabei auf den Veränderungen im Beruf und den Einflussfaktoren wie Mode, Sport und Sexualität auf das Selbstverständnis der Frauen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit sind in dem Fazit zusammengefasst und basieren auf der Analyse der soziokulturellen Veränderungen im Leben und Beruf der Frauen der Weimarer Republik und dem Vergleich zwischen dem Idealbild der "Neuen Frau" und der Realität. Die genauen Schlussfolgerungen müssen der vollständigen Arbeit entnommen werden.
- Arbeit zitieren
- Richard Albers (Autor:in), 2011, Frauen in der Weimarer Republik, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/194943