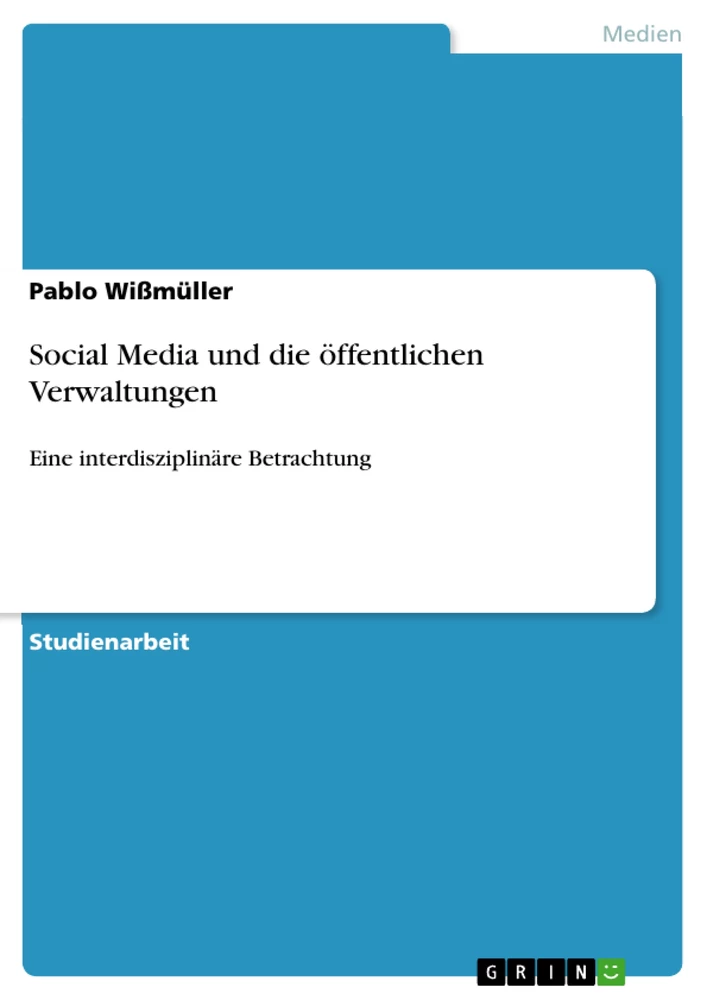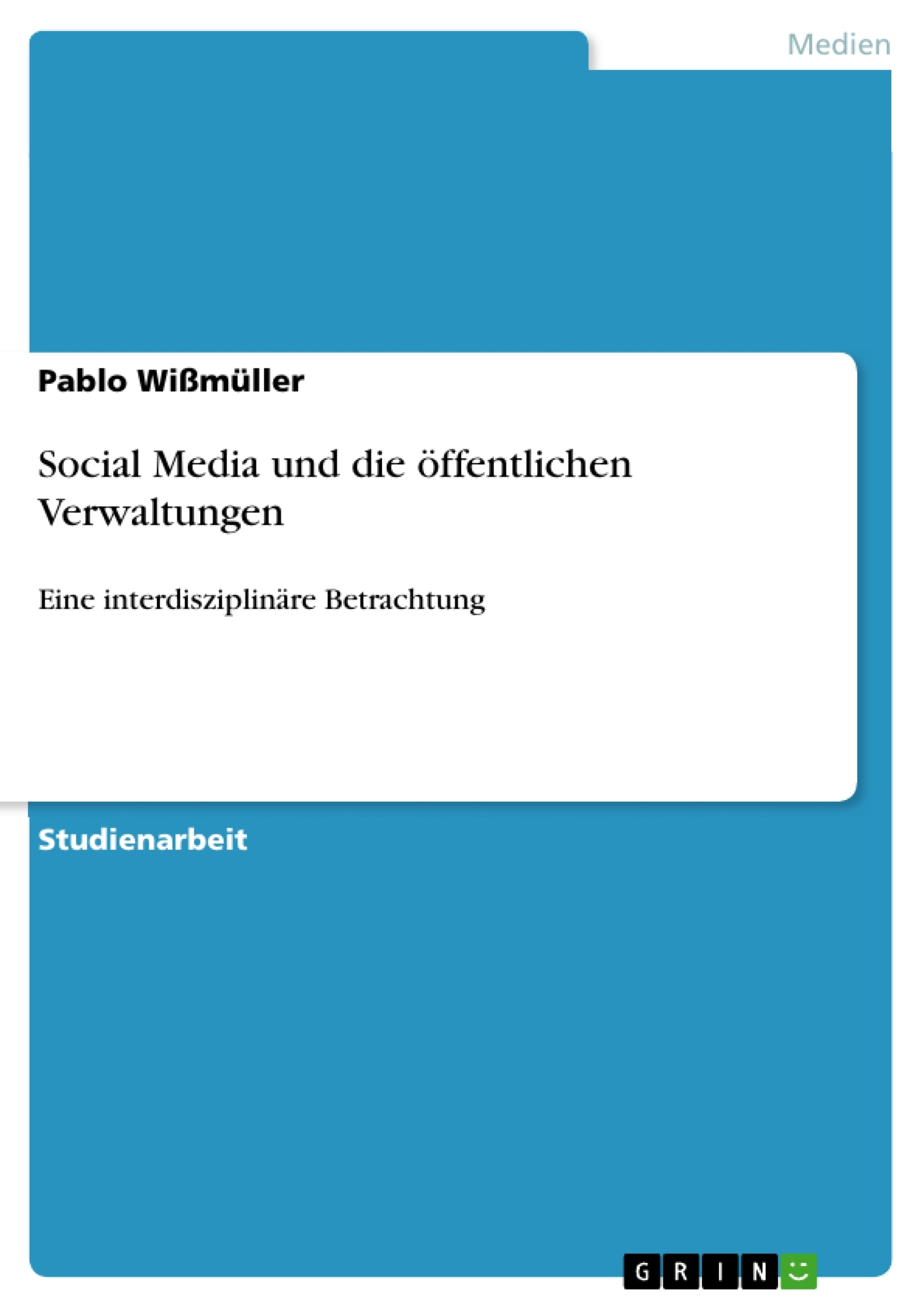Social Media, bzw. das Web 2.0 sind heute fester Bestandteil des täglichen Lebens. Als diese Begriffe im Jahr 2004 vom amerikanischen Verleger Tim O´Reilly geprägt wurden, war nicht absehbar, wie rasant die Entwicklung des Internets in diesem Genre vorangetrieben würde. Nun aber gehören Facebook-Seiten, Twitter-Nachrichten sowie Blogs und Video-Seiten in sämtlichen Bereichen, für Produzenten und Konsumenten, zum Standard. Sowohl privatwirtschaftliche Unternehmen, als auch Individuen haben die Potenziale erkannt und verstehen diese auch zu nutzen. Nun stellt sich die Frage, warum die öffentlichen Verwaltungen in Deutschland, trotz zahlreicher Projektumsetzungen im Segment des E-Government, die Angebote aus dem Bereich der Social Media nur sporadisch und zögernd in ihr Portfolio aufgenommen haben. Im Mai 2011 veröffentlichte die Abteilung für E-Government und IT-Steuerung der Finanzbehörde der freien und Hansestadt Hamburg den Leitfaden "Social Media in der Hamburgischen Verwaltung". Dieser Leitfaden wurde als Orientierungshilfe für die Verwaltungsmitarbeiter in Hamburg erstellt, und, gilt aufgrund der hohen Nachfrage, als bundesweite Referenz. Gleichzeitig dient der Leitfaden als Basis für diese Ausarbeitung und die nachgelagerten Fragestellungen.
Um dem Anspruch einer wissenschaftlichen Betrachtungsweise gerecht zu werden, ist es unabdingbar dieses Themengebiet aus verschiedenen Perspektiven, also interdisziplinär, zu fokussieren. Durch die Wirkungsweise von Social Media,
bzw. Web 2.0 und die damit einhergehende Interdependenz zwischen öffentlichen Verwaltungen, Bürgern und Privatunternehmen, werden betriebswirtschaftliche, rechtliche, soziologische und volkswirtschaftliche Kriterien bei der Bearbeitung impliziert.
Neben der Definition und Erklärung der reinen Begrifflichkeiten wird im Verlauf der folgenden Arbeit aufgezeigt, in welchem Kontext die mögliche Verwendung von Social Media durch die öffentlichen Verwaltungen stattfinden kann und welche Auswirkungen auf die Bürger und die Gesellschaft dadurch entstehen können. Aufgrund der Komplexität und der großen Bandbreite dieses Themengebiets wird im Rahmen dieser Arbeit lediglich auf die, der Meinung des Autors nach, wichtigsten Aspekte eingegangen und erhebt somit keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinition und -erklärung
- 2.1 Interdisziplinarität
- 2.2 öffentliche Verwaltung
- 2.3 Web 2.0 und Social Media
- 2.4 Soziale Netzwerke im Internet
- 2.5 Facebook
- 3. Die betriebswirtschaftliche Perspektive
- 3.1 Facebook als Kommunikations- und Marketinginstrument
- 3.1.1 Facebook als spezielles Instrument des Personalmarketing
- 3.2 Aufwandsberechnung von Social Media Aktivitäten
- 3.3 Erfolgs- und Nutzenmessung von Social Media Aktivitäten
- 4. Die rechtliche Perspektive
- 4.1 Datenschutz
- 4.2 Eigentum und Copyright von immateriellen Gütern
- 4.3 Identitätsdiebstahl und Verwechslung in sozialen Netzwerken
- 4.4 Social Media Guidelines
- 5. Die soziologische Perspektive
- 5.1 Gesellschaftliche Erwartungshaltung und die Möglichkeit zur Teilhabe
- 5.2 Computervermittelte Kommunikation und Gruppenprozesse
- 5.3 Online Communities basierend auf Gruppenprozessen
- 6. Die volkswirtschaftliche Perspektive
- 6.1 Nutzensteigerung für die Rezipienten
- 6.2 Effizienzsteigerung in den öffentlichen Verwaltungen
- 6.3 Einsatz von Social Media zur Stärkung des Standorts
- 7. Zusammenfassung und Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Nutzung von Social Media durch öffentliche Verwaltungen in Deutschland. Ziel ist es, die Chancen und Herausforderungen dieser Entwicklung aus interdisziplinärer Perspektive zu beleuchten. Dabei werden betriebswirtschaftliche, rechtliche, soziologische und volkswirtschaftliche Aspekte berücksichtigt.
- Die Potenziale und Herausforderungen von Social Media für öffentliche Verwaltungen
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Datenschutz im Kontext von Social Media
- Soziologische Auswirkungen von Social Media auf die Bürgerbeteiligung
- Betriebswirtschaftliche Aspekte der Social Media Nutzung (Kosten, Nutzen, Erfolgsmessung)
- Volkswirtschaftliche Implikationen der Social Media Nutzung für öffentliche Verwaltungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik von Social Media und deren zögerliche Akzeptanz in deutschen öffentlichen Verwaltungen ein. Sie verweist auf den rasanten Aufstieg von Social Media Plattformen und den Gegensatz zur zurückhaltenden Einführung in der öffentlichen Verwaltung. Der Hamburger Leitfaden "Social Media in der Hamburgischen Verwaltung" wird als wichtiger Bezugspunkt genannt, der die Grundlage für die vorliegende Arbeit bildet. Die Notwendigkeit einer interdisziplinären Betrachtungsweise aufgrund der komplexen Wirkungsweise von Social Media wird betont.
2. Begriffsdefinition und -erklärung: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe der Arbeit, darunter "Interdisziplinarität", "öffentliche Verwaltung", "Web 2.0", "Social Media" und "Soziale Netzwerke". Es legt die methodische Grundlage für die spätere Analyse fest, indem es die Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher, rechtlicher, soziologischer und volkswirtschaftlicher Perspektiven begründet. Die Definition von Interdisziplinarität betont die Einbeziehung verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen zur ganzheitlichen Betrachtung des Themas.
3. Die betriebswirtschaftliche Perspektive: Dieses Kapitel beleuchtet die betriebswirtschaftlichen Aspekte der Social Media Nutzung für öffentliche Verwaltungen. Es analysiert Facebook als Kommunikations- und Marketinginstrument, inklusive des Personalmarketings. Die Kapitel befassen sich mit der Aufwandsberechnung und der Erfolgsmessung von Social Media Aktivitäten, wobei die Herausforderungen bei der Quantifizierung des Nutzens von Social Media in diesem Kontext hervorgehoben werden.
4. Die rechtliche Perspektive: Dieser Abschnitt befasst sich mit den rechtlichen Aspekten der Social Media Nutzung durch öffentliche Verwaltungen. Datenschutz, Eigentumsrechte an immateriellen Gütern, die Gefahren des Identitätsdiebstahls und die Bedeutung von Social Media Guidelines werden diskutiert. Es wird deutlich, welche rechtlichen Hürden und Herausforderungen die öffentliche Verwaltung bei der Nutzung von Social Media Plattformen überwinden muss.
5. Die soziologische Perspektive: Dieses Kapitel untersucht die soziologischen Implikationen von Social Media im Kontext öffentlicher Verwaltungen. Es analysiert die gesellschaftlichen Erwartungen an die öffentliche Verwaltung in Bezug auf die Nutzung von Social Media und die damit verbundene Möglichkeit der Bürgerbeteiligung. Die Rolle von computervermittelter Kommunikation, Gruppenprozessen und Online-Communities im Rahmen der Interaktion zwischen Bürgern und öffentlicher Verwaltung wird eingehend beleuchtet.
6. Die volkswirtschaftliche Perspektive: Dieser Abschnitt widmet sich den volkswirtschaftlichen Aspekten der Social Media Nutzung durch die öffentliche Verwaltung. Der Nutzen für Bürger und die mögliche Effizienzsteigerung in den Verwaltungen werden analysiert. Die Frage, wie Social Media zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes beitragen kann, wird ebenfalls diskutiert. Der Fokus liegt dabei auf den ökonomischen Auswirkungen und den langfristigen Vorteilen dieser Technologie.
Schlüsselwörter
Social Media, öffentliche Verwaltung, E-Government, Interdisziplinarität, Betriebswirtschaftslehre, Recht, Soziologie, Volkswirtschaftslehre, Datenschutz, Bürgerbeteiligung, Kommunikation, Effizienz, Marketing, Personalmarketing, Online-Communities.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Nutzung von Social Media durch öffentliche Verwaltungen in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Nutzung von Social Media durch öffentliche Verwaltungen in Deutschland. Sie beleuchtet die Chancen und Herausforderungen dieser Entwicklung aus einer interdisziplinären Perspektive, indem sie betriebswirtschaftliche, rechtliche, soziologische und volkswirtschaftliche Aspekte berücksichtigt.
Welche Perspektiven werden in der Arbeit eingenommen?
Die Arbeit betrachtet die Thematik aus vier Hauptperspektiven: betriebswirtschaftlich (Kosten, Nutzen, Erfolgsmessung, Marketing, Personalmarketing), rechtlich (Datenschutz, Urheberrechte, Identitätsdiebstahl, Social Media Guidelines), soziologisch (gesellschaftliche Erwartungen, Bürgerbeteiligung, Online-Communities, Gruppenprozesse) und volkswirtschaftlich (Nutzensteigerung für Bürger, Effizienzsteigerung in der Verwaltung, Stärkung des Wirtschaftsstandorts).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Begriffsdefinition und -erklärung, Die betriebswirtschaftliche Perspektive, Die rechtliche Perspektive, Die soziologische Perspektive, Die volkswirtschaftliche Perspektive und Zusammenfassung und Bewertung. Jedes Kapitel untersucht einen spezifischen Aspekt der Social Media Nutzung durch öffentliche Verwaltungen.
Was wird im Kapitel "Begriffsdefinition und -erklärung" behandelt?
Dieses Kapitel klärt zentrale Begriffe wie Interdisziplinarität, öffentliche Verwaltung, Web 2.0, Social Media und Soziale Netzwerke. Es legt die methodische Grundlage für die Analyse fest und begründet die Berücksichtigung der verschiedenen Perspektiven.
Welche betriebswirtschaftlichen Aspekte werden behandelt?
Das Kapitel zur betriebswirtschaftlichen Perspektive analysiert Facebook als Kommunikations- und Marketinginstrument, inklusive Personalmarketing. Es befasst sich mit der Aufwandsberechnung und Erfolgsmessung von Social Media Aktivitäten und den Herausforderungen bei der Quantifizierung des Nutzens.
Welche rechtlichen Aspekte werden behandelt?
Der rechtliche Abschnitt diskutiert Datenschutz, Eigentumsrechte an immateriellen Gütern, Identitätsdiebstahl und die Bedeutung von Social Media Guidelines. Er beleuchtet die rechtlichen Hürden und Herausforderungen für öffentliche Verwaltungen bei der Social Media Nutzung.
Welche soziologischen Aspekte werden behandelt?
Das soziologische Kapitel untersucht gesellschaftliche Erwartungen an die öffentliche Verwaltung bezüglich Social Media, die Bürgerbeteiligung, computervermittelte Kommunikation, Gruppenprozesse und Online-Communities in der Interaktion zwischen Bürgern und Verwaltung.
Welche volkswirtschaftlichen Aspekte werden behandelt?
Der volkswirtschaftliche Abschnitt analysiert den Nutzen für Bürger, die Effizienzsteigerung in der Verwaltung und den Beitrag von Social Media zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts. Der Fokus liegt auf den ökonomischen Auswirkungen und langfristigen Vorteilen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter umfassen Social Media, öffentliche Verwaltung, E-Government, Interdisziplinarität, Betriebswirtschaftslehre, Recht, Soziologie, Volkswirtschaftslehre, Datenschutz, Bürgerbeteiligung, Kommunikation, Effizienz, Marketing, Personalmarketing und Online-Communities.
Welche Rolle spielt der "Hamburger Leitfaden 'Social Media in der Hamburgischen Verwaltung'"?
Der Hamburger Leitfaden wird in der Einleitung als wichtiger Bezugspunkt genannt, der die Grundlage für die vorliegende Arbeit bildet.
- Quote paper
- Pablo Wißmüller (Author), 2011, Social Media und die öffentlichen Verwaltungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/194002