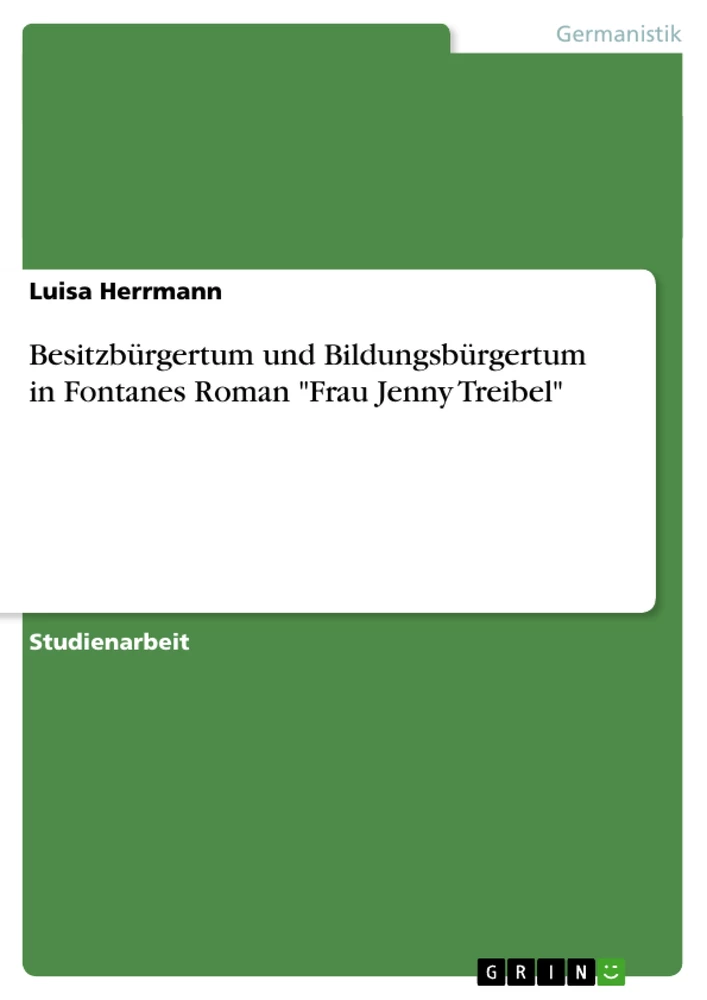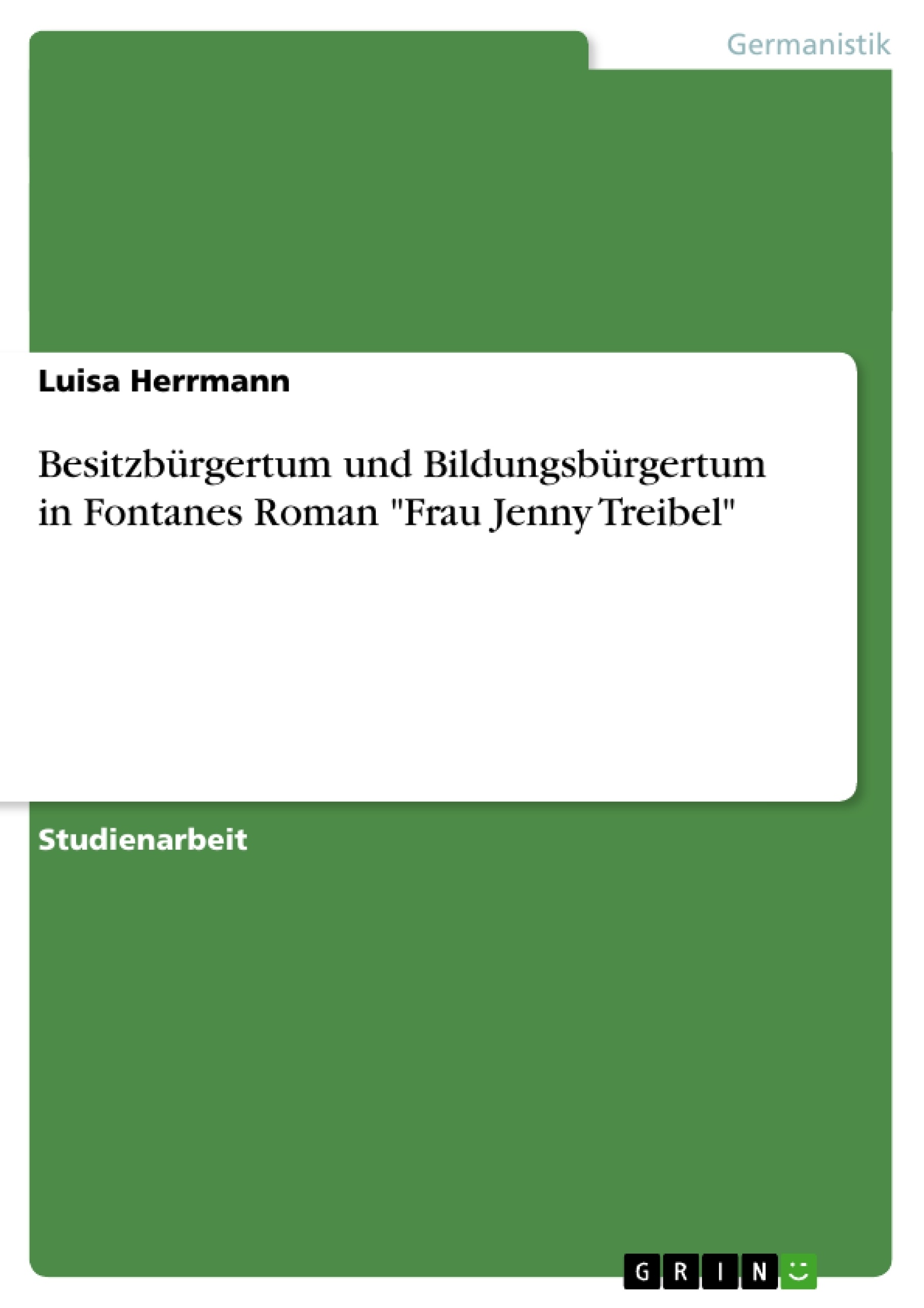[...] Es ist also offensichtlich die Absicht des Dichters, Kritik am Besitzbürgertum zu üben. Vorerst
bleibt jedoch offen, wie Fontane das Bildungsbürgertum sieht.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, „Wie werden Besitzbürgertum und
Bildungsbürgertum in Theodor Fontanes Roman ‚Frau Jenny Treibel’ dargestellt?“. Wird
das Bildungsbürgertum idealisiert oder werden sowohl Besitz- als auch Bildungsbürgertum
kritisiert? Überwiegt die Kritik an einem dieser beiden Pole der bürgerlichen Oberschicht?
An welchen Verhaltensweisen nimmt Fontane Anstoß? Weiterhin soll untersucht werden, in
wiefern das von Fontane entworfene Bild mit der Realität jener Zeit und mit Fontanes Äußerungen
bezüglich des Bürgertums übereinstimmt.
Um dies zu erörtern, sollen Vertreter des Besitzbürgertums, Jenny Treibel und Vertreter des
Bildungsbürgertums getrennt von einander betrachtet werden. Als Vertreter des Besitzbürgertums
sollen Kommerzienrat Treibel aber auch andere Mitglieder der Familie Treibel
ausgewählt werden. Da der Roman zum einen nach Jenny Treibel benannt ist und sie zum
anderen aus dem Kleinbürgertum stammt, soll die Kommerzienrätin getrennt vom Besitzbürgertum
untersucht werden. Als Vertreter des Bildungsbürgertums sollen Professor
Schmidt, dessen Tochter Corinna und „Die sieben Waisen Griechenlands“ ausgewählt werden.
Zur genaueren Betrachtung von Besitzbürgertum, Jenny Treibel und Bildungsbürgertum
sollen die drei Vergleichsmomente Besitz, Bildung und Sprache herangezogen werden.
Besitz und Bildung, so ist zu vermuten, sind jeweils für das Besitz- beziehungsweise Bildungsbürgertum
von zentraler Bedeutung. In Fontanes Romanen ist Sprache von großer
Wichtigkeit, da sich die Figuren durch ihre Sprache selbst charakterisieren.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in vier Teile. In einem ersten Teil soll der historische
Kontext, also die wirtschaftliche und soziale Situation des Bürgertums der wilhelminischen Gesellschaft betrachtet werden. Im zweiten Teil soll Fontanes Haltung
gegenüber dem Bürgertum an Hand seiner Briefe dargestellt werden. Im dritten Teil
sollen, wie bereits erwähnt, das Besitzbürgertum, Jenny Treibel und das Bildungsbürgertum
untersucht werden. Im vierten Teil der Arbeit soll versucht werden, die Ergebnisse
in einem kurzen Resümee zusammenzufassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Kontext
- Fontane und das Bürgertum
- Besitz
- Besitzbürger
- Jenny Treibel
- Bildungsbürger
- Bildung
- Besitzbürger
- Jenny Treibel
- Bildungsbürgertum
- Sprache
- Besitzbürger
- Jenny
- Bildungsbürger
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Besitzbürgertum und Bildungsbürgertum in Theodor Fontanes Roman „Frau Jenny Treibel“. Ziel ist es, herauszufinden, ob Fontane das Bildungsbürgertum idealisiert oder beide Gruppen kritisiert und welche Verhaltensweisen er dabei besonders anprangert. Weiterhin soll der Vergleich mit der gesellschaftlichen Realität der wilhelminischen Zeit und Fontanes eigenen Äußerungen zum Bürgertum gezogen werden.
- Fontanes Kritik am Besitzbürgertum
- Die Darstellung des Bildungsbürgertums bei Fontane
- Vergleich der beiden Gruppen anhand von Besitz, Bildung und Sprache
- Der historische Kontext des Romans
- Fontanes persönliche Haltung zum Bürgertum
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Romans „Frau Jenny Treibel“ ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Darstellung von Besitz- und Bildungsbürgertum. Sie umreißt den methodischen Ansatz, der die separate Betrachtung beider Gruppen anhand der Aspekte Besitz, Bildung und Sprache vorsieht, und erklärt die Auswahl der repräsentativen Figuren. Der Fokus liegt auf der Klärung der Forschungsfrage, ob Fontane eine bevorzugte oder kritische Haltung zu einer der beiden Gruppen einnimmt.
Historischer Kontext: Dieses Kapitel beschreibt den wirtschaftlichen und sozialen Wandel im Deutschen Reich nach 1871. Die rasante Industrialisierung, der Aufstieg des Bankkapitals und die Entstehung von Aktiengesellschaften führten zu einer Aufspaltung des Bürgertums in ein Besitz- und ein Bildungsbürgertum. Das Besitzbürgertum strebte nach Anlehnung an den Adel, während das Bildungsbürgertum sich zurückzog und seine Bestätigung in der Bildung fand. Der geschilderte gesellschaftliche Umbruch bildet den Hintergrund für das Verständnis der Konflikte im Roman.
Fontane und das Bürgertum: Dieser Abschnitt beleuchtet Fontanes eigene Sichtweise auf das Bürgertum. Er zeigt, dass Fontane zwar die Leistungen des Besitzbürgertums anerkennt, jedoch scharfe Kritik an deren oberflächlichem und prahlerischem Verhalten übt. Fontanes Briefe werden herangezogen, um seine Abneigung gegen den „Bourgeois“ und dessen Streben nach Anerkennung durch Zurschaustellung von Reichtum zu belegen. Die Ambivalenz von Anerkennung und Kritik in Fontanes Haltung gegenüber dem Bürgertum wird deutlich.
Schlüsselwörter
Theodor Fontane, Frau Jenny Treibel, Besitzbürgertum, Bildungsbürgertum, Wilhelminische Gesellschaft, Gesellschaftskritik, Sprache, Besitz, Bildung, Bourgeois, Realismus, soziale Strukturen.
Häufig gestellte Fragen zu Theodor Fontanes "Frau Jenny Treibel"
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Die HTML-Datei bietet eine umfassende Vorschau auf eine akademische Arbeit über Theodor Fontanes Roman "Frau Jenny Treibel". Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte der Arbeit, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der Darstellung von Besitzbürgertum und Bildungsbürgertum im Roman.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die Darstellung von Besitz- und Bildungsbürgertum in Fontanes Roman. Es wird analysiert, ob Fontane das Bildungsbürgertum idealisiert oder beide Gruppen kritisiert und welche Verhaltensweisen er dabei besonders anprangert. Der Vergleich mit der gesellschaftlichen Realität der wilhelminischen Zeit und Fontanes eigenen Äußerungen zum Bürgertum spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Besonders die Aspekte Besitz, Bildung und Sprache werden im Hinblick auf die beiden Bürgergruppen untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel Einleitung, Historischer Kontext, Fontane und das Bürgertum, und Resümee (implizit im Inhaltsverzeichnis). Innerhalb dieser Kapitel werden die beiden Bürgergruppen anhand von Besitz, Bildung und Sprache verglichen und analysiert.
Wie wird der historische Kontext berücksichtigt?
Das Kapitel "Historischer Kontext" beschreibt den wirtschaftlichen und sozialen Wandel im Deutschen Reich nach 1871, die Industrialisierung, den Aufstieg des Bankkapitals und die Aufspaltung des Bürgertums in Besitz- und Bildungsbürgertum. Dieser gesellschaftliche Umbruch bildet den Hintergrund für das Verständnis der Konflikte im Roman.
Welche Rolle spielt Fontanes eigene Sichtweise?
Der Abschnitt "Fontane und das Bürgertum" beleuchtet Fontanes persönliche Haltung zum Bürgertum. Es wird untersucht, inwieweit er das Besitzbürgertum kritisiert und ob er das Bildungsbürgertum idealisiert. Fontanes Briefe werden herangezogen, um seine Ansichten zu belegen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Theodor Fontane, Frau Jenny Treibel, Besitzbürgertum, Bildungsbürgertum, Wilhelminische Gesellschaft, Gesellschaftskritik, Sprache, Besitz, Bildung, Bourgeois, Realismus, soziale Strukturen.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie werden Besitzbürgertum und Bildungsbürgertum in Theodor Fontanes Roman "Frau Jenny Treibel" dargestellt, und nimmt Fontane eine bevorzugte oder kritische Haltung zu einer der beiden Gruppen ein?
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit untersucht die beiden Bürgergruppen separat anhand der Aspekte Besitz, Bildung und Sprache. Die Auswahl repräsentativer Figuren im Roman dient der Analyse.
- Quote paper
- Luisa Herrmann (Author), 2003, Besitzbürgertum und Bildungsbürgertum in Fontanes Roman "Frau Jenny Treibel", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/19395