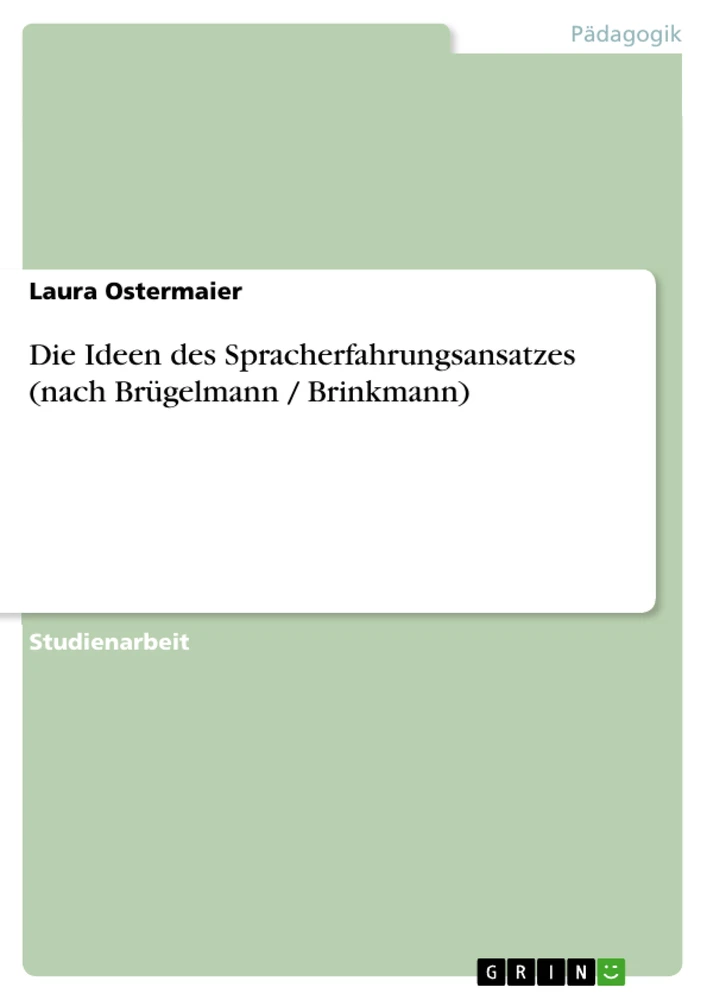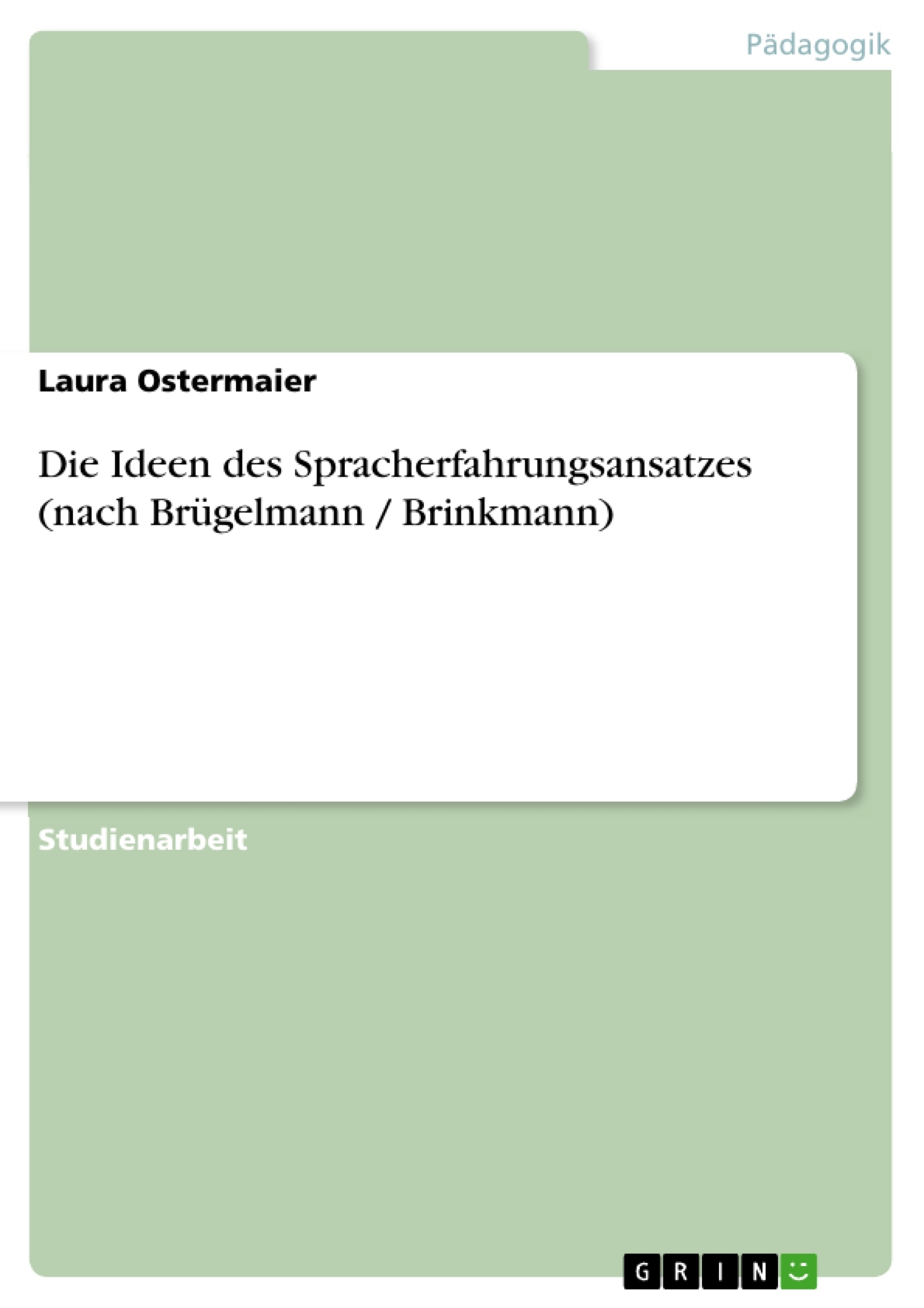Folgende Seminararbeit befasst sich mit den Ideen des Spracherfahrungsansatzes nach Hans Brügelmann und Erika Brinkmann. Hierbei handelt es sich um einen Forschungsansatz zum Schriftspracherwerb. Bevor nun auf Brügelmanns Thesen eingegangen werden soll, ist es sinnvoll zunächst einmal zu klären, was genau unter dem Begriff Schriftspracherwerb zu verstehen ist, damit sich auch der Begriff des Spracherfahrungsansatzes leichter einordnen lässt.
Unter Schriftspracherwerb versteht man den Erwerb der Lese- und Schreibfähigkeiten, wobei auch die spezifischen schriftsprachlichen Kommunikationsformen, die Orthographie und die Schreibmotorik (Graphomotorik) umfasst werden.1 Das Schreiben wird dabei als Umwandlung von Sprache in Schrift und Lesen als Umwandlung von Schrift in Sprache verstanden. Diese Lernprozesse beginnen bereits vor der Einschulung. „Mit dem Verfügen über die Schriftsprache wird der geistige Horizont des Kindes über den unmittelbaren Erfahrungsraum hinaus in entscheidender Weise erweitert.“2 „Um Lesen und Schreiben zu lernen, geht das Kind bewusster mit Sprache um. Es muss sich von einer Ebene der rein intuitiven Anwendung von Sprache auf die Ebene der Metakommunikation begeben, auf der Sprache selbst zum Gegenstand der Betrachtung gemacht wird.“3 Beim Erlernen von Schreiben und Lesen durchläuft das Kind verschiedene Entwicklungsstufen.
Die zentrale Aufgabe für den Lehrer ist es, das Wissen um Schrift und Sprache, das Lesen und Schreiben durch Übung zu automatisieren, also Geläufigkeit, Flüssigkeit, Lesegeschwindigkeit zu fördern.4
Folgende Arbeit wird sich nun im Rahmen des Schriftspracherwerbs mit den Ideen des Spracherfahrungsansatzes, dem Lesen und Schreiben als Denkentwicklung und methodischen Orientierungshilfen auseinandersetzen. Als weiterführender Gedanke wird zuletzt ein Vergleich mit fibelorientierten Lehrgängen angestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Vorbemerkung zum Schriftspracherwerb
- 2. Der Spracherfahrungsansatz nach Hans Brügelmann
- 3. Lesen und Schreiben als Denkentwicklung
- 4. Methodische Orientierungshilfen
- 4.1 Die Didaktische Landkarte
- 4.2 Das Vier-Säulen-Modell
- 5. Ein Vergleich mit fibelorientierten Lehrgängen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Spracherfahrungsansatz nach Brügelmann und Brinkmann im Kontext des Schriftspracherwerbs im Anfangsunterricht. Sie beleuchtet die Grundlagen des Schriftspracherwerbs, diskutiert den aktuellen Forschungsstand und zieht praktische Folgerungen für den Unterricht.
- Der Schriftspracherwerb als komplexer Prozess
- Der Spracherfahrungsansatz als Alternative zu fibelorientierten Lehrgängen
- Lesen und Schreiben als Denkentwicklung
- Methodische Orientierungshilfen für den Unterricht
- Individuelle Lernwege und ihre Berücksichtigung im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vorbemerkung zum Schriftspracherwerb: Dieses Kapitel definiert den Begriff Schriftspracherwerb, der den Erwerb von Lese- und Schreibfähigkeiten, inklusive orthographischer und graphomotorischer Aspekte, umfasst. Es betont die Bedeutung des Schriftspracherwerbs für die Erweiterung des kindlichen geistigen Horizonts und die Entwicklung metakognitiver Fähigkeiten im Umgang mit Sprache. Der Übergang von intuitiver Sprachanwendung zur Metakommunikation wird als zentraler Aspekt hervorgehoben, ebenso wie die Notwendigkeit, Lese- und Schreibfertigkeiten durch Übung zu automatisieren und zu flüssigen Prozessen zu entwickeln. Das Kapitel dient als Einführung und Kontextualisierung für die folgenden Kapitel, die sich detaillierter mit dem Spracherfahrungsansatz auseinandersetzen.
2. Der Spracherfahrungsansatz nach Hans Brügelmann: Dieses Kapitel beschreibt den Spracherfahrungsansatz von Brügelmann und Brinkmann, der auf dem "language experience approach" basiert und als Kritik an traditionellen Fibellehrgängen entstanden ist. Es betont die Berücksichtigung der individuellen Spracherfahrungen der Kinder und die Vermittlung von Lesen und Schreiben als kommunikative Handlungen. Die drei Leitideen des Ansatzes werden erläutert: die soziale Handlungsorientierung von Lesen und Schreiben, die wechselseitige Übersetzbarkeit von Schrift und Sprache und die Bedeutung der gegenständlichen Manipulation von Schriftzeichen für das Verständnis des Schriftsystems. Das Kapitel unterstreicht die Bedeutung der individuellen Lernwege und die Notwendigkeit, diese im Unterricht zu berücksichtigen, im Gegensatz zu gleichschrittigen Lehrgängen.
3. Lesen und Schreiben als Denkentwicklung: (Anmerkung: Da der bereitgestellte Text keinen expliziten Abschnitt "Lesen und Schreiben als Denkentwicklung" enthält, kann an dieser Stelle keine Zusammenfassung geliefert werden. Es wird empfohlen, den Originaltext um diesen Abschnitt zu ergänzen, um die Vollständigkeit der Zusammenfassung zu gewährleisten.)
4. Methodische Orientierungshilfen: Dieses Kapitel präsentiert methodische Hilfen für den Unterricht, die auf dem Spracherfahrungsansatz basieren. Es werden (wahrscheinlich) die „Didaktische Landkarte“ und das „Vier-Säulen-Modell“ als konkrete Beispiele vorgestellt und ihre Bedeutung für die Umsetzung des Spracherfahrungsansatzes im Unterricht erläutert. Die detaillierte Beschreibung dieser Modelle fehlt im vorliegenden Textauszug. Die Zusammenfassung dieser Modelle müsste mit dem vollständigen Text erfolgen.
5. Ein Vergleich mit fibelorientierten Lehrgängen: Dieses Kapitel (wahrscheinlich) vergleicht den Spracherfahrungsansatz mit traditionellen, fibelorientierten Lehrgängen. Es wird auf die Vor- und Nachteile beider Ansätze eingegangen und die Argumentation für die Überlegenheit des Spracherfahrungsansatzes im Hinblick auf die Berücksichtigung individueller Lernwege und die Förderung kommunikativer Kompetenz dargelegt. Da der Text diese Informationen nicht explizit aufweist, kann an dieser Stelle nur eine hypothetische Zusammenfassung geliefert werden, die mit dem vollständigen Text präzisiert werden müsste.
Schlüsselwörter
Schriftspracherwerb, Spracherfahrungsansatz, Brügelmann, Brinkmann, Lese- und Schreibfähigkeiten, Anfangsunterricht, individuelle Lernwege, kommunikative Handlungen, Fibellehrgänge, methodische Orientierungshilfen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Der Spracherfahrungsansatz nach Brügelmann
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Spracherfahrungsansatz nach Brügelmann und Brinkmann im Kontext des Schriftspracherwerbs im Anfangsunterricht. Sie beleuchtet die Grundlagen des Schriftspracherwerbs, diskutiert den aktuellen Forschungsstand und zieht praktische Folgerungen für den Unterricht. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich mit fibelorientierten Lehrgängen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Der Schriftspracherwerb als komplexer Prozess, der Spracherfahrungsansatz als Alternative zu fibelorientierten Lehrgängen, Lesen und Schreiben als Denkentwicklung, methodische Orientierungshilfen für den Unterricht (Didaktische Landkarte und Vier-Säulen-Modell) und die Berücksichtigung individueller Lernwege.
Was ist der Spracherfahrungsansatz nach Brügelmann und Brinkmann?
Der Spracherfahrungsansatz basiert auf dem "language experience approach" und kritisiert traditionelle Fibellehrgänge. Er betont die individuellen Spracherfahrungen der Kinder und die Vermittlung von Lesen und Schreiben als kommunikative Handlungen. Drei Leitideen sind zentral: soziale Handlungsorientierung, wechselseitige Übersetzbarkeit von Schrift und Sprache und die Bedeutung der gegenständlichen Manipulation von Schriftzeichen.
Welche methodischen Orientierungshilfen werden vorgestellt?
Die Seminararbeit erwähnt die „Didaktische Landkarte“ und das „Vier-Säulen-Modell“ als methodische Hilfen für den Unterricht basierend auf dem Spracherfahrungsansatz. Eine detaillierte Beschreibung fehlt im vorliegenden Auszug.
Wie wird der Spracherfahrungsansatz mit fibelorientierten Lehrgängen verglichen?
Der Vergleich zwischen dem Spracherfahrungsansatz und fibelorientierten Lehrgängen wird in der Seminararbeit angesprochen, jedoch fehlt im vorliegenden Auszug eine detaillierte Darstellung der Vor- und Nachteile beider Ansätze.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Schriftspracherwerb, Spracherfahrungsansatz, Brügelmann, Brinkmann, Lese- und Schreibfähigkeiten, Anfangsunterricht, individuelle Lernwege, kommunikative Handlungen, Fibellehrgänge, methodische Orientierungshilfen.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit umfasst folgende Kapitel: Vorbemerkung zum Schriftspracherwerb, Der Spracherfahrungsansatz nach Hans Brügelmann, Lesen und Schreiben als Denkentwicklung, Methodische Orientierungshilfen (inkl. Didaktische Landkarte und Vier-Säulen-Modell) und Ein Vergleich mit fibelorientierten Lehrgängen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Spracherfahrungsansatz und seine Anwendung im Anfangsunterricht, beleuchtet den aktuellen Forschungsstand und gibt praktische Hinweise für den Unterricht.
- Quote paper
- Laura Ostermaier (Author), 2010, Die Ideen des Spracherfahrungsansatzes (nach Brügelmann / Brinkmann), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/193239