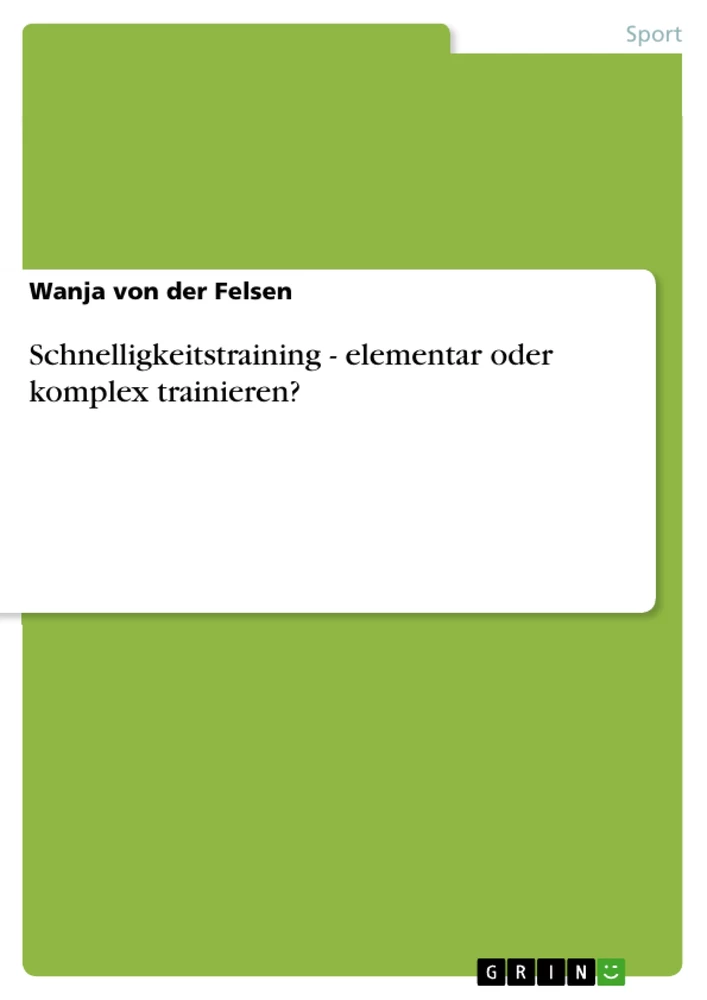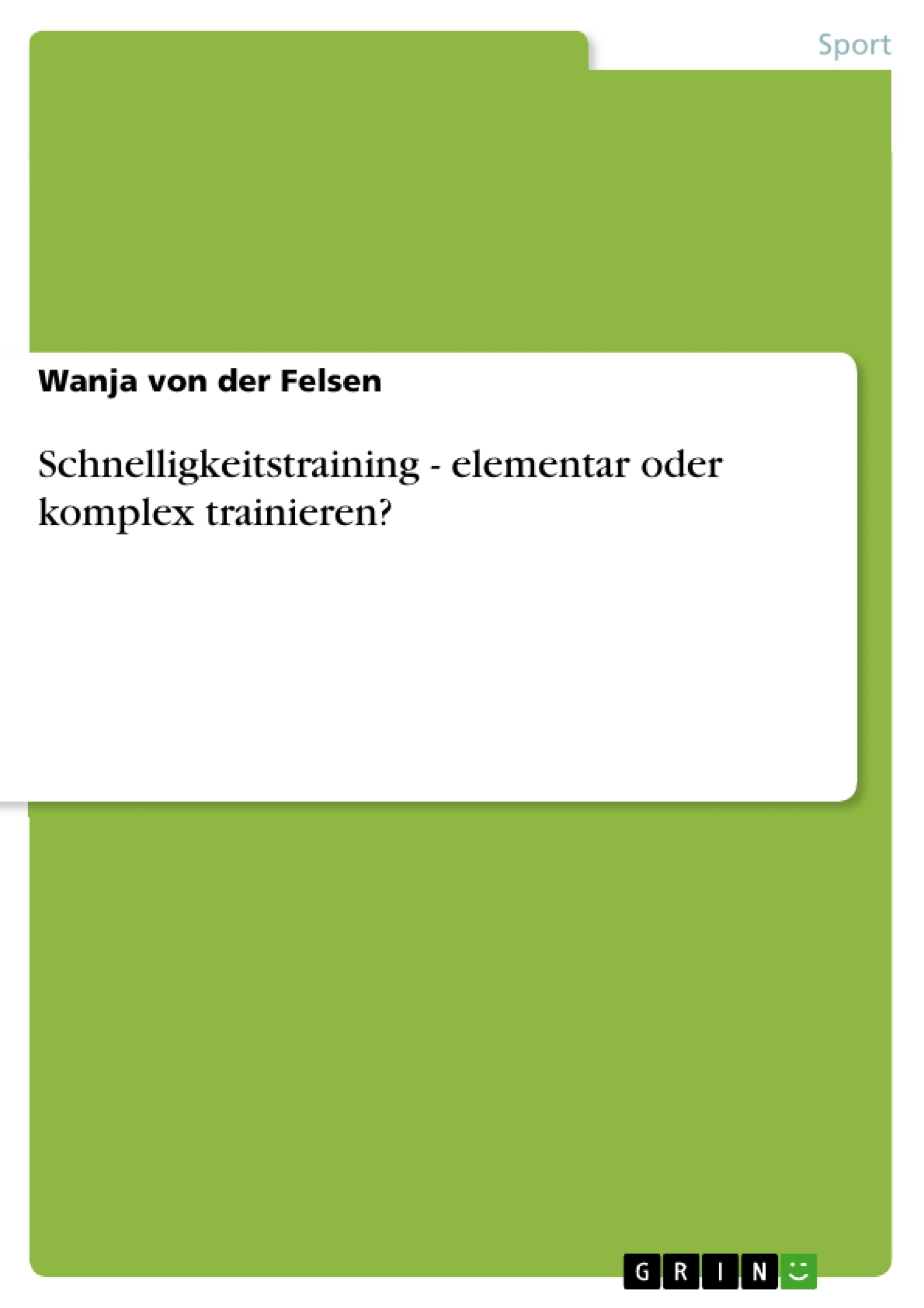Die Unterscheidung elementar oder komplex zu trainieren wird heute im Schnelligkeitstraining
nur noch selten aufgegriffen. Sie trennt dabei zwischen der elementaren
Fähigkeit, maximale Geschwindigkeiten oder Frequenzen ausführen zu können und
der komplexen Fähigkeit, diese in effektive Bewegungen umzusetzen.
1992 veröffentlichten Bauersfeld/Voß nach zehnjähriger Forschungsarbeit ihre detaillierten
theoretischen und trainingspraktischen „Neue Wege im Schnelligkeitstraining“.
Darin wurde die elementare Schnelligkeit als neuer und grundlegender Ansatz herausgearbeitet:
Jegliches Techniktraining müsse auf schnellen Zeitprogrammen aufbauen,
um das später anzutrainierende bioenergetische Potenzial ausnutzen zu können.
Die Wichtigkeit von Grundvoraussetzungen für schnelle Zeitprogramme wie z.B.
Nervenleitgeschwindigkeit zeigte sich bei der Untersuchung von LEHNERT/WEBER`75 (nach Bauersfeld(Voß, 1992) an Spitzensportlern aus verschiedenen Sportarten (Abb. 1). Fast alle erfolgreichen Athleten hatten eine hohe
Nervenleitgeschwindigkeit, keiner davon eine niedrige. Dies zeigt, dass diese Voraussetzung
zwar nicht hinreichend, aber im Spitzensport notwendig scheint. [...] Der Ansatz des elementaren Schnelligkeitstrainings ist zum einen interessant, da er weniger von der Konditionierung von außen und mehr von der Programmierung von
innen ausgeht, was auch eine andere Betrachtung des Sportlers mit sich bringt, aber
dieser Aspekt wird hier nicht weiter behandelt. Zum anderen ist der Ansatz insofern interessant, da er sich mitte der neunziger Jahre
in Deutschland auch in der Praxis verbreitet hatte. Das nimmt zwar vorweg, dass er
heute nicht mehr aktuell ist, die Herangehensweise ist jedoch nach wie vor spannend
und nicht alles was aufgeworfen wurde ist auch wieder verworfen worden. In dieser
Hausarbeit soll zunächst der Ansatz elementarer Schnelligkeit dargestellt werden
und anschließend mit dem Ansatz komplexer Schnelligkeit verglichen werden.
Zum Ende dieser Untersuchung wollen wir die Frage beantworten, welche Trainingsgrundsätze
und –methoden sich bewährt haben und für ein Training am Beispiel des
100m-Sprints eigenen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schnelligkeit als elementare Fähigkeit
- Zeitprogramme
- Stabilität von Zeitprogrammen
- Übertragbarkeit von Zeitprogrammen
- Zusammenhang Kraft und Zeitprogramme
- Wie trainieren?
- Schnelligkeitsquotient als Talentdiagnostik
- Studien zu Zeitprogrammen
- Zum Zusammenhang von Zeitprogrammen und Sprintschnelligkeit
- Zum Zusammenhang von Kraft und Zeitprogrammen
- Zur Generalisierbarkeit zyklischer Zeitprogramme
- Zur Generalisierbarkeit azyklischer Zeitprogramme
- Aktuelle Ansätze im Schnelligkeitstraining
- Bestimmung der Schnelligkeit
- Schnelligkeit in der Praxis
- Trainingspraktische Konsequenzen am Beispiel des 100m Sprints
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Schnelligkeit im Sport und analysiert verschiedene Ansätze im Schnelligkeitstraining. Sie untersucht den Ansatz des elementaren Schnelligkeitstrainings, der von Bauersfeld und Voß vertreten wurde und die Schnelligkeit als elementare Fähigkeit definiert, die durch Zeitprogramme beeinflusst wird. Diese Zeitprogramme, die als neuronale Strukturen im Gehirn betrachtet werden, sollen unabhängig von anderen Leistungsvoraussetzungen sein und in unterschiedlichen Bewegungen übertragbar sein. Die Arbeit beleuchtet auch die Kritik an dieser Theorie und analysiert die Ergebnisse von Studien, die den Zusammenhang zwischen Zeitprogrammen und sportlicher Schnelligkeit untersuchten.
- Elementares Schnelligkeitstraining und die Theorie der Zeitprogramme
- Kritik an der Generalisierbarkeit von Zeitprogrammen
- Zusammenhang zwischen Zeitprogrammen, Kraft und sportlicher Schnelligkeit
- Aktuelle Ansätze im Schnelligkeitstraining und die Bedeutung von Bewegungstechnik
- Trainingspraktische Konsequenzen für das Schnelligkeitstraining im Sprint
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Schnelligkeitstraining und die Unterscheidung zwischen elementarer und komplexer Schnelligkeit vor. Kapitel 2 behandelt die elementare Schnelligkeit, die von Bauersfeld und Voß als Grundlage für die Entwicklung schneller Bewegungen betrachtet wird. Die Autoren definieren die elementare Schnelligkeit anhand von Eigenschaften, die sie in einer Reihe von Studien untersucht haben. Kapitel 3 präsentiert verschiedene Studien, die den Zusammenhang zwischen Zeitprogrammen und Sprintschnelligkeit, sowie die Generalisierbarkeit von Zeitprogrammen analysieren. Kapitel 4 beleuchtet aktuelle Ansätze im Schnelligkeitstraining und betont die Komplexität der Schnelligkeit, die nicht nur von den Zeitprogrammen, sondern auch von der Bewegungstechnik, der Kondition und der Motivation beeinflusst wird. Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt und die trainingspraktischen Konsequenzen für das Schnelligkeitstraining im Sprint werden erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie elementares Schnelligkeitstraining, Zeitprogramme, Generalisierbarkeit von Fähigkeiten, Schnelligkeitsdiagnostik, Bewegungstechnik, Sprinttraining, Koordinationsmethode und Intensitätsmethode.
- Arbeit zitieren
- Wanja von der Felsen (Autor:in), 2012, Schnelligkeitstraining - elementar oder komplex trainieren?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/193134