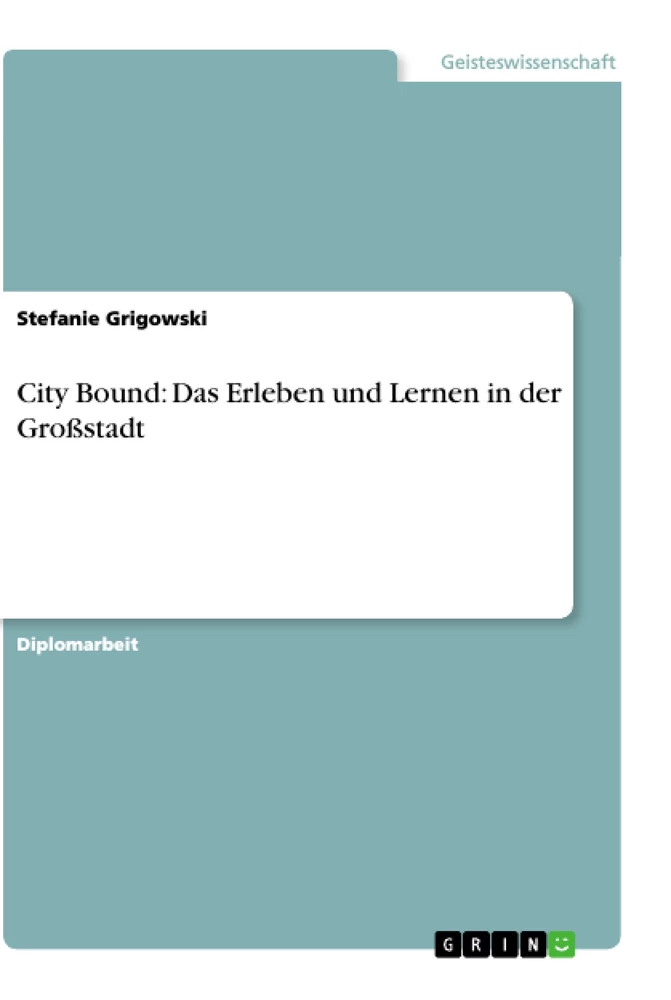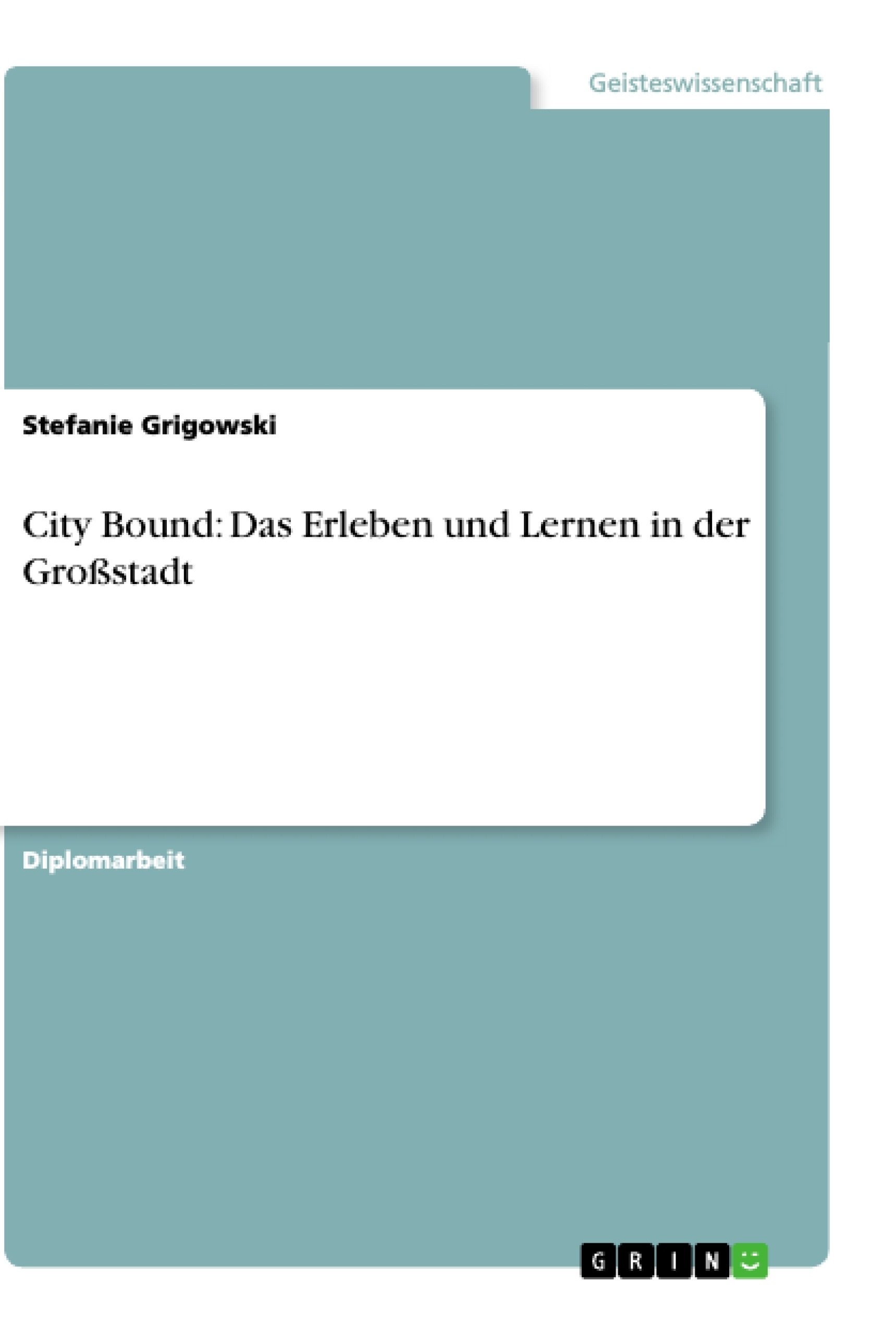City Bound soll eine mögliche Alternative zur Erlebnispädagogik in der Natur bieten, die das Handlungsfeld innerhalb einer Stadt begreift.
Im ersten Teil meiner Diplomarbeit möchte ich einen Einblick in die Geschichte der Erlebnispädagogik geben und die Lernmodelle dieser Pädagogik erläutern. Sie sind gleichermaßen bedeutend für die Entstehung des Konzepts City Bound.
Im weiteren Verlauf werden die Zusammenhänge von Bedürfnissen, Erlebnissen und Lernen verdeutlicht und wie sie in der Erlebnispädagogik zum Tragen kommen. Der soziale, gesellschaftliche Wertewandel spielt in diesem Kontext eine entscheidende Rolle. Eichinger sieht in diesen Veränderungen die Bedrohlichkeit für „(…) lebensweltliche Grundlagen des menschlichen Handelns, das Alltagswissen und die hierin eingebettete Identität (…)“.
Welche Rolle spielen Medien in dieser Beziehung? Sie gelten als Ersatzwelten für fehlende Erlebnisse und Abenteuer. Können Kinder und Jugendliche allerdings mit Hilfe von Medien ihre Bedürfnisse befriedigen und wirkliches Erleben erfahren? Wo kann sich die Erlebnispädagogik hier als hilfreich erweisen?
Die Bedeutung von Abenteuer und Risiko muss in diesem Zusammenhang geklärt werden. Abenteuer spielen gerade in der Jugendphase eine entscheidende Rolle. Nach Heckmair und Michl meint Erlebnispädagogik eine handlungsorientierte Methode, in der junge Menschen vor physische, psychische und soziale Herausforderungen gestellt werden. In erlebnispädagogischen Aktivitäten stellt die Herausforderung und die letztendliche Gestaltung der Aktion das Abenteuer dar. Was verstehen Jugendliche allerdings unter dem Begriff Abenteuer? Was stellt für Kinder und Jugendliche ein Risiko dar? Gerade das Abenteuerverhalten und das Erleben von Kindern und Jugendlichen in Großstädten werden in diesem Kontext näher ausgeführt.
Den Kern der Arbeit bilden Entstehung, Inhalte und Wirkungen von erläuterten City Bound-Aktivitäten.
Die Auswertung eines Interviews mit einer City Bound-Praktikerin in Nordrhein-Westfalen schließt diese Arbeit zur theoretischen Untermalung ab.
Ziel meiner Arbeit ist somit, die Inhalte, die Möglichkeiten und auch die Wichtigkeit von erlebnispädagogischen Aktivitäten in der Stadt aufzuzeigen und in einem Fazit die Sinnhaftigkeit für mich zu bestätigen und weiter geben zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Geschichte der Erlebnispädagogik
- 2.1 Die Ursprünge der Erlebnispädagogik
- 2.1.1 Jean Jaques Rousseau
- 2.1.2 David Henry Thoreau
- 2.1.3 John Dewey
- 2.1.4 Kurt Hahn
- 2.2 Die Lernmodelle der Erlebnispädagogik
- 2.2.1 The Mountain speak for themselves
- 2.2.2 Outward Bound Plus
- 2.2.3 Das Metaphorische Modell
- 2.2.4 Die Lernmodelle nach Priest und Gass
- 3 Erleben und Lernen in der Erlebnispädagogik
- 3.1 Die wesentlichen Prinzipien der Erlebnispädagogik
- 3.2 Die Bedeutung des Lernens
- 3.3 Der Bildungsaspekt
- 3.4 Die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen
- 3.5 Der Zusammenhang von Erlebnissen, Bedürfnissen und Lernen in der Erlebnispädagogik
- 3.6 Die Bedeutung von Risiko und Abenteuer für Kinder und Jugendliche
- 3.7 Erlebnispädagogische Programme zwischen Risiko und Gefahr
- 4 Erleben und Lernen in Großstädten
- 4.1 Das Erleben in Großstädten
- 4.2 Lernmöglichkeiten im Lebensraum Großstadt
- 5 City Bound
- 5.1 Der Ursprung von City Bound
- 5.2 Das Konzept City Bounds
- 5.2.1 Vier Einblicke in internationale Konzepte
- 5.2.2 Die Konzeptanforderungen
- 5.2.3 Die Konzeptentwicklung
- 5.3 Ziele in der Erlebnispädagogik
- 5.3.1 Die Ziele Jugendlicher im Lebensraum Großstadt
- 5.3.2 Die Ziele City Bounds
- 5.3.3 Die Zielgruppen von City Bound-Programmen
- 5.4 Die Kriterien City Bounds
- 5.5 City Bound-Aktivitäten
- 5.5.1 Die Phasen einer City Bound-Aktivität
- 5.5.2 City Bound-Aktivitäten und geeignete Handlungs- und Spielräume
- 5.5.3 Vier Zielsetzungen und sämtliche Möglichkeiten
- 5.6 Die Reflexion, der Transfer und die Wirkungen von City Bound-Aktivitäten
- 5.6.1 Die Reflexion und der Transfer City Bounds
- 5.6.2 Die Wirkungen City Bounds und die Bedeutung der Nachbereitung
- 5.7 Die Voraussetzungen
- 5.7.1 Erforderliche Trainerkompetenzen
- 5.7.2 Der Sicherheitsaspekt
- 5.8 City Bound im Vergleich mit Outward Bound
- 5.9 City Bound in der Zukunft
- 6 City Bound aus der Sicht einer Praktikerin - Auswertung des Interviews
- 6.1 Der Weg und das Ziel – Methoden und Ziele des Interviews
- 6.1.1 Vorstellung der Organisation
- 6.1.2 Vorstellung der Interviewpartnerin
- 6.2 Die Konzeption
- 6.3 Zielgruppen und Zielsetzungen bei Citybound Essen
- 6.3.1 Die Zielgruppen
- 6.3.2 Die Ziele und Erwartungen seitens Citybound Essen
- 6.3.3 Die Ziele und Erwartungen der Auftraggeber
- 6.3.4 Die Erwartungen der Teilnehmer
- 6.4 Die City Bound-Programme bei Citybound Essen
- 6.4.1 Die Aktivitäten von Citybound Essen
- 6.4.2 Die Dauer der Angebote
- 6.4.3 Die Veranstaltungsorte
- 6.5 Zwischen Fähigkeiten, Fehlverhalten und ihren Konsequenzen
- 6.6 Ein Beobachtungsvergleich zwischen Land- und Stadtkindern
- 6.7 Die Reflexion, der Transfer und die Wirkungen bei Citybound Essen
- 6.8 Die Trainervoraussetzungen
- 6.9 Vergütung, Finanzierung und Kooperationen
- 6.10 Die Zukunftsaussichten
- Die Geschichte und die Prinzipien der Erlebnispädagogik
- Die Bedeutung des Erlebens und Lernens in der Erlebnispädagogik
- Die Herausforderungen und Chancen der Erlebnispädagogik in Großstädten
- Die Entwicklung eines Konzepts für "City Bound" Programme
- Die Anwendung des Konzepts in der Praxis und die Analyse der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit "City Bound: Das Erleben und Lernen in der Großstadt" befasst sich mit der Anwendung von Erlebnispädagogik in urbanen Umgebungen. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Potenziale der Erlebnispädagogik in Großstädten zu erforschen und ein Konzept für "City Bound" Programme zu entwickeln. Dieses Konzept soll den spezifischen Bedürfnissen von Jugendlichen im Lebensraum Großstadt Rechnung tragen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema "City Bound" und die Relevanz der Erlebnispädagogik in Großstädten vor. Das zweite Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Erlebnispädagogik, beginnend mit ihren Ursprüngen und ihren wichtigsten Vertretern. Es werden verschiedene Lernmodelle der Erlebnispädagogik vorgestellt, die die Grundlage für die Anwendung des Konzepts in der Praxis bilden. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Prinzipien, den Zielen und den Bedürfnissen, die im Zentrum der Erlebnispädagogik stehen. Dabei wird die Bedeutung des Erlebens und Lernens sowie die Rolle von Risiko und Abenteuer für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen herausgestellt. Das vierte Kapitel befasst sich mit den spezifischen Herausforderungen und Chancen des Lernens in Großstädten. Das fünfte Kapitel stellt das Konzept "City Bound" vor, das als ein innovativer Ansatz zur Anwendung der Erlebnispädagogik in urbanen Umgebungen verstanden werden kann. Das Kapitel analysiert die Konzeptentwicklung, die Zielgruppen und die Möglichkeiten zur Umsetzung von "City Bound" Programmen. Das sechste Kapitel schließlich bietet Einblicke in die Praxis von "City Bound" Programmen anhand eines Interviews mit einer Praktikerin.
Schlüsselwörter
Erlebnispädagogik, City Bound, Urbanes Lernen, Großstadt, Kinder und Jugendliche, Risiko, Abenteuer, Konzepte, Methoden, Praxis, Interview
- Quote paper
- Stefanie Grigowski (Author), 2009, City Bound: Das Erleben und Lernen in der Großstadt, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/192699