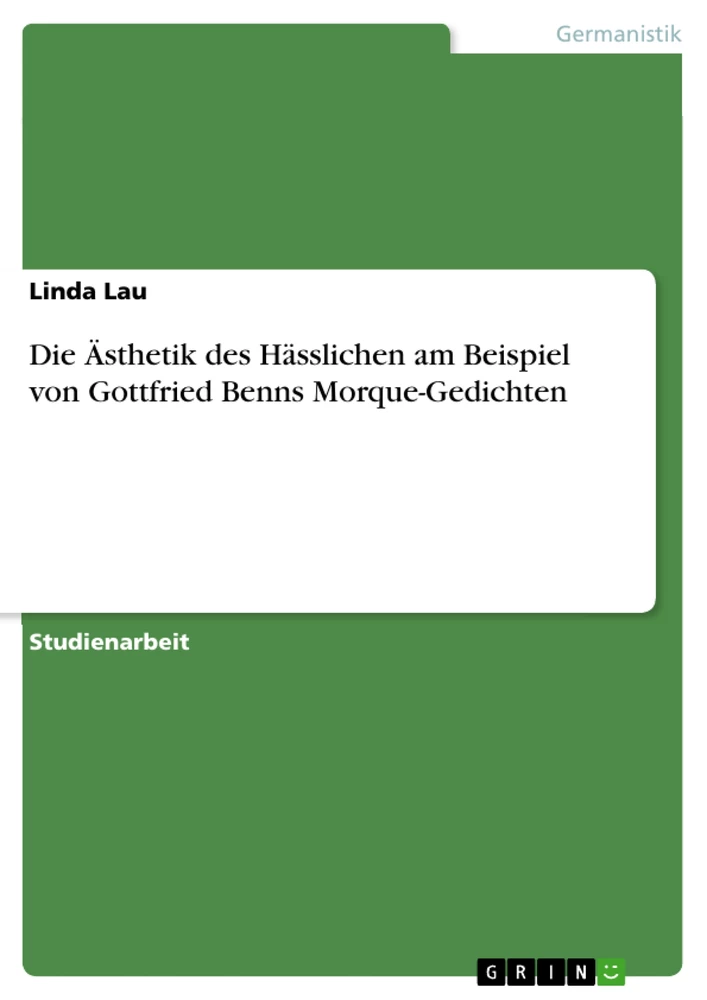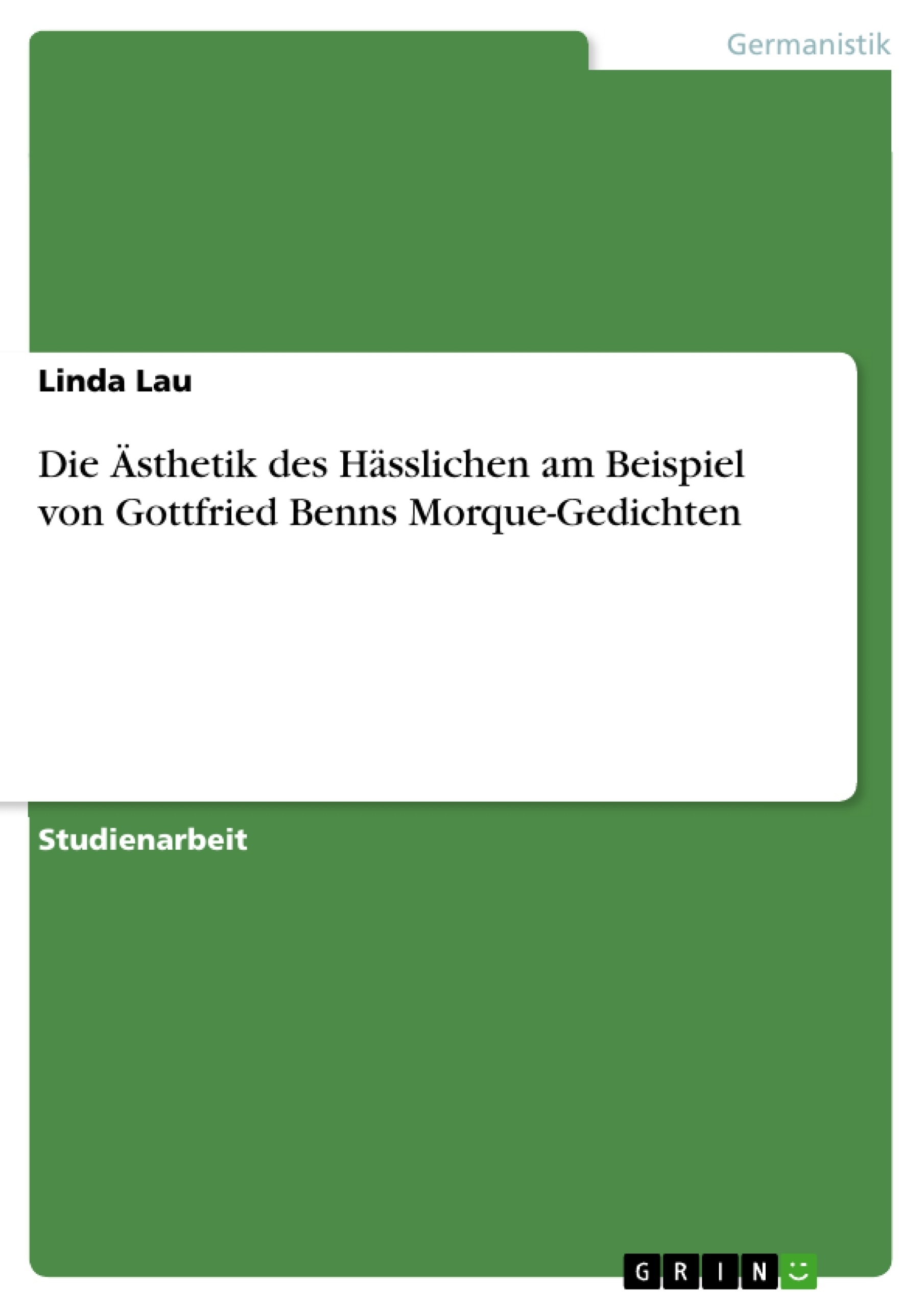„Die Ästhetik des Hässlichen erhebt in der expressionistischen wie schon in der naturalistischen Moderne als eine Technik zur Desillusionierung des schönen Scheins Erkenntnisansprüche auf Wahrheit und Authentizität, die im Rahmen tradierter Verpflichtungen der Künste auf das Schöne nicht mehr einlösbar erschienen.“
Thomas Anz spielt in seinem Zitat auf ein bestimmtes Motiv expressionistischer Literatur an: das Hässliche. So finden sich in entsprechenden Gedichten gehäuft Bilder des kranken und hässlich gewordenen Körpers: Ausdrücke wie „Darmkrankheiten, Pickel, faule Zähne, faule Säfte, grüne Zähne, Lidrandentzündung, junger Kropf, Bartflechte, Gichtknoten, Seuchen, Pestilenzen, Beulen, Eiter, Furunkel, Rotz, Karbunkel [oder] Kniewasser“2 beherrschen das allgemeine Schriftbild.
Ziel dieser Arbeit ist es, die sogenannte »Ästhetik des Hässlichen« am Beispiel von Gottfried Benns Morque-Gedichten herauszuarbeiten. Im ersten Teil wird der Fokus zunächst auf dem historischen Hintergrund liegen. Dementsprechend sollen für das sogenannte »expressionistische Jahrzehnt« zeitgeschichtliche Aspekte herausgehoben und die allgemeine Funktion des Hässlichen in expressionistischer Lyrik erläutert werden. Darüber hinaus soll ausschnittsweise die Person Gottfried Benn und insbesondere sein literarisches Schaffen beleuchtet werden. Diesbezüglich werde ich zunächst auf einige biografische Eckdaten und anschließend genauer auf seine Gedichtsammlung »Morque« eingehen. Im zweiten Teil sollen dann insgesamt drei Motive innerhalb ausgewählter Morque-Gedichte analysiert werden. Herangezogen werden hierzu die Gedichte „Kleine Aster“, „Schöne Jugend“, „Saal der kreissenden Frauen“ und „Mann und Frau gehn durch die Krebsbaracke“.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historischer Hintergrund
- 2.1. Zeitgeschichtliche Aspekte: Das expressionistische Jahrzehnt
- 2.2. Die Funktion des Hässlichen in expressionistischer Lyrik
- 2.3. Gottfried Benn als Dichter seiner Zeit
- 2.3.1. Biographische Eckdaten zu Leben und Werk
- 2.3.2. Benns »Morque-Gedichte«
- 3. Motivkomplexe
- 3.1. Verwesung/Vergänglichkeit/Verfall: Tod vs. Leben?
- 3.1.1. in: „Kleine Aster“
- 3.1.2. in: „Schöne Jugend“
- 3.1.3. in: „Mann und Frau gehn durch die Krebsbaracke“
- 3.2. Entwertung des Menschen durch Identitätsverlust
- 3.2.1. in: „Kleine Aster“
- 3.2.2. in: „Schöne Jugend“
- 3.2.3. in: „Mann und Frau gehn durch die Krebsbaracke“
- 3.3. Religiöser Verweischarakter: Theologie vs. Anatomie
- 3.3.1. in: „Saal der kreissenden Frauen“
- 3.3.2. in: „Mann und Frau gehn durch die Krebsbaracke“
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die "Ästhetik des Hässlichen" in Gottfried Benns Morque-Gedichten. Sie beleuchtet den historischen Kontext des Expressionismus, die Funktion des Hässlichen in der expressionistischen Lyrik und analysiert ausgewählte Gedichte Benns. Das Ziel ist, die Darstellung des Hässlichen als ästhetisches Mittel und dessen Bedeutung im Werk Benns zu verstehen.
- Der historische Kontext des Expressionismus und seine soziokulturellen Einflüsse.
- Die Rolle des Hässlichen in der expressionistischen Lyrik als Mittel der Desillusionierung und Darstellung der Realität.
- Analyse ausgewählter Motivkomplexe in Benns Morque-Gedichten (Verwesung, Identitätsverlust, religiöse Aspekte).
- Die Beziehung zwischen Benns Biografie und seinem literarischen Schaffen.
- Die ästhetische Funktion des Hässlichen in Benns Gedichten.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der "Ästhetik des Hässlichen" im Expressionismus ein und skizziert die Zielsetzung der Arbeit. Sie benennt Gottfried Benn und seine Morque-Gedichte als zentralen Untersuchungsgegenstand und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit, der den historischen Kontext, die Analyse ausgewählter Motive und ein Fazit umfasst.
2. Historischer Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen und soziokulturellen Kontext des Expressionismus. Es beschreibt die tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen um die Jahrhundertwende, wie Rationalisierung, Industrialisierung und Urbanisierung, die die expressionistische Literatur prägten. Der Erste Weltkrieg und seine Folgen, die Entfremdung des Individuums in der Großstadt und die Kritik an einer verwissenschaftlichten und rationalisierten Kultur werden als wichtige Themen hervorgehoben. Das Kapitel erklärt die Entstehung der "Ästhetik des Hässlichen" als Reaktion auf den Schönheitskult des Fin de Siècle und als Mittel zur Darstellung einer zerrissenen Welt.
3. Motivkomplexe: Dieses Kapitel analysiert drei zentrale Motivkomplexe in ausgewählten Gedichten aus Benns Morque-Zyklus: Verwesung/Vergänglichkeit/Verfall, Entwertung des Menschen durch Identitätsverlust und religiöse Bezüge. Jeder Motivkomplex wird anhand von Beispielen aus den Gedichten "Kleine Aster", "Schöne Jugend", "Saal der kreissenden Frauen" und "Mann und Frau gehn durch die Krebsbaracke" untersucht. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung der Motive und deren ästhetische Funktion in Benns Werk.
Schlüsselwörter
Ästhetik des Hässlichen, Expressionismus, Gottfried Benn, Morque-Gedichte, Verwesung, Vergänglichkeit, Identitätsverlust, religiöse Symbolik, soziokultureller Kontext, Moderne, Desillusionierung.
Häufig gestellte Fragen zu: Ästhetik des Hässlichen in Gottfried Benns Morque-Gedichten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die "Ästhetik des Hässlichen" in Gottfried Benns Morque-Gedichten im Kontext des Expressionismus. Sie analysiert ausgewählte Gedichte und beleuchtet den historischen Kontext, die Funktion des Hässlichen in der expressionistischen Lyrik und die Darstellung des Hässlichen als ästhetisches Mittel in Benns Werk.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den historischen Kontext des Expressionismus und seine soziokulturellen Einflüsse; die Rolle des Hässlichen in der expressionistischen Lyrik als Mittel der Desillusionierung und Darstellung der Realität; die Analyse ausgewählter Motivkomplexe in Benns Morque-Gedichten (Verwesung, Identitätsverlust, religiöse Aspekte); die Beziehung zwischen Benns Biografie und seinem literarischen Schaffen; und die ästhetische Funktion des Hässlichen in Benns Gedichten.
Welche Gedichte werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf ausgewählte Gedichte aus Benns Morque-Zyklus, darunter "Kleine Aster", "Schöne Jugend", "Saal der kreissenden Frauen" und "Mann und Frau gehn durch die Krebsbaracke".
Welche Motivkomplexe werden untersucht?
Die Arbeit untersucht drei zentrale Motivkomplexe: Verwesung/Vergänglichkeit/Verfall, Entwertung des Menschen durch Identitätsverlust und religiöse Bezüge in den Gedichten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum historischen Hintergrund des Expressionismus, ein Kapitel zur Analyse der Motivkomplexe in den ausgewählten Gedichten und ein Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welchen historischen Kontext beleuchtet die Arbeit?
Das Kapitel zum historischen Hintergrund beleuchtet den Expressionismus im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen um die Jahrhundertwende (Rationalisierung, Industrialisierung, Urbanisierung), den Ersten Weltkrieg und seine Folgen, die Entfremdung des Individuums und die Kritik an einer verwissenschaftlichten Kultur. Es erklärt die Entstehung der "Ästhetik des Hässlichen" als Reaktion auf den Schönheitskult des Fin de Siècle.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ästhetik des Hässlichen, Expressionismus, Gottfried Benn, Morque-Gedichte, Verwesung, Vergänglichkeit, Identitätsverlust, religiöse Symbolik, soziokultureller Kontext, Moderne, Desillusionierung.
Welches ist das zentrale Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Darstellung des Hässlichen als ästhetisches Mittel und dessen Bedeutung im Werk Gottfried Benns zu verstehen.
- Quote paper
- Linda Lau (Author), 2011, Die Ästhetik des Hässlichen am Beispiel von Gottfried Benns Morque-Gedichten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/191480