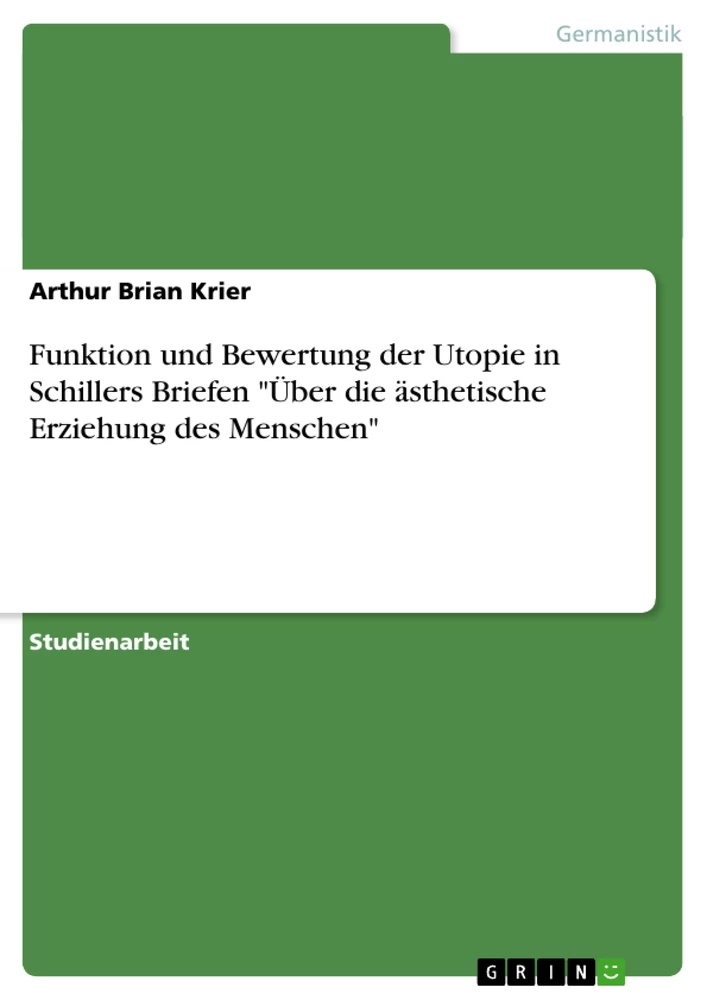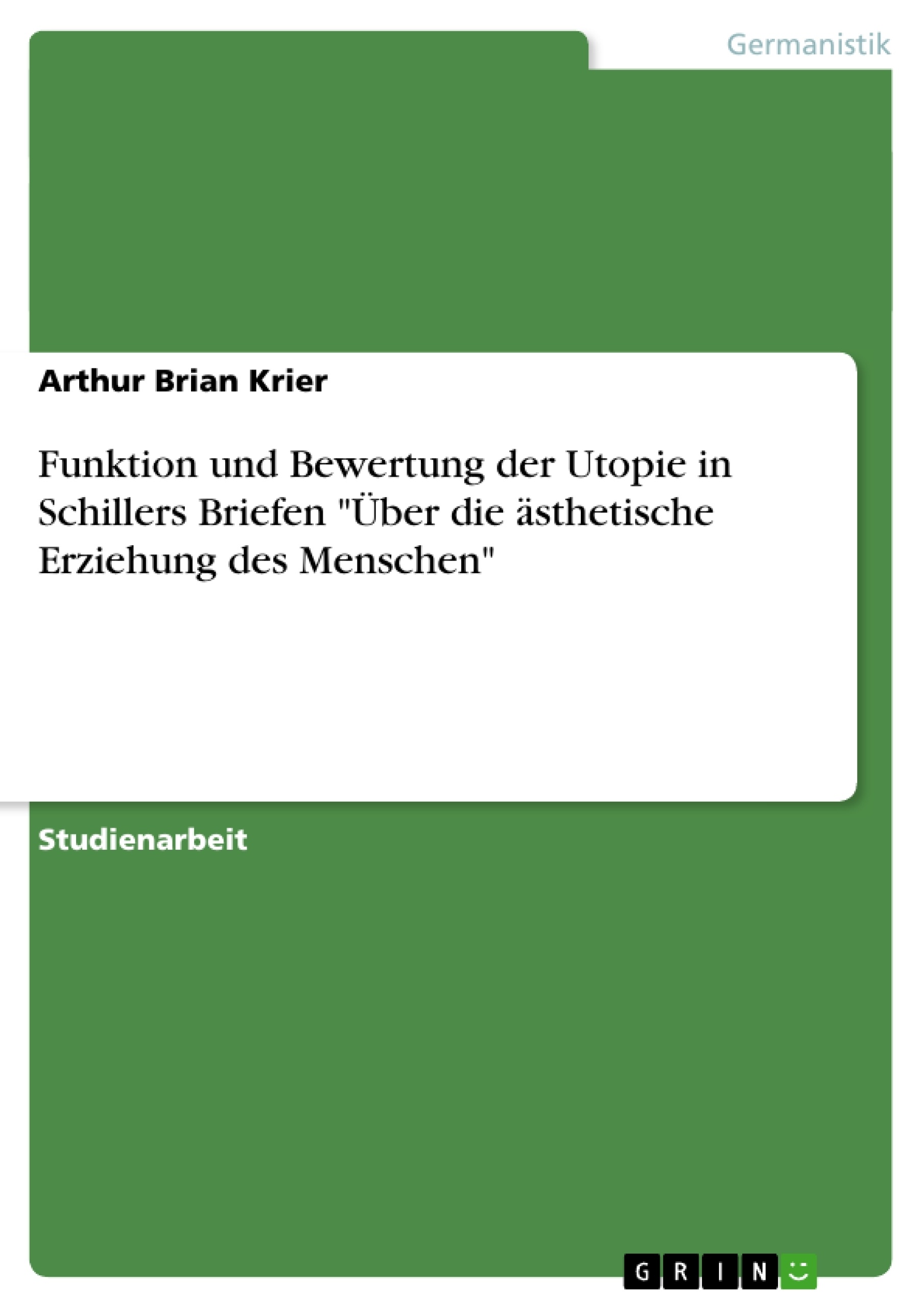Die Briefe „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ von Friedrich Schiller waren anfangs Briefe an den Herzog Friedrich Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg aus dem Jahr 1793. Die erste Veröffentlichung unternahm Schiller jedoch in seiner Zeitschrift „Die Horen“ im Jahr 1795 und fügte die Schrift 1801 unter leichten Abänderungen dem dritten Band seiner „Kleineren prosaischen Schriften“ bei.
Herzog von Augustenburg und Graf Ernst Heinrich von Schimmelmann gewährten dem schwer kranken Schiller eine Pension, die ihn befähigte, finanzieller Not zu entkommen und seinen Studien zur Ästhetik nachzugehen.
Die Briefe über die ästhetischen Erziehung bilden die längste theoretische Schrift Schillers und seiner eigenen Meinung nach auch die bedeutendste. Er will hier zeigen, welche Möglichkeiten in der Kunst stecken, um über die Krise, nämlich der Trennung von Geist und Erfahrungswelt in der Gesellschaft, hinweg zu helfen. Auch Zeitgenossen Schillers wie beispielsweise F. Schlegel, Fichte, Hölderlin und Hegel machten sich um diesen Komplex Gedanken, und meist werden der Schönheit in der Kunst die besten Möglichkeiten zur Vermittlung der beiden Extreme eingeräumt.
Eines der hervorstechenden Merkmale der Schillerschen Herangehensweise ist der utopische Gehalt dieser ästhetischen Vermittlung, welcher unter weiteren Aspekten bereits bei der Veröffentlichung für Aufsehen sorgte. Gegenstand dieser Arbeit soll jene Utopie sein, die verschiedene Reaktionen hervorrief und dies bis heute noch tut. Dabei soll erörtert werden, inwieweit das utopische Element Unachtsamkeit, Widerspruch bzw. Schwäche bedeutet, oder aber vielleicht eine unvermeidbare Begleiterscheinung der Sache selbst ausdrückt, oder gar kalkuliert eingesetztes Programm ist und somit eine Funktion erfüllt und möglicherweise auch eine Stärke in der Argumentation darstellt.
Nach einem sehr kurz gehaltenen Überblick über die Schwerpunkte seiner Theorien, sollen die einzelnen utopischen Elemente herausgearbeitet und in ihrem Zusammenhang beleuchtet werden. Vielleicht kann dadurch bereits mehr Klarheit bezüglich der oben genannten Fragestellung erlangt werden, jedoch wird in einem nächsten Schritt dieser wirklichkeitsfremd anmutende Gegenstand auch im allgemeinen Verhältnis zum Thema und der Methodik der Schrift erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Schillers Schrift
- Schillers Ziel
- Der Spieltrieb
- Die Kunst, der Schein und die Schönheit
- Strukturelle Gliederung
- Die utopischen Bemente
- Theoretischer Ansatzpunkt
- Die göttliche Veranlagung des Menschen
- Die zwei Formen der Schönheit
- Der ästhetische Schein
- Bewertung und Funktion der Utopie
- Zusammenfassung
- Schillers Schrift
- Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem utopischen Gehalt in Schillers Schrift „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“, die in Form von Briefen an den Herzog Friedrich Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg verfasst wurde. Ziel ist es, die Funktion und Bewertung der Utopie in Schillers Werk zu erforschen und zu analysieren, welche Bedeutung sie für sein ästhetisches Konzept hat.
- Die Trennung von Geist und Erfahrungswelt in der Gesellschaft
- Die Rolle der Kunst als Vermittler zwischen Geist und Erfahrung
- Die utopischen Elemente in Schillers Schrift
- Die Funktion und Bewertung der Utopie in Schillers Argumentation
- Der Zusammenhang zwischen Utopie, Ästhetik und dem Menschenbild Schillers
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den Entstehungskontext von Schillers Briefen „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“. Sie führt den Leser in die Thematik ein und skizziert die zentralen Argumente, die im Hauptteil näher beleuchtet werden.
Im Hauptteil wird Schillers Schrift selbst analysiert. Es werden zunächst Schillers Ziel und seine Intentionen in den Briefen erörtert, gefolgt von einer Analyse des Spieltriebs als zentralem Element in Schillers ästhetischem Konzept. Im weiteren Verlauf werden die Kunst, der Schein und die Schönheit sowie die strukturelle Gliederung von Schillers Schrift untersucht.
Anschließend werden die utopischen Elemente in den Briefen behandelt. Es werden der theoretische Ansatzpunkt, die göttliche Veranlagung des Menschen, die zwei Formen der Schönheit und der ästhetische Schein als wesentliche Bestandteile von Schillers utopischem Denken dargestellt.
Im nächsten Schritt werden die Bewertung und Funktion der Utopie in Schillers Briefen beleuchtet.
Der Hauptteil endet mit einer Zusammenfassung der zentralen Argumente und Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Schillers Briefen, "Über die ästhetische Erziehung des Menschen", Utopie, ästhetische Erziehung, Kunst, Schein, Schönheit, Spieltrieb, göttliche Veranlagung, Trennung von Geist und Erfahrung, Gesellschaft, Vermittlung, Funktion, Bewertung
- Quote paper
- Arthur Brian Krier (Author), 2002, Funktion und Bewertung der Utopie in Schillers Briefen "Über die ästhetische Erziehung des Menschen", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/19130