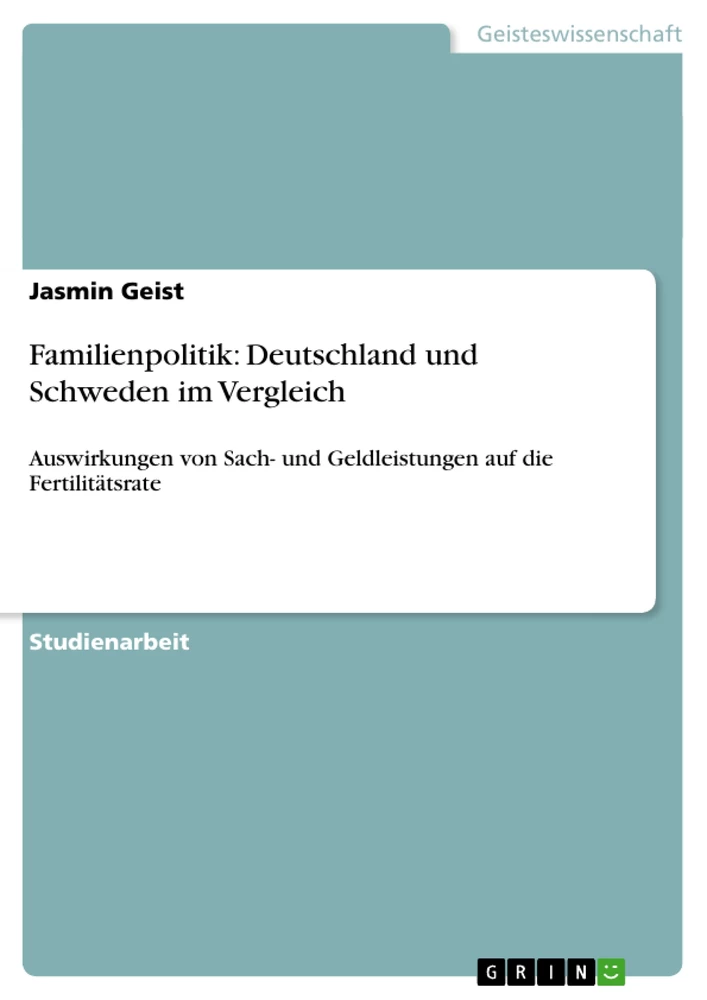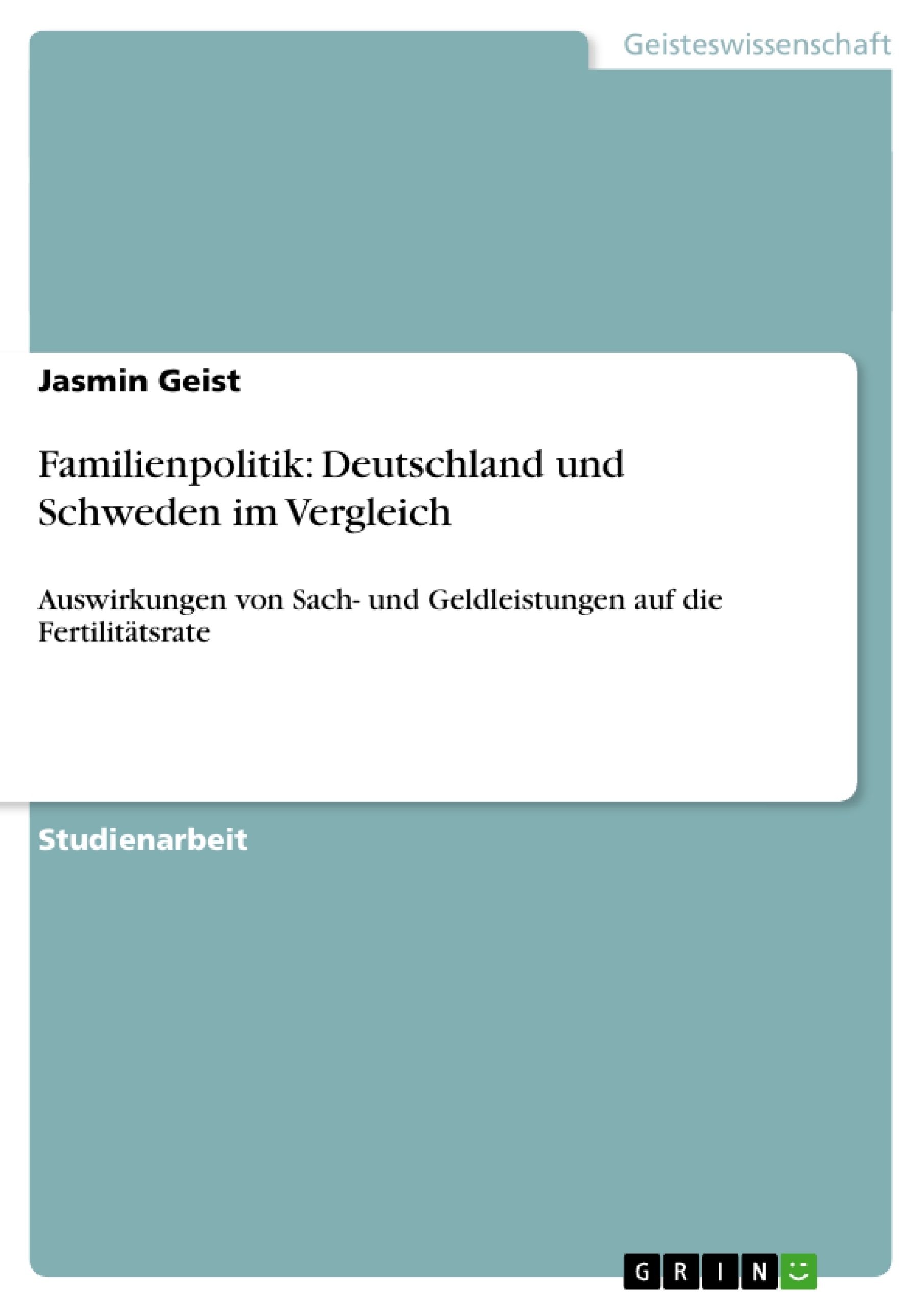These: Die Fertilitätsrate wird durch Sachleistungen effektiver gefördert als durch Geldleistungen.
Der Rückgang der Geburten liegt sicherlich nicht nur daran, dass Frauen im Zeitalter der „Pille“ und der Emanzipation selbst wählen können, ob diese schwanger werden wollen oder nicht. Die heutigen potenziellen Eltern nehmen sich ein Beispiel an der vorherigen Generation, wo sie selbst oft in kinderarmen Familien aufgewachsen sind, wobei ein möglicher Grund hierfür oftmals die fehlende staatliche Unterstützung war. Heute spielen vor allem Konflikte über die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf eine sehr entscheidende Rolle. Gerade junge Mütter möchten ihre Erwerbstätigkeit aus Gründen der Unabhängigkeit und Selbstbestimmung nicht ganz vernachlässigen oder ganz aufgeben. Ängste, wie dass durch ein Kind die berufliche Entwicklung gehemmt wird oder aber dass es keine ausreichende Unterstützung in Form von Kindertagesstätten oder Ganztagesschulen gibt, führen zu einer erheblichen Unsicherheit bei den Frauen.
In Zeiten, wo Paare erst gar nicht mehr heiraten bzw. sich sehr schnell scheiden lassen, entscheiden sich viele Frauen gerade aufgrund der fehlenden gesellschaftlichen Unterstützung gegen ein Kind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Politischer Einfluss auf die familiäre Rollenverteilung im Vergleich Deutschland und Schweden im letzten Jahrhundert
- Familienpolitik und deren Auswirkungen in Deutschland
- Sachleistungen
- Geldleistungen
- Gesetzliche Erziehungszeiten
- Erwerbstätigenquote von Frauen
- Fertilitätsrate
- Familienpolitik und deren Auswirkungen in Schweden
- Sachleistungen
- Geldleistungen
- Gesetzliche Erziehungszeiten
- Erwerbstätigenquote von Frauen
- Fertilitätsrate
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit vergleicht die Familienpolitik Deutschlands und Schwedens mit dem Ziel, den Einfluss staatlicher Unterstützung auf die Fertilitätsrate zu analysieren. Es wird untersucht, ob Sachleistungen im Vergleich zu Geldleistungen effektiver zur Förderung der Geburtenrate beitragen.
- Entwicklung der Familienpolitik in Deutschland und Schweden im letzten Jahrhundert
- Auswirkungen von Sach- und Geldleistungen auf die Fertilitätsrate
- Rolle der Erwerbstätigenquote von Frauen und gesetzlicher Erziehungszeiten
- Vergleich der Familienmodelle in Deutschland und Schweden
- Einfluss der gesellschaftlichen Unterstützung auf die Fertilitätsrate
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert die These, dass Sachleistungen die Fertilitätsrate effektiver fördern als Geldleistungen. Es wird erläutert, dass der Rückgang der Geburtenrate nicht nur durch die zunehmende Emanzipation von Frauen verursacht wird, sondern auch durch die fehlende staatliche Unterstützung. Konflikte zwischen Mutterschaft und Beruf sowie die fehlende gesellschaftliche Unterstützung für Familien werden als wichtige Faktoren für die Entscheidung gegen Kinder identifiziert. Der Vergleich zwischen Deutschland und Schweden soll Aufschluss darüber geben, inwiefern staatliche Unterstützung die Fertilitätsrate beeinflussen kann.
Das zweite Kapitel analysiert den politischen Einfluss auf die familiäre Rollenverteilung in Deutschland und Schweden im letzten Jahrhundert. Dabei wird festgestellt, dass beide Länder strukturelle Ähnlichkeiten aufweisen, jedoch unterschiedliche Ansätze zur Geschlechtergleichstellung und Familienmodellen verfolgten. Deutschland entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg nach dem Modell der Bismarckschen Sozialversicherungen, wobei das duale System sozialer Sicherung die soziale Ungleichheit zwischen Männern und Frauen zementierte. Schweden hingegen entwickelte ein soziales Sicherungssystem, das bereits früh verheiratete, nicht arbeitende Frauen und Mütter einbezog und Hausarbeit als gesellschaftlich wichtige Arbeit anerkannte.
Schlüsselwörter
Familienpolitik, Fertilitätsrate, Sachleistungen, Geldleistungen, Erwerbstätigenquote, Geschlechtergleichstellung, Schweden, Deutschland, Elternurlaub, Sozialpolitik, Familienmodelle, gesellschaftliche Unterstützung, Kinderbetreuung.
- Quote paper
- Jasmin Geist (Author), 2010, Familienpolitik: Deutschland und Schweden im Vergleich , Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/191029