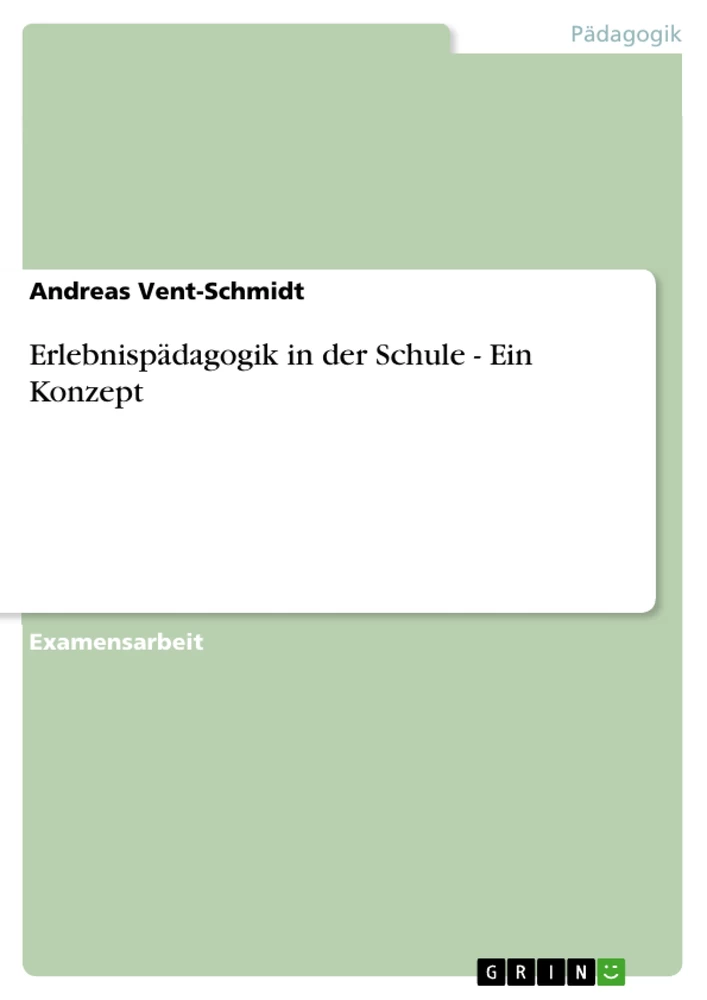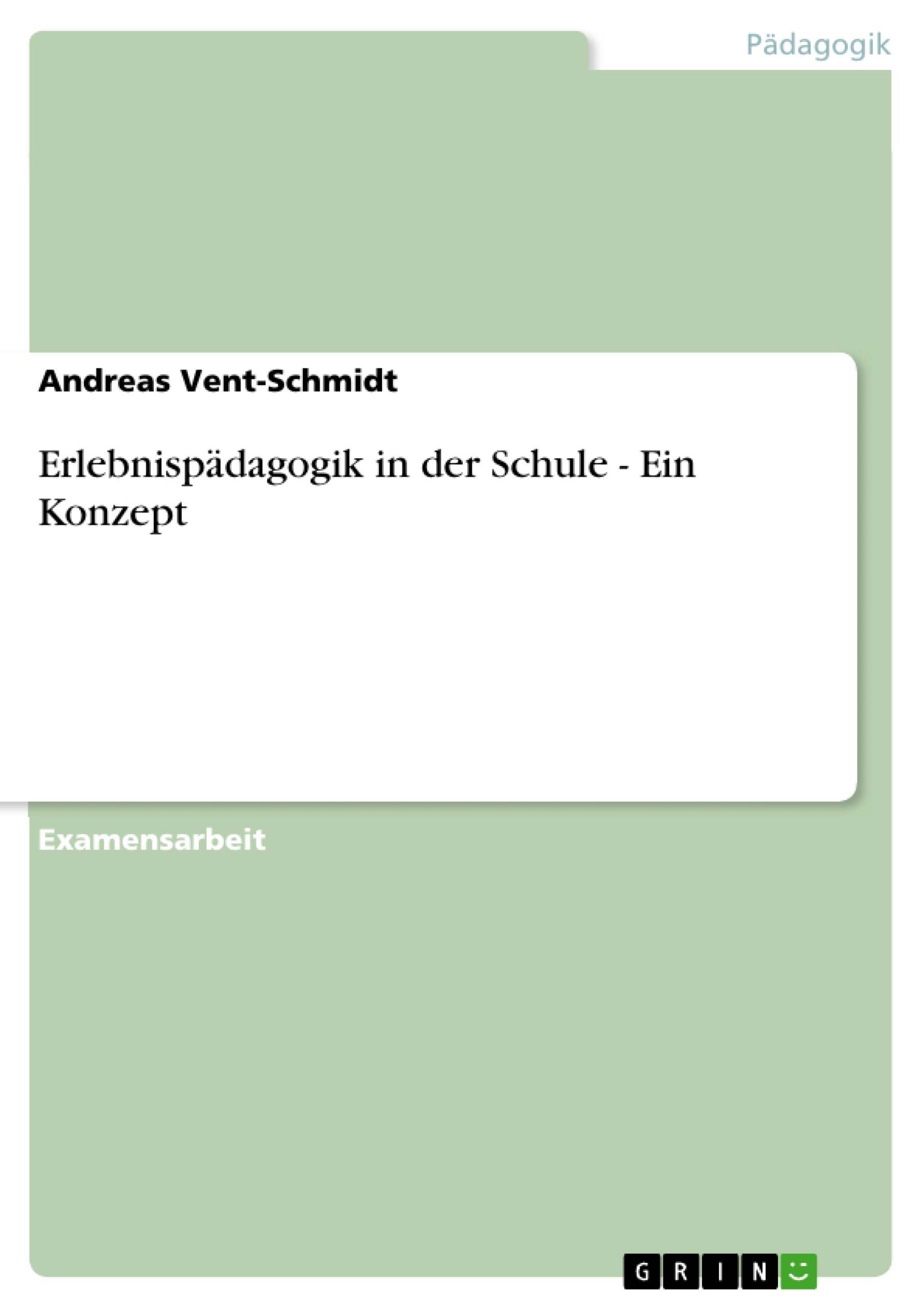„Ich höre und ich vergesse, ich sehe und erinnere mich, ich erlebe und verstehe“.
Konfuzius (551 - 449 v. Chr.)
EP-Programme können Einfluss auf ganze Klassen und Individuen haben. Das persönliche Selbstwertgefühl, der Klassen- und Gruppenzusammenhalt, das Klassenklima, die Kommunikation sowie die Art der Kommunikation, die Zusammenarbeit innerhalb von Gruppen und die Eingliederung von Außenseitern können gestärkt werden. Dies sind nur wenige der möglichen und teils bewusst gesteuerten Ziele und Effekte, die EP haben kann.
In meiner Arbeit werde ich zunächst eine Einführung in die EP geben, im Anschluss daran gibt es einen kurzen geschichtlichen Abriss der Entstehungsgeschichte. Anschließend werde ich die Hauptprinzipien der EP erläutern sowie den Sinn und die Möglichkeiten der EP und des Feedbacks darlegen. Beispiele aus verschiedenen Schulen werden dann Möglichkeiten zu Anwendungsfeldern aufzeigen. Ich möchte hiermit die Basis für erlebnispädagogische Stunden schaffen und alle inhaltlich wichtigen Fragen zur Auswahl, Anpassung und Durchführung von Übungen, sowie die Aufgaben des Spielleiters und Sicherheits- vorkehrungen behandeln. Zudem werde ich noch den konkreten Aufbau einer erlebnispädagogischen Stunde mit Stundenverlaufsplan aufzeigen. Schließlich werde ich ein Konzept präsentieren, aus welchem Lehrer verschiedene erlebnispädagogische Aufgaben auswählen können, um diese dann in der Schule umzusetzen.
Die Aufgaben werden in verschiedene Kategorien gegliedert:
๏ Kennenlernen
๏ Warm-Ups (Wups)
๏ Kooperations- und Kommunikationsaufgaben
๏ Vertrauen
Zu jeder Aufgabe den Titel, darunter Kategorie, Spiel- charakter, Lernziel, Teilnehmerzahl, Altersbereich, Dauer, Ort, Schwier- igkeit und Geräte/Material auflisten, ein Photo oder ein Bild hinzufügen und anschließend die Spielidee, pädagogische Hinweise und Variationsmöglichkeiten darstellen.
Mit dieser Arbeit hoffe ich ein Stück weit dem Interesse und dem Bedarf von Lehrern nachkommen zu können und sie zu ermutigen EP im Schulalltag zu nutzen. Der Einsatz von Erlebnispädagogik in der Schule befindet sich noch in den Kinderschuhen, weitere Möglichkeiten und Effekte sind schwer vorherzusagen und werden erst nach und nach untersucht. Um eine Problemlöseaufgabe erfolgreich zu lösen, braucht es zuerst eine Idee und ein Konzept, diesen Teil möchte ich hiermit übernehmen. Zur Umsetzung fehlt dann nur noch eines - MUT, denn die Erfahrungen kommen von selbst.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- Teil I: Zur Erlebnispädagogik in der Schule
- 2 Erlebnispädagogik - Sportpädagogik
- 3 Einführung in die Erlebnispädagogik
- 4 Entstehung der Erlebnispädagogik
- 5 EP aus der Schule in die Schule
- 6 Lernmodelle
- 6.1 Lernen zwischen Komfort- und Panikzone
- 6.2 Das Flow-Modell
- 6.3 Erlebnisorientierter Lernzyklus
- 7 Wirkungsmodelle
- 7.1 The Mountain speak for Themselves
- 7.2 Kommentiertes Handlungslernen
- 7.3 Outward Bound Plus - das Reflexionsmodell
- 7.4 Direktives Handlungslernen
- 7.5 Metaphorisches Grundmodell
- 7.6 Metaphorisches Handlungslernen
- 7.7 Indirekt-metaphorisches Handlungslernen
- 8 Möglichkeiten der Erlebnispädagogik
- 9 Die Chancen des Feedbacks
- 9.1 Feedbackregeln
- 9.2 Feedback geben
- 9.3 Feedback nehmen
- 10 Reflexion
- 10.1 Reflexions-Fragen
- 10.2 Reflexions-Methoden
- 11 Ausgewählte Beispiele aus der Schule
- 11.1 Internatsschule Salem am Bodensee
- 11.2 Hegau Gymnasium Singen am Hohentwiel
- 11.3 Gymnasium Schloss Gaienhofen am Bodensee
- 11.4 Evangelische Schule am Firstwald, Mössingen
- 12 Konzeption einer erlebnispädagogischen Unterrichtsstunde
- 12.1 Stundenverlauf
- 12.2 Gemeinsame Merkmale von Übungen
- 12.3 Richtige Auswahl von Übungen
- 12.4 Anpassung und Veränderung von Übungen
- 12.5 Rahmenziele
- 12.6 Aufgaben des Spielleiters
- 12.7 Merkmale eines idealen Spielortes
- 12.8 Sicherheitsvorkehrungen
- Teil II: Zur Praxis der Erlebnispädagogik in der Schule
- 13 Spielesammlung
- 13.1 Kennenlernen
- 13.1.1 Schuhhaufen
- 13.1.2 Alle die wo
- 13.1.3 Aufstellen
- 13.2 Warm-Ups (Wups)
- 13.2.1 Alaskian Rugby
- 13.2.2 Atom-Spiel
- 13.2.3 Riesen-Zauberer-Elfen
- 13.2.4 Pferderennen
- 13.2.5 Wäscheklammerklau
- 13.2.6 Drei Kreise
- 13.3 Kommunikations- und Kooperationsaufgaben
- 13.3.1 Baum finden
- 13.3.2 Die Rettung
- 13.3.3 Der Geheime Code
- 13.3.4 Plane falten / Insel
- 13.3.5 Das Haus vom Nikolaus
- 13.3.6 Heißer Draht
- 13.4 Vertrauen
- 13.4.1 Die Welle
- 13.4.2 Maikäferspiel
- 13.4.3 Mattenimbiss
- 13.4.4 Fall vom Kasten
- 14 Beispielprojekt - Erlebnispädagogik in der Schule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, ein Konzept für die Erlebnispädagogik in der Schule zu entwickeln. Es werden verschiedene Lern- und Wirkungsmodelle vorgestellt und an Beispielen aus der Praxis illustriert. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und der Konzeption erlebnispädagogischer Unterrichtsstunden.
- Lernmodelle in der Erlebnispädagogik
- Wirkungsweisen erlebnispädagogischer Maßnahmen
- Konzeption und Durchführung erlebnispädagogischer Stunden
- Beispiele für erlebnispädagogische Praxis in Schulen
- Reflexion und Feedback in der Erlebnispädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Dieses Kapitel dient als Einleitung in die Thematik der Erlebnispädagogik im schulischen Kontext und beschreibt die grundlegende Idee und Zielsetzung der Arbeit.
2 Erlebnispädagogik - Sportpädagogik: Hier wird der Bezug zwischen Erlebnispädagogik und Sportpädagogik hergestellt und die Schnittmengen und Unterschiede der beiden Bereiche beleuchtet. Die Überlappungen im Hinblick auf die Förderung von Kompetenzen und die Nutzung von Bewegung werden wahrscheinlich hervorgehoben.
3 Einführung in die Erlebnispädagogik: Das Kapitel bietet eine umfassende Einführung in das Feld der Erlebnispädagogik, indem es ihre grundlegenden Prinzipien, Ziele und Methoden definiert. Es wird wahrscheinlich eine Abgrenzung zu anderen pädagogischen Ansätzen erfolgen und die zentralen Merkmale der Erlebnispädagogik herausgestellt.
4 Entstehung der Erlebnispädagogik: Die historische Entwicklung der Erlebnispädagogik wird nachgezeichnet, beginnend mit ihren Ursprüngen und der Entwicklung wichtiger Konzepte und Methoden. Es wird vermutlich auf die Einflüsse von Outward Bound und anderen relevanten Strömungen eingegangen.
5 EP aus der Schule in die Schule: Dieser Abschnitt analysiert den Transfer von erlebnispädagogischen Ansätzen aus außerschulischen Bereichen in den Schulkontext. Die Herausforderungen und Möglichkeiten der Integration in den bestehenden Schulalltag werden vermutlich beleuchtet.
6 Lernmodelle: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Lernmodelle, die in der Erlebnispädagogik Anwendung finden. Es werden die jeweiligen theoretischen Grundlagen und ihre praktische Relevanz für den erlebnispädagogischen Prozess im Detail erörtert. Die Kapitel 6.1-6.3 stellen vermutlich unterschiedliche Modelle vor und diskutieren deren Vor- und Nachteile.
7 Wirkungsmodelle: Hier werden verschiedene Modelle der Wirkungsweise erlebnispädagogischer Maßnahmen vorgestellt und kritisch analysiert. Die Kapitel 7.1-7.7 befassen sich wahrscheinlich mit unterschiedlichen theoretischen Ansätzen und deren praktischen Implikationen.
8 Möglichkeiten der Erlebnispädagogik: Dieser Abschnitt befasst sich mit den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Erlebnispädagogik im schulischen Kontext. Wahrscheinlich werden verschiedene Fächer und Lerngruppen betrachtet und mögliche Aktivitäten vorgestellt.
9 Die Chancen des Feedbacks: Das Kapitel widmet sich der Bedeutung von Feedback im erlebnispädagogischen Prozess. Die Kapitel 9.1-9.3 beschäftigen sich wahrscheinlich mit den Regeln, der Durchführung und der Rezeption von Feedback.
10 Reflexion: Die Bedeutung von Reflexion nach erlebnispädagogischen Aktivitäten wird im Detail erläutert. Die Kapitel 10.1 und 10.2 befassen sich wahrscheinlich mit konkreten Fragen und Methoden zur Reflexion.
11 Ausgewählte Beispiele aus der Schule: Dieses Kapitel präsentiert Fallstudien von Schulen, die bereits erfolgreich Erlebnispädagogik in ihren Unterricht integriert haben. Die Kapitel 11.1-11.4 beleuchten wahrscheinlich die jeweiligen Ansätze und Erfahrungen.
12 Konzeption einer erlebnispädagogischen Unterrichtsstunde: Dieser Abschnitt befasst sich mit der konkreten Planung und Durchführung einer erlebnispädagogischen Unterrichtsstunde. Die Kapitel 12.1-12.8 umfassen vermutlich Aspekte wie Stundenverlauf, Übungsauswahl, Anpassung, Sicherheitsvorkehrungen und die Rolle des Lehrers.
13 Spielesammlung: Dieses Kapitel stellt verschiedene erlebnispädagogische Spiele und Übungen vor, kategorisiert nach verschiedenen Zielen (Kennenlernen, Warm-ups, Kooperation, Vertrauen). Die Unterkapitel 13.1-13.4 präsentieren die jeweiligen Spiele und deren didaktischen Möglichkeiten.
14 Beispielprojekt - Erlebnispädagogik in der Schule: Dieses Kapitel präsentiert ein konkretes Beispiel für ein erlebnispädagogisches Projekt an einer Schule.
Schlüsselwörter
Erlebnispädagogik, Schule, Lernmodelle, Wirkungsmodelle, Feedback, Reflexion, Unterrichtsgestaltung, Kompetenzentwicklung, Kooperation, Vertrauen, Praxisbeispiele.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument "Erlebnispädagogik in der Schule"
Was ist der Inhalt des Dokuments "Erlebnispädagogik in der Schule"?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Erlebnispädagogik im schulischen Kontext. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, sowie Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung und der Konzeption erlebnispädagogischer Unterrichtsstunden. Es werden verschiedene Lern- und Wirkungsmodelle vorgestellt und anhand von Praxisbeispielen aus Schulen illustriert. Eine umfangreiche Spielesammlung für verschiedene Zwecke (Kennenlernen, Warm-ups, Kooperation, Vertrauen) ist ebenfalls enthalten.
Welche Lern- und Wirkungsmodelle werden im Dokument behandelt?
Das Dokument beschreibt diverse Lernmodelle der Erlebnispädagogik, darunter das Lernen zwischen Komfort- und Panikzone, das Flow-Modell und den erlebnisorientierten Lernzyklus. Im Bereich der Wirkungsmodelle werden "The Mountain speak for Themselves", kommentierter und direktiver Handlungslernens, das Outward Bound Plus-Reflexionsmodell, sowie metaphorisches und indirekt-metaphorisches Handlungslernen erläutert.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in zwei Hauptteile gegliedert: Teil I befasst sich mit der Erlebnispädagogik in der Schule im Allgemeinen, einschließlich Einführung, Lern- und Wirkungsmodellen, Feedback und Reflexion sowie der Konzeption von erlebnispädagogischen Unterrichtsstunden. Teil II widmet sich der Praxis mit einer umfangreichen Spielesammlung, kategorisiert nach Zielen (Kennenlernen, Warm-ups, Kommunikation, Kooperation, Vertrauen), und einem Beispielprojekt.
Welche Beispiele aus der Schulpraxis werden genannt?
Das Dokument nennt Beispiele von Schulen, die Erlebnispädagogik erfolgreich implementiert haben, darunter die Internatsschule Salem am Bodensee, das Hegau Gymnasium Singen am Hohentwiel, das Gymnasium Schloss Gaienhofen am Bodensee und die Evangelische Schule am Firstwald in Mössingen.
Welche konkreten Spiele und Übungen werden vorgestellt?
Die Spielesammlung umfasst Spiele und Übungen für verschiedene Zwecke: Kennenlernen (Schuhhaufen, Alle die wo, Aufstellen), Warm-ups (Alaskan Rugby, Atom-Spiel, Riesen-Zauberer-Elfen, Pferderennen, Wäscheklammerklau, Drei Kreise), Kommunikations- und Kooperationsaufgaben (Baum finden, Die Rettung, Der Geheime Code, Plane falten/Insel, Das Haus vom Nikolaus, Heißer Draht) und Vertrauensspiele (Die Welle, Maikäferspiel, Mattenimbiss, Fall vom Kasten).
Welche Aspekte der Unterrichtsgestaltung werden behandelt?
Die Konzeption einer erlebnispädagogischen Unterrichtsstunde wird detailliert beschrieben, einschließlich Stundenverlauf, Auswahl, Anpassung und Veränderung von Übungen, Rahmenzielen, Aufgaben des Spielleiters, idealem Spielort und Sicherheitsvorkehrungen.
Welche Rolle spielen Feedback und Reflexion in der Erlebnispädagogik?
Feedback und Reflexion spielen eine zentrale Rolle. Das Dokument beschreibt Feedbackregeln, wie Feedback gegeben und genommen werden sollte und präsentiert Methoden und Fragen zur Reflexion nach erlebnispädagogischen Aktivitäten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Erlebnispädagogik, Schule, Lernmodelle, Wirkungsmodelle, Feedback, Reflexion, Unterrichtsgestaltung, Kompetenzentwicklung, Kooperation, Vertrauen, Praxisbeispiele.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument richtet sich an Pädagogen, Lehrer, Studenten der Pädagogik und alle, die sich für die Anwendung von Erlebnispädagogik in der Schule interessieren.
Wo finde ich weitere Informationen zur Erlebnispädagogik?
Das Dokument selbst bietet eine umfassende Einführung. Für weiterführende Informationen könnten Sie sich an Fachliteratur zur Erlebnispädagogik wenden oder entsprechende Weiterbildungen besuchen.
- Quote paper
- Andreas Vent-Schmidt (Author), 2011, Erlebnispädagogik in der Schule - Ein Konzept, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/190946