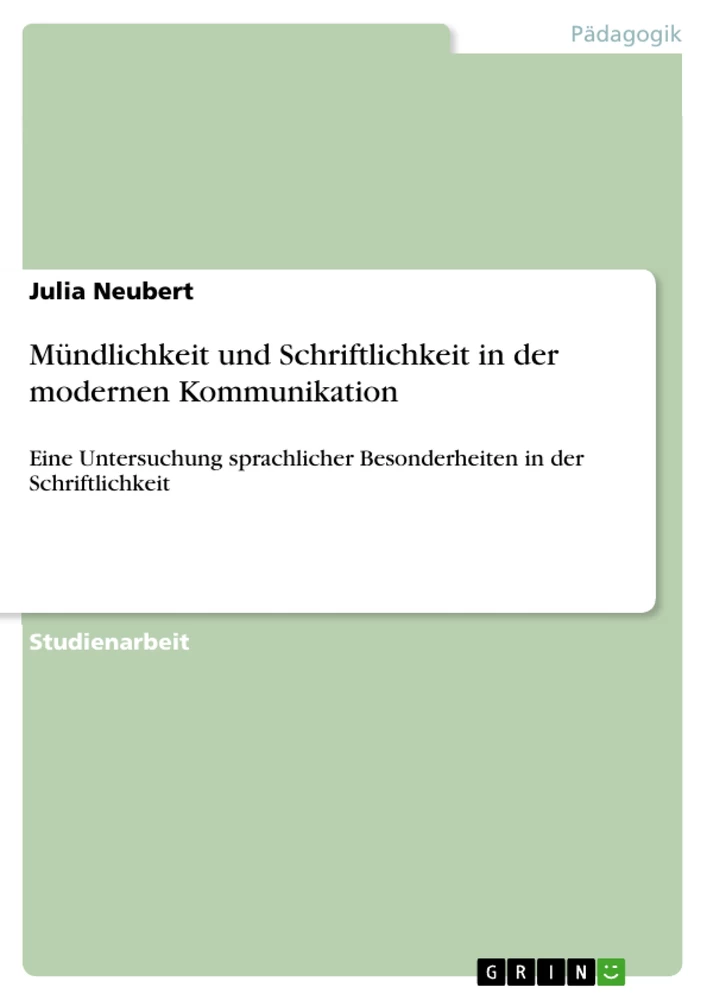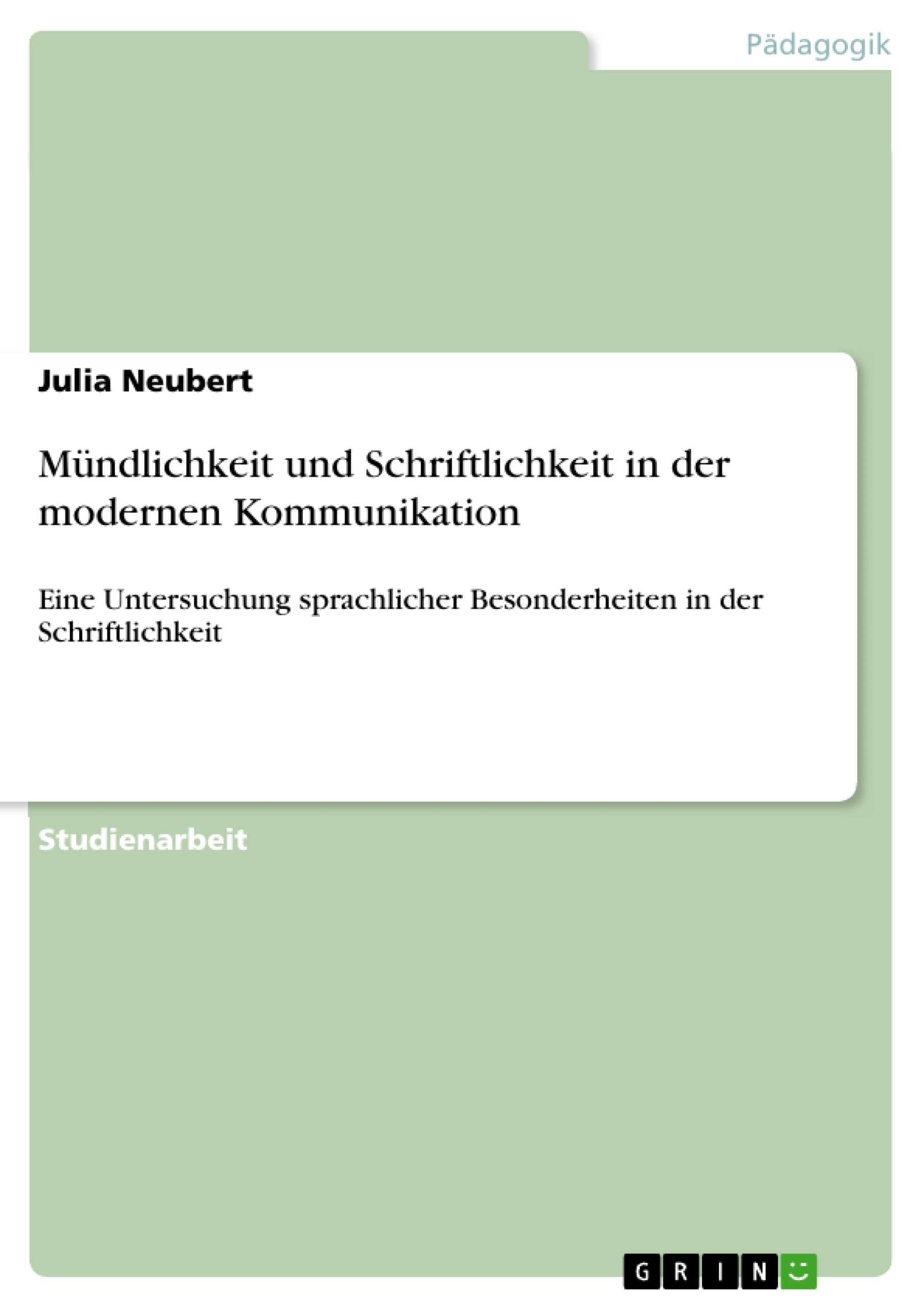1. Einleitung
In meiner Arbeit versuche ich, die Dichotomie von Mündlichkeit und Schriftlichkeit aufzulösen, indem ich auf bestimmte Besonderheiten des Mündlichen eingehe, die zunehmend in modernen Kommunikationsformen, wie der E-Mail, auch im Schriftlichen Gebrauch finden. Da ich mich in die-ser Arbeit nur begrenzt mit der Masse an Phänomenen auseinandersetzen kann, werden hier nur verschiedene Schwerpunkte aufgegriffen, an Beispie-len verdeutlicht und deren Vorkommen erläutert. Die Forschungsliteratur ist trotz der eher jungen Thematik dicht und dennoch habe ich mich für die Ar-beit an diesem Thema auf drei Hauptwerke beschränkt. Hauptsächlich nutz-te ich Yvonne Beutners „E-Mail-Kommunikation“, Weingartens „Sprach-wandel durch Computer“, so wie Kochs und Oesterreichers „Schriftlichkeit und Sprache“. Letzteres bildet für mich den Rahmen der Arbeit und dient in jedem Punkt als Referenz und ‚Roter Faden’, da es in dieser nicht um E-Mail-Kommunikation an sich, sondern um den Bezug zur Mündlichkeit und die Verwischung der Grenzen von mündlich und schriftlich gehen soll. Zu diesem Zweck beruht das Korpus auf E-Mails von Freunden und Familie, die Phänomene aufwiesen, welche für die E-Mail-Kommunikation charakte-ristisch sind.
2. Mündlichkeit und Schriftlichkeit
Um die sprachlichen Auffälligkeiten in der E-Mail-Kommunikation ange-messen untersuchen und korrekt deuten zu können, sollte zunächst erfragt werden, wie diese eigentlich zustande kommen. So ergeben sich doch Auf-fälligkeiten nur aus Abweichungen von einem Normwert. In diesem Fall sind solche Normierungen an das Medium der Schriftlichkeit geknüpft, was bedeutet, sie lassen einen bestimmten Stil, verschiedene Formeln und eine gewisse äußere Form vermuten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Mündlichkeit und Schriftlichkeit
- 3. Der neue „Wortschatz“ der E-Mail-Kommunikation
- 3.1 Anglizismen und Neologismen
- 3.1.1 Akronyme – Ein kleiner Exkurs
- 3.2 Emulierte Prosodie, Comic-Sprache und Ideogramme – Die richtige Übermittlung von Aussagen mit Hilfe graphostilistischer Mittel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verschmelzung von mündlicher und schriftlicher Sprache in der E-Mail-Kommunikation. Ziel ist es, die traditionelle Dichotomie zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit aufzuzeigen und anhand von Beispielen aus einem Korpus privater E-Mails zu belegen, wie mündliche Sprachmerkmale in schriftlichen Texten auftreten. Die Analyse konzentriert sich auf die Auswirkungen moderner Kommunikationsmedien auf die Sprache.
- Untersuchung der Merkmale mündlicher Sprache in E-Mails
- Analyse des Einflusses von Anglizismen und Neologismen
- Beschreibung graphostilistischer Mittel zur Kompensation des Mangels an prosodischen Elementen in schriftlicher Kommunikation
- Diskussion des Modells von Medium und Konzeption zur Beschreibung der Sprachlichen Äußerungen
- Bewertung der traditionellen Dichotomie von Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Kontext der digitalen Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung erläutert die Zielsetzung der Arbeit: die Auflösung der Dichotomie zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit anhand von Beispielen aus der E-Mail-Kommunikation. Es wird betont, dass die Arbeit sich aufgrund des Umfangs des Themas auf ausgewählte Schwerpunkte konzentriert und sich auf drei Hauptwerke der Forschungsliteratur stützt: Beutners „E-Mail-Kommunikation“, Weingartens „Sprachwandel durch Computer“ und Kochs und Oesterreichers „Schriftlichkeit und Sprache“. Letzteres dient als theoretischer Rahmen und Referenzpunkt für die Analyse, deren Fokus auf dem Bezug zur Mündlichkeit und der Verwischung der Grenzen zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache liegt. Der verwendete Korpus besteht aus E-Mails von Freunden und Familie.
2. Mündlichkeit und Schriftlichkeit: Dieses Kapitel untersucht die sprachlichen Auffälligkeiten in der E-Mail-Kommunikation im Vergleich zu den Normen schriftlicher Sprache. Es werden die Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache herausgestellt, insbesondere hinsichtlich Stil, Formelhaftigkeit, Syntax, Kohäsion und sprachlicher Sorgfalt. Die traditionelle Dichotomisierung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit wird als überholt dargestellt, da moderne Kommunikationsmedien wie E-Mails, SMS und Internet-Chats diese Grenzen verwischen. Das Kapitel stellt das Modell von Medium und Konzeption von Oesterreicher und Koch vor, welches die Unterscheidung zwischen Medium (mündlich/schriftlich) und Konzeption (mündlich/schriftlich) vornimmt und somit eine Skalierung von konzeptionell mündlich bis konzeptionell schriftlich ermöglicht. Sprache der Nähe und Sprache der Distanz werden als gegensätzliche Pole definiert, die aber in modernen Kommunikationsformen kombiniert auftreten können. Das Kapitel betont die Bedeutung der Analyse solcher „gegenläufigen Kombinationen“ für das Verständnis von kulturgeschichtlichen, pragmatischen und sprachhistorischen Veränderungen.
3. Der neue „Wortschatz“ der E-Mail-Kommunikation: Dieses Kapitel analysiert den Wortschatz der E-Mail-Kommunikation, insbesondere Anglizismen und Neologismen. Es wird die Fehlinterpretation dieser Sprachmerkmale als reine Jugendsprache kritisiert, da sie in der digitalen Kommunikation von einer breiten Nutzergruppe verwendet werden. Es werden Beispiele für Wortneuschöpfungen, Anglizismen und phonetische Darstellungen englischsprachiger Begriffe untersucht. Ein Unterkapitel widmet sich Akronymen als Zeitsparmittel in der virtuellen Kommunikation. Das Kapitel schließt mit der Vermutung, dass der Gebrauch von Anglizismen und ähnlichen Sprachformen dazu dient, Texte zu verkürzen und gleichzeitig durch ihren Unterhaltungswert das Interesse des Empfängers zu erhalten. Das Kapitel erläutert auch die Verwendung von graphostilistischen Mitteln wie Großschreibung zur Emulation prosodischer Elemente in der schriftlichen Kommunikation, um die Übermittlung von Aussagen zu verbessern und Missverständnisse zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Mündlichkeit, Schriftlichkeit, E-Mail-Kommunikation, Anglizismen, Neologismen, Akronyme, graphostilistische Mittel, Medium, Konzeption, Sprache der Nähe, Sprache der Distanz, Sprachwandel, digitale Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Verschmelzung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der E-Mail-Kommunikation"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Verschmelzung von mündlicher und schriftlicher Sprache in der E-Mail-Kommunikation. Sie analysiert, wie Merkmale mündlicher Sprache in schriftlichen E-Mails auftreten und welche Auswirkungen moderne Kommunikationsmedien auf die Sprache haben.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte, darunter die Merkmale mündlicher Sprache in E-Mails, den Einfluss von Anglizismen und Neologismen, die Verwendung graphostilistischer Mittel zur Kompensation von fehlenden prosodischen Elementen, das Modell von Medium und Konzeption zur Beschreibung sprachlicher Äußerungen und die Bewertung der traditionellen Dichotomie von Mündlichkeit und Schriftlichkeit im digitalen Kontext.
Welche Forschungsliteratur wird herangezogen?
Die Arbeit stützt sich auf drei Hauptwerke: Beutners „E-Mail-Kommunikation“, Weingartens „Sprachwandel durch Computer“ und Kochs und Oesterreichers „Schriftlichkeit und Sprache“. Letzteres dient als theoretischer Rahmen für die Analyse.
Welcher Korpus wird verwendet?
Der verwendete Korpus besteht aus E-Mails von Freunden und Familie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus drei Hauptkapiteln: Einleitung, Mündlichkeit und Schriftlichkeit, und Der neue „Wortschatz“ der E-Mail-Kommunikation. Das dritte Kapitel enthält ein Unterkapitel zu Akronymen.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Auflösung der Dichotomie zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit anhand von Beispielen aus der E-Mail-Kommunikation. Sie nennt die drei Hauptwerke der Forschungsliteratur und beschreibt den verwendeten Korpus.
Was wird im Kapitel „Mündlichkeit und Schriftlichkeit“ behandelt?
Dieses Kapitel untersucht sprachliche Auffälligkeiten in E-Mails im Vergleich zu Normen schriftlicher Sprache. Es hebt Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache hervor und präsentiert das Modell von Medium und Konzeption von Oesterreicher und Koch.
Was wird im Kapitel „Der neue „Wortschatz“ der E-Mail-Kommunikation“ behandelt?
Dieses Kapitel analysiert den Wortschatz der E-Mail-Kommunikation, insbesondere Anglizismen, Neologismen und Akronyme. Es diskutiert die Verwendung graphostilistischer Mittel zur Kompensation prosodischer Elemente.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mündlichkeit, Schriftlichkeit, E-Mail-Kommunikation, Anglizismen, Neologismen, Akronyme, graphostilistische Mittel, Medium, Konzeption, Sprache der Nähe, Sprache der Distanz, Sprachwandel, digitale Kommunikation.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, die traditionelle Dichotomie zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit aufzuzeigen und anhand von Beispielen aus einem Korpus privater E-Mails zu belegen, wie mündliche Sprachmerkmale in schriftlichen Texten auftreten. Die Analyse konzentriert sich auf die Auswirkungen moderner Kommunikationsmedien auf die Sprache.
- Quote paper
- Julia Neubert (Author), 2011, Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der modernen Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/190781