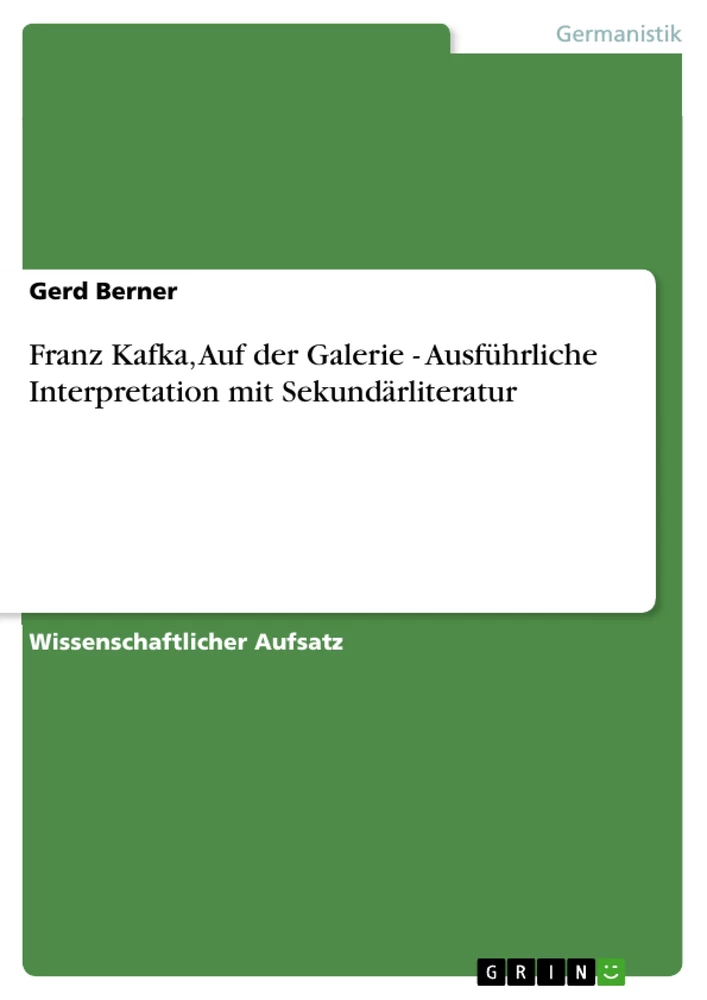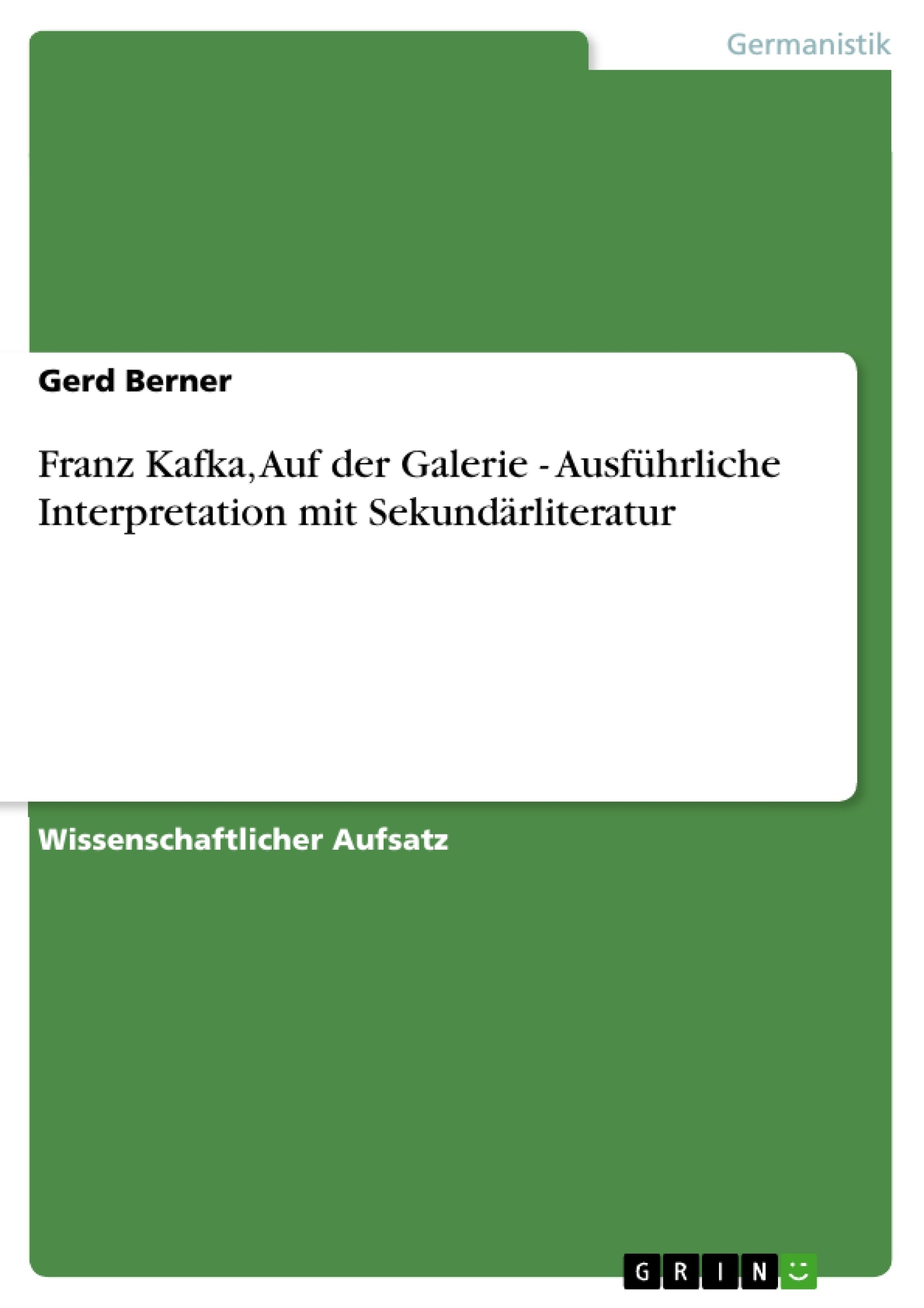Um ungeübten Lesern das Verständnis zu erleichtern, habe ich den nur aus zwei Satzgefügen bestehenden Text entsprechend der syntaktischen Kohärenz neu gegliedert. Das erste Bild umfasst zwei Konditional-sätze, diese sind durch satzwertige Partizipialgefüge, adverbiale Bestimmungen und einen attribuierten Relativsatz erweitert. der ab-schließende 1. Hauptsatz hat drei Prädikatskerne. Das zweite Bild be-ginnt mit einem negierten Kausalsatz, der, narratologisch gesehen, keine Figuren-, sondern Erzählerrede ist. Es folgen ein Kausalsatz ohne Einleitewort mit der Dame als Subjekt und 11 Kausalsätze mit dem Direktor als Subjekt, alle ohne erkennbare Konjunktion und z.T, auch zu ergänzendem Subjekt. Nach einem Temporalsatz wieder mit Dame als Subjekt folgt nach einem erneuten Kausalsatz endlich der zweite Hauptsatz mit zwei Prädikatskernen, einem satzwertigen Partizipial-gefüge und einem erweiterten Infinitiv.In beiden Bildern wird der gleiche Vorgang erzählt. Da der Text aber nicht "Drunten in der Manege", sondern "Auf der Galerie" betitelt ist, ist der Bezugspunkt meiner Analyse die Perspektivfogur des Galeriebesuchers. Der Dar-stellungsmodus der im 1. Bild gesehenen wahren Realität der Zirkus-welt ist der Irrealis: wenn die dargestellte Welt durchschaut würde, dann hülfe das Ich vielleicht. Durch den Modus Indikativ im 2. Bild wird die gesehene Welt aber als scheinbar glücklich empfunden, sie wird nicht durchschaut, sondern nur als realer Schein geschaut. Weil der trügerische Schein sich realiter darstellt als Illusion einer scheinbar glücklichen Welt, ist das Ich unfähig, die wahre Welt hinter der sich als wahr ausgebenden Fassade zu erkennen. Ich habe das Tertium comparationis so erklärt: Die Parabel thematisiert das Leiden des Menschen in einer Welt, in der er wegen der schwierigen Unterscheidung von Wahrheit und Lüge nicht handelt.
Inhaltsverzeichnis
- Franz Kafka „Auf der Galerie“
- Versuch einer Interpretation – für Schüler und Studenten
- Die beiden Bilder
- Der Modus
- Textimmanente Interpretation
- Textexterne Interpretation
- Antinomie oder Paradoxie?
- Über Kafkas Weltdarstellung hinaus?
- Textimmanente und textexterne Methoden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text verfolgt das Ziel, eine umfassende Interpretation der Kurzgeschichte "Auf der Galerie" von Franz Kafka zu liefern, die speziell auf Schüler und Studenten zugeschnitten ist. Die Analyse konzentriert sich auf die beiden zentralen Bilder der Geschichte, die syntaktische Kohärenz, die Modi und die unterschiedlichen Interpretationsansätze.
- Die Darstellung der Zirkuswelt in zwei unterschiedlichen Bildern
- Die Analyse der syntaktischen Struktur und der Modi als Mittel der Interpretation
- Die Unterscheidung zwischen textimmanenten und textexternen Interpretationsansätzen
- Die Interpretation der Antinomie zwischen den beiden Bildern als Paradoxie
- Die kritische Auseinandersetzung mit möglichen übergreifenden Deutungen der Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Analyse befasst sich mit den beiden Bildern der Geschichte, die durch zwei verschiedene Satzgefüge dargestellt werden. Das erste Bild zeigt eine kranke Kunstreiterin, die in einer entwürdigenden Situation von einem unmenschlichen Direktor und einem apathischen Publikum durch die Manege getrieben wird. Dieses Bild wird im Konjunktiv II dargestellt, was auf seine Irrealität hinweist. Der zweite Teil beschreibt die Vorstellung einer schönen Dame, die vor einem väterlichen Direktor und einem begeisterten Publikum ihre Reitkunst zeigt. Dieser Teil wird im Indikativ dargestellt, was auf seine vermeintliche Realität hinweist. Der Text analysiert die syntaktische Kohärenz und die Modi als Mittel der Interpretation und untersucht die Bedeutung der beiden Bilder für das Verständnis der Geschichte.
Der zweite Teil befasst sich mit der Frage, ob die beiden Bilder als Antinomie oder Paradoxie interpretiert werden sollten. Der Text stellt verschiedene philosophische Definitionen dieser Begriffe dar und argumentiert, dass die Geschichte eher als Paradoxie zu verstehen ist, da sie eine scheinbar widersprüchliche Situation darstellt, die dennoch einen tiefen Sinn vermittelt. Der Text diskutiert auch verschiedene interpretatorische Ansätze, die über die textimmanente Interpretation hinausgehen und die Geschichte in einen größeren Kontext einordnen, wie zum Beispiel existenzielle, religiöse, sozialkritische und biographische Interpretationen.
Der dritte Teil behandelt die Unterscheidung zwischen textimmanenten und textexternen Interpretationsmethoden. Der Text erklärt, dass textimmanente Methoden den literarischen Text als autonomes Kunstwerk betrachten, dessen Bedeutung aus der Analyse der Textformanten gewonnen werden kann. Textexterne Methoden hingegen beziehen den Text in einen größeren Kontext ein, wie zum Beispiel in den Kontext der Biographie des Autors, der historischen und gesellschaftlichen Verhältnisse oder der literarischen Tradition. Der Text zeigt, dass beide Ansätze wertvolle Erkenntnisse über das Werk liefern können.
Schlüsselwörter
Die Kurzgeschichte "Auf der Galerie" von Franz Kafka beschäftigt sich mit Themen wie Irrealität und Scheinrealität, Entfremdung, Macht und Ohnmacht, sowie der Schwierigkeit, die wahre Realität hinter einer scheinbar wahren Fassade zu erkennen. Zentrale Elemente der Geschichte sind die beiden Bilder der Zirkuswelt, die syntaktische Kohärenz, die Modi, die Antinomie oder Paradoxie und die verschiedenen Interpretationsansätze. Die Analyse konzentriert sich insbesondere auf die textimmanente Interpretation des Textes und die Bedeutung der Textformanten für die Entdeckung der tieferen Bedeutung der Geschichte. Der Text beleuchtet außerdem die Unterschiede zwischen textimmanenten und textexternen Interpretationsmethoden und diskutiert die Relevanz beider Ansätze für das Verständnis des Werkes.
- Arbeit zitieren
- M.A. Gerd Berner (Autor:in), 2012, Franz Kafka, Auf der Galerie - Ausführliche Interpretation mit Sekundärliteratur, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/189456