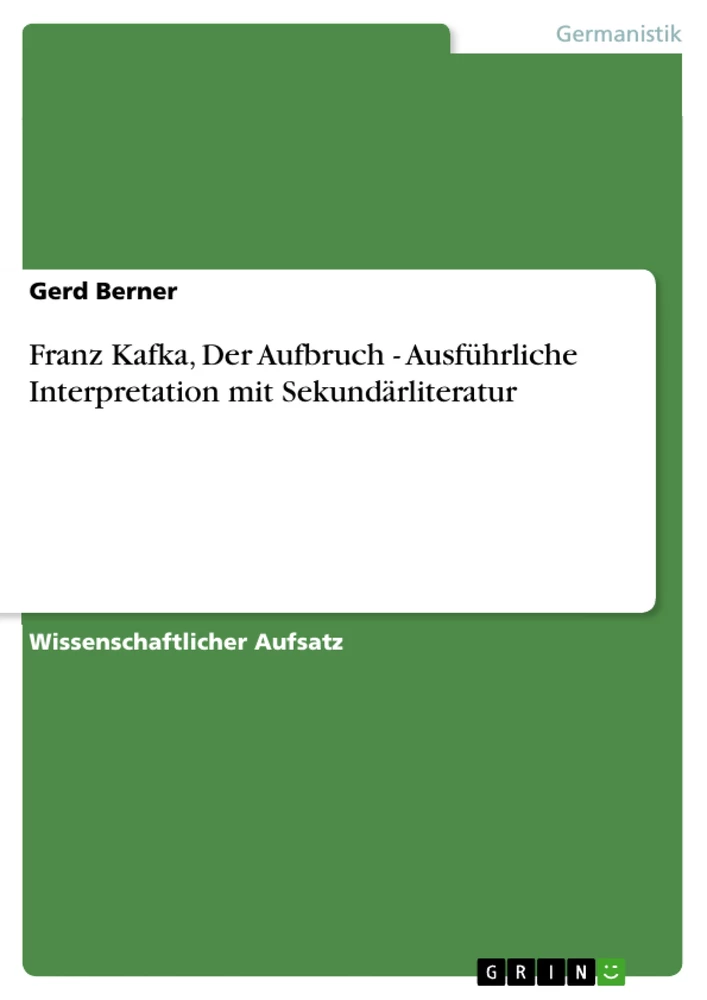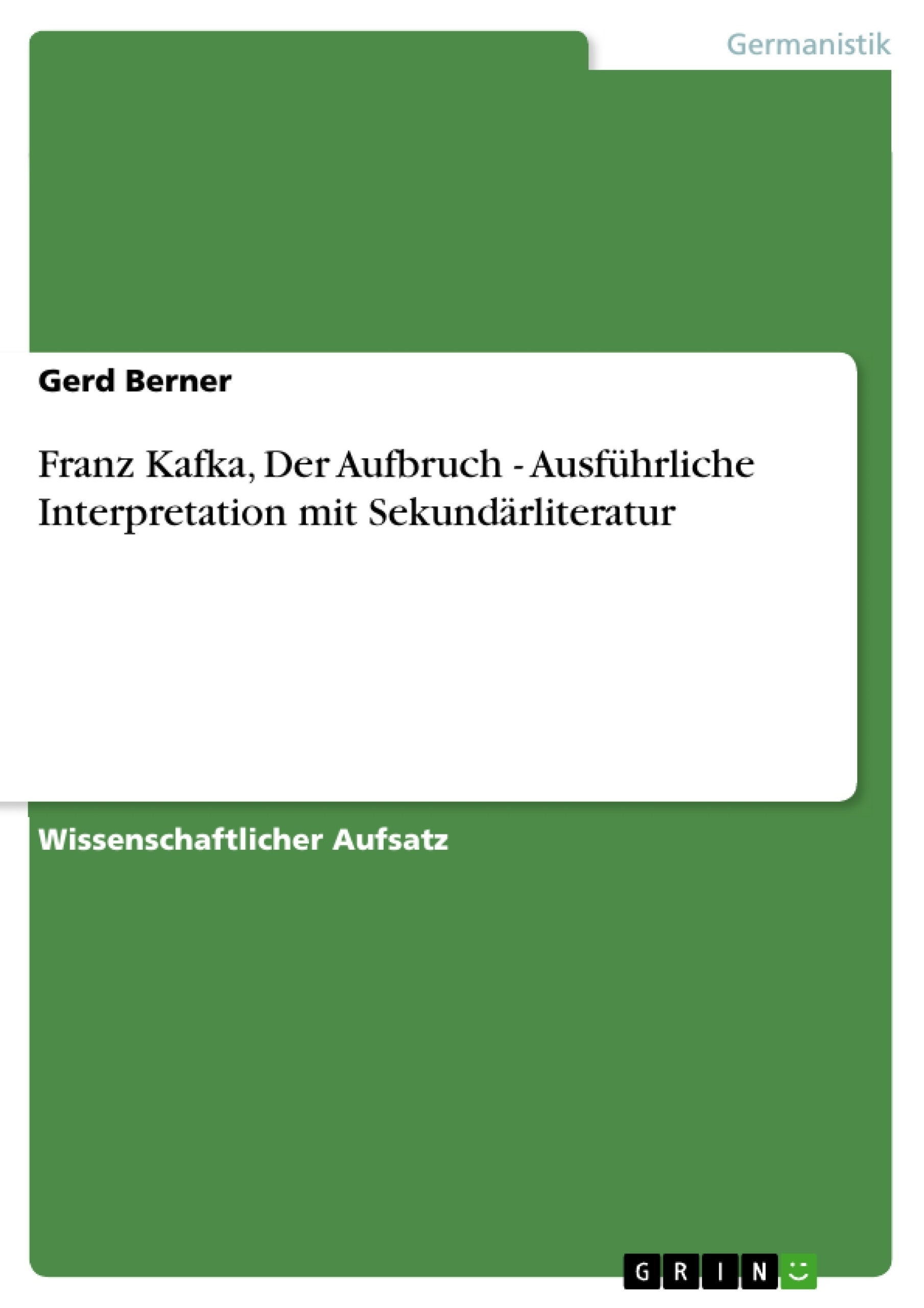Ich stütze mich bei meiner Analyse auf den im Vergleich zur Brod-schen Edition erweiterten Text von Paul Raabe. Das erzählte Gesche-hen kreist vordergründig um den Abschied eines Herrn von seiem Diener. Der erzählte Ort wird im Dialog der beiden erzählten Figuren Herr und Diener lediglich mit dem Adverb "hier" bezeichnet. Der Inhalt der Erzählung besteht aus einer vom Diener nicht befolgten Anweisung des Ich-Erzählers, aus der Reaktion des Protagonisten und dem sich anschließenden Dialog zwischen Diener und dem inzwischen aufgesessenen Herrn. Figurenunabhängige Ereignisse treten nicht ein. Da ein auktorialer Erzähler fehlt, liegt personales Erzählverhalten vor. Das Fehlen aller Formen der stummen Rede lässt als Erzählper-spektive eine reine Außensicht erkennen. Unbenannt bleibt im Text das Ziel des Aufbruchs, der Ich-Erzähler bekräftigt es aber viermal mit der Umschreibung "weg von hier". Die Entfernung von "hier" deute ich als Ziel in der Ferne, weil ja nur der Ich-Erzähler den Trompe-tenschall in der Ferne gehört hat; aus meiner Sicht ist er daher ein Gerufener, vielleicht auch ein Berufener. Ich sehe mich darin durch die Parabel "Läufst du immerfort vorwärts" bestärkt, in der aus einer unveränderlichen dunklen Ferne dem Du ein Wagen kommt. Der Leser erfährt nicht, wohin genau der zielgerichtete Weg des Ich-Erzählers führt und ob er sein Ziel unbeschadet erreicht. Meine Deutung heißt "Versuch einer Interpretation" auch deshalb, weil ich an dem Aufsatz von U. Gaier "Chorus of lies - on interpreting Kafka" mit den dort vorgestellten, z.T. konträren Auslegungen einem Plura-lismus toleranter Interpretationen das Wort rede. Ich deute den Auf-bruch ins Ungewisse mit von mir gefundenen biographischen Entspre-chungen als Wege-Topos, als Bild des Lebenslaufes, wissend, dass nach Gaier mein begrenzter Zugriff auch nur e i n e Stimme in dem Chor sein kann.
Inhaltsverzeichnis
- Ich befahl mein Pferd aus dem Stall zu holen.
- Der Text ist wohl im Frühjahr 1922 entstanden und nicht von Kafka selbst, sondern von Max Brod veröffentlicht worden, aus dem handschriftlichen Nachlass zusammen mit anderen Texten unter „Titeln, die vom Herausgeber stammen.“
- Die Parabel handelt, um mit einem Romantitel Martin Gregor-Dellins aus dem Jahr 1969 zu sprechen, von einem „Aufbruch ins Ungewisse“.
- Es gibt zwei erzählte Figuren, das Ich und den Diener.
- Ich paraphrasiere zunächst kurz den Inhalt der Parabel: Der Ich-Erzähler befiehlt dem Diener, sein Pferd zu satteln.
- Dem gegenüber wirkt der Ich-Erzähler sehr aktiv: er befiehlt, geht selber, hört das, was der Diener nicht hört, und er macht sich auf den Weg - „weg von hier“ (Z. 5).
- Das Demonstrativpronomen „das“ ist Subjekt zu dem Prädikatsnomen „mein Ziel“.
- Der Ich-Erzähler aber weiß, dass auf dem Weg, den er vor sich hat, seine Rettung vor dem Verhungern nicht von einem Essvorrat abhängt.
- Zu der Brodschen Erstveröffentlichung von 1936, wo der gleiche Text auch steht, gibt es einige Abweichungen.
- Zu der Partikel „weg“ schreibt der Duden, „in der Bedeutung von einer Stelle weg und auf ein Ziel zu“ könne „fort gewöhnlich mit weg ausgetauscht werden.❝
- In einer anderen, überschriftlosen Parabel, die mit „Läufst du immerfort vorwärts“ beginnt, verwendet der Narrator auch den Wortstamm, ziel'.
- Ein solcher zielgerichteter Weg zu einer im Hier nicht erreichbaren Befindlichkeit scheint mir auch die „wahrhaft ungeheuere Reise“ (Z. 10/ 11) zu sein.
- Aber dennoch sagt der Ich-Erzähler, diese Reise gerate ihm „zum Glück“ (Z. 10).
- Für den Hierbleibenden scheint die Reise unverständlich, für den aufbrechenden Ich-Erzähler dagegen steht hinter der dem Diener seltsam erscheinenden „Weg-von-hier“ (Z. 7) Formulierung die mit seiner Wirklichkeit übereinstimmende einzige Möglichkeit, sein angestrebtes Ziel auf eben diesem Wege zu erreichen.
- Der Narrator sagt nicht, wohin der zielgerichtete Weg den Ich-Erzähler führen wird.
- Soweit meine Deutung. Es gibt einen interessanten Aufsatz von Ulrich Gaier mit dem verwirrenden Titel „Chorus of lies - on interpreting Kafka\", anhand dessen ich die These des mittlerweile emeritierten Konstanzer Germanisten belegen möchte, viele Deutungen Kafkas thematisierten nur seine „Unauflösbarkeit❝.
- In der ersten Gruppe stellt er (sich) eine biblische ( allegorische) Auslegung vor, bei der es neben dem „initialen“, anfänglichen Leseverständnis im Text Signale geben muss, welche diesem eine über das Wörtliche hinausgehende „Verstehens-aufforderung\" verleihen, „der Leser wird aufgefordert, sich nicht mit einem einfachen, wörtlichen Verständnis zufrieden zu geben, sondern eine zweite Bedeutung zu suchen.“
- Danach konstruiert Gaier eine geschichtsphilosophische Auslegung.
- Die marxistische Auslegung, so Gaier, sehe den Künstler „in der spätbürgerlichen Phase\", deren „politische und ökonomische Struktur so überwältigend starr und drü-ckend geworden“ sei, dass der Herr = der Künstler unmöglich bleiben könne, da „jede Verbindung zwischen der Kunst und einer solchen Wirklichkeit [i. e. einer bour-geoisen] schädlich für das Wesen der Kunst“ sei.
- Leibfried rezitiert danach eine von Gaier als philosophische, psychologische und theologische Auslegung überschriebene Textpassage leider so verkürzt, dass ich mir davon kein rechtes Bild machen und sie daher auch nicht referieren kann.
- Gaier nennt Kafkas eigene Überlegungen als Ursprung seiner gewählten, anfangs etwas provokant wirkenden Überschrift und zitiert ihn aus dem Nachlass: „Das, was man ist, kann man nicht ausdrücken, denn dies ist man eben: mitteilen kann man nur das, was man nicht ist, also die Lüge. Erst im Chor mag eine gewisse Wahrheit liegen.“
- Ich will deshalb nur eine kleine „Lüge“ beisteuern, wohl wissend nach Gaiers Ausführungen, dass auch zutreffende, von mir gefundene biographische Entspre-chungen nur eine Stimme in dem „Chor“ sein können.
- Ich bin geneigt, den „Aufbruch“, das „Weg-von-hier“, als den Beginn eines Wander-Weges, als Topos zu begreifen, als ein vorgeprägtes Bild.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text „Franz Kafka, Der Aufbruch“ von Gerd Berner bietet eine Interpretation der gleichnamigen Parabel Kafkas, die für Schüler und Studenten gleichermaßen zugänglich sein soll. Das Werk befasst sich mit der Analyse der sprachlichen Gestaltung, der Figuren und dem Erzählverhalten in Kafkas Parabel. Es zeichnet sich durch eine klare, akademisch geprägte Sprache aus und beleuchtet die Thematik des Aufbruchs und der Reise ins Ungewisse.
- Analyse der sprachlichen Besonderheiten der Parabel
- Interpretation der Figuren und ihrer Handlungen
- Untersuchung des Erzählverhaltens und der Perspektive des Ich-Erzählers
- Bedeutung des Topos „Weg-von-hier“
- Mehrdeutigkeit und Pluralismus der Interpretationen Kafkas
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beschreibt die Handlung der Parabel und stellt die beiden Figuren, den Ich-Erzähler und den Diener, sowie den knappen erzählten Ort und Zeit vor.
- Im zweiten Kapitel wird die sprachliche Gestaltung analysiert und die Dominanz der Figurenrede gegenüber dem Erzählerbericht herausgestellt.
- Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Interpretation der Figuren, insbesondere mit der Aktivität des Ich-Erzählers und der Passivität des Dieners.
- Kapitel vier widmet sich der Analyse der Aussagekraft der Parabel, der Bedeutung der „wahrhaft ungeheueren Reise“ und der konträren Perspektiven des Ich-Erzählers und des Dieners.
- Das fünfte Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen Kafkas und die These von Ulrich Gaier, dass keine Interpretation die allein richtige sein kann.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Textes umfassen „Parabel“, „Franz Kafka“, „Der Aufbruch“, „Interpretation“, „Erzählverhalten“, „Figuren“, „Reise ins Ungewisse“, „Weg-von-hier“, „Mehrdeutigkeit“, „Pluralismus“, „Topos“, „biographische Entsprechungen“, „Allegorie“, „Symbol“, „Geschichtsphilosophie“, „Marxismus“, „Theologie“.
- Quote paper
- M.A. Gerd Berner (Author), 2012, Franz Kafka, Der Aufbruch - Ausführliche Interpretation mit Sekundärliteratur, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/189454