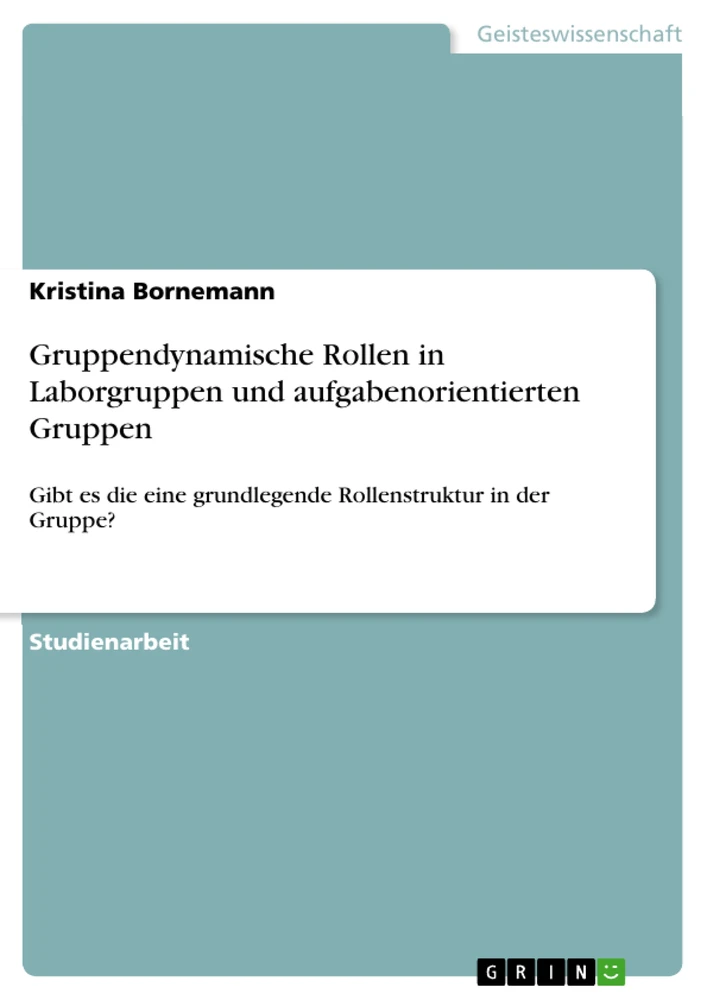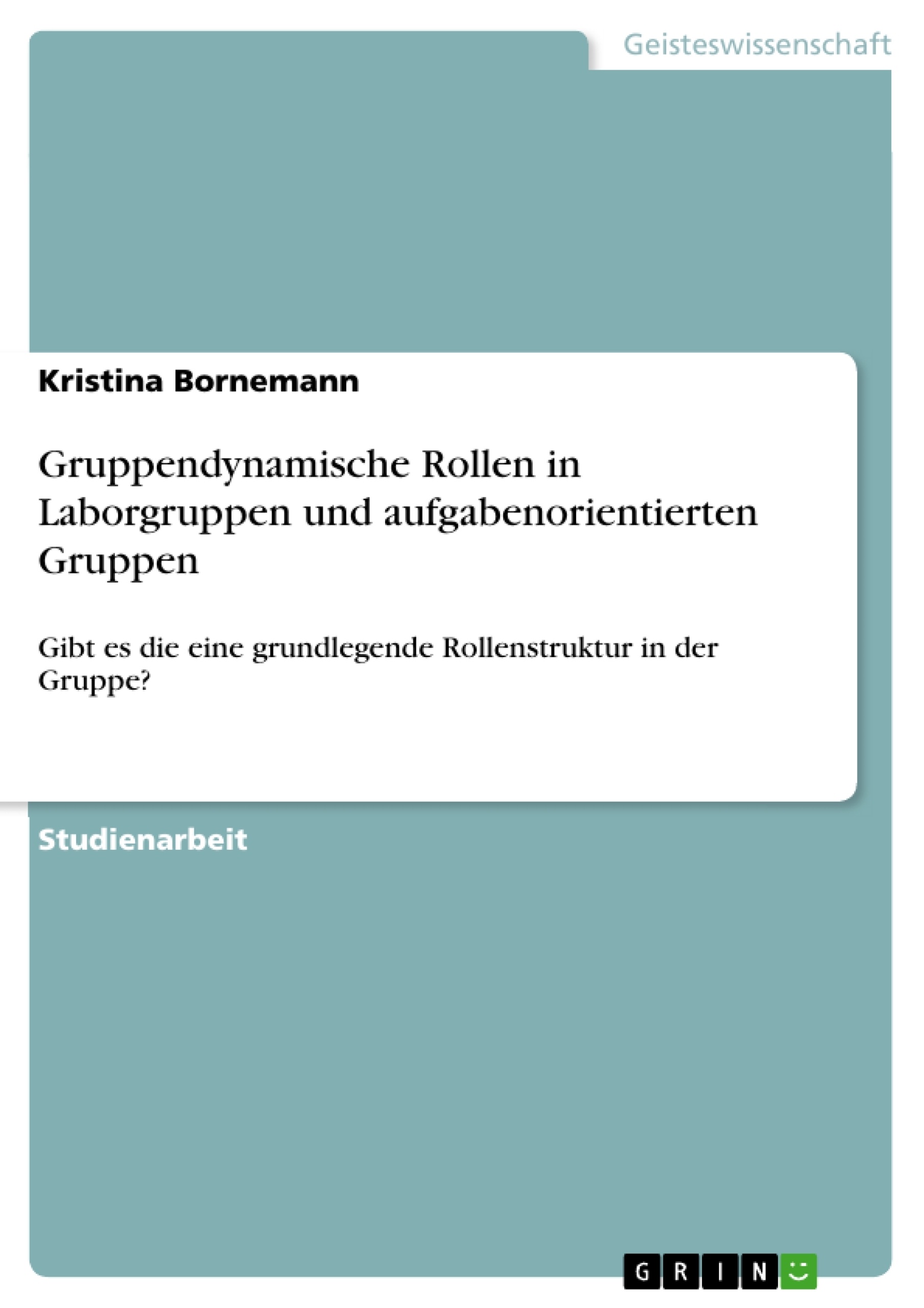Als Begründer der Gruppendynamik gelten i.A. Kurt Lewin et al. Er konnte auch auf Forschungen in D zurückgreifen – Künkel oder Schindler. Lewin arbeitete Mitte der 30-er Jahre in Iowa und später am MIT: Seine Erfahrungen bewegten ihn 1947 zur Gründung des National Training Laboratory (NTL). Es verwendete die Labormethode, die sich vor allem an die amerikanische akademische Welt und an die Individuen, die an persönlicher Entwicklung interessiert waren, wandte. Sie war zuerst einmal spezialisiert auf informelle, experimentelle Methoden zum Lehren und Entdecken der gruppendynamischen „Gesetze“. Das Credo war: Lernen durch Gruppendiskussion führt eher zu einem echten Lernen (im Sinne von Verhaltensänderung) als die Methoden des Vortrags oder des Trainings. Es ging darum, einen sozialen Kontext zu schaffen, in dem Individuen sich selbst und andere beobachten konnten, um damit zu einen anderen Umgang mit sich selbst und anderen zu finden. Nur so konnten die Qualifikationen für ein humanes, soziales Miteinander erarbeitet werden: Selbstreflexion, Reflexion des sozialen Kontextes und Kommunikation darüber. Manche sahen die ganze Bewegung als bloße Mode, einen Kult innerhalb der akademischen Welt, eine Zeitgeisterscheinung oder gar eine soziale Träumerei der Intellektuellen. Andere sahen sogar die Gefahr, dass das hier gesammelte Wissen zu Manipulation und Ausbeutung missbraucht werden kann. NTL verstand es aber mit der Zeit, Spezialisten aus vielen Bereichen anzuziehen und sich zu einer etablierten interdisziplinären Institution zu entwickeln. In den USA entstanden weitere Laboratorien, und nach dem zweiten Weltkrieg kam die „Mode“ auch nach Europa: Tavistock Institute in England, Traugott Lindner in Österreich. Diese „Phase“ wird heute die klassische angewandte Gruppendynamik genannt und viele ihrer Formen überlebten bis heute und leisten weiter ihren Beitrag. Heute verstehen wir darunter mehr als Labor-Gruppen, denen wir ohne Zweifel viel zu verdanken haben und die noch immer ihren Platz in den Ausbildungssystemen wie in unserer Gesellschaft behaupten. Jedoch betrachten wir jetzt Gruppenprozesse für alle Arten von sozialen Gruppen und Subkulturen; Inter-Gruppenprozesse gewinnen an Bedeutung. Sie wurden auch zunehmend in der Organisationsentwicklung oder in Hochleistungsmannschaftssportarten thematisiert.
Gruppendynamik ist im Wandel, sie hat seit 1947 ihren Wirkungskreis beachtenswert erweitert und bereichert. Und jetzt gewinnt sie auch politische Relevanz.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärungen
- Gruppe
- Was ist Gruppendynamik und was bedeutet das für die Gruppenstrukturen
- Strukturbegriff
- Erläuterung der Fragestellung
- Einige Beispiele der verschiedenen Sichtweisen auf gruppendynamische Rollen, die Individuen in Gruppen einnehmen
- Das Modell der sozialen Gruppe (vgl. Homans, 1972)
- Die Typenlehre von Fritz Künkel
- Das Rang-Dynamische Positionsmodell von Raoul Schindler
- Interpretation des Schindler Modells in Anlehnung an Litke (2007)
- Rollen in Gruppen – ein Modell aus der Praxis
- Teamrollen nach Belbin-Modell
- TMS - der Weg zum Hochleistungsteam
- Lassen sich Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Modellen gruppendynamischer Rollenstrukturen identifizieren?
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die Frage nach grundlegenden Gemeinsamkeiten in der Rollenstruktur verschiedener Gruppen. Sie hinterfragt die Übertragbarkeit von Erkenntnissen der Kleingruppenforschung auf größere und komplexere Gruppenstrukturen. Die Arbeit analysiert verschiedene Modelle gruppendynamischer Rollen und sucht nach Gemeinsamkeiten und Parallelen.
- Übertragbarkeit von Erkenntnissen der Kleingruppenforschung auf verschiedene Gruppenkontexte.
- Analyse verschiedener Modelle gruppendynamischer Rollen.
- Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Modellen.
- Untersuchung der Rolle des Kontextes (z.B. „Laborgruppen“ vs. reale Gruppen) auf die Rollenstrukturen.
- Beitrag zum Verständnis von Gruppendynamik und Rollen in verschiedenen Gruppen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der gruppendynamischen Rollen ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Existenz einer grundlegenden Rollenstruktur in Gruppen in den Mittelpunkt. Sie diskutiert die Herausforderungen der Übertragbarkeit von Forschungsergebnissen aus Kleingruppen auf komplexere Gruppenstrukturen und legt die methodische Vorgehensweise der Arbeit dar. Die Autorin begründet die Notwendigkeit, verschiedene Sichtweisen auf Rollenstrukturen zu betrachten, um zu einem umfassenden Verständnis zu gelangen.
Begriffsklärungen: Dieses Kapitel liefert wichtige Definitionen zentraler Begriffe, insbesondere den Begriff der „Gruppe“. Es wird eine spezifische Definition gewählt und begründet, die die relevanten Aspekte für die Untersuchung gruppendynamischer Prozesse abdeckt. Die Autorin konzentriert sich auf eine Definition, die sowohl klassische Ansätze als auch moderne Anwendungen der Gruppendynamik in Teams und Organisationen berücksichtigt. Der Begriff der Gruppendynamik wird ebenso erläutert, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen.
Erläuterung der Fragestellung: Hier wird die zentrale Forschungsfrage der Arbeit präzisiert und eingegrenzt. Es werden die methodischen Ansätze zur Beantwortung der Frage erläutert. Das Kapitel legt dar, wie die Autorin die Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Modelle gruppendynamischer Rollen untersuchen wird und welche Kriterien zur Bewertung herangezogen werden. Der Fokus liegt auf der systematischen Analyse verschiedener theoretischer Perspektiven.
Einige Beispiele der verschiedenen Sichtweisen auf gruppendynamische Rollen, die Individuen in Gruppen einnehmen: Dieses Kapitel präsentiert eine Auswahl verschiedener Modelle gruppendynamischer Rollen. Es werden detailliert verschiedene Ansätze vorgestellt und analysiert, um deren Stärken und Schwächen zu beleuchten. Die jeweiligen Modelle werden kritisch betrachtet und in Bezug auf ihre Anwendbarkeit auf unterschiedliche Gruppensituationen untersucht. Der Vergleich verschiedener Modelle dient der Vorbereitung auf die spätere Suche nach Gemeinsamkeiten.
Lassen sich Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Modellen gruppendynamischer Rollenstrukturen identifizieren?: Dieses Kapitel stellt den Kern der Arbeit dar und sucht nach Gemeinsamkeiten und Überschneidungen zwischen den im vorherigen Kapitel vorgestellten Modellen. Es werden die identifizierten Gemeinsamkeiten ausführlich diskutiert und deren Bedeutung für das Verständnis gruppendynamischer Prozesse erläutert. Die Autorin synthetisiert die Ergebnisse ihrer Analyse und zieht Schlussfolgerungen über die Existenz einer grundlegenden Rollenstruktur in Gruppen.
Schlüsselwörter
Gruppendynamik, Rollenstruktur, Kleingruppenforschung, Gruppenmodelle, soziale Gruppe, Teamrollen, Rollenkonzepte, Gruppenstrukturen, Homans, Künkel, Schindler, Belbin, Gruppenkohäsion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Studienarbeit über Gruppendynamische Rollenstrukturen
Was ist der Gegenstand dieser Studienarbeit?
Die Studienarbeit untersucht die grundlegenden Gemeinsamkeiten in der Rollenstruktur verschiedener Gruppen. Sie analysiert verschiedene Modelle gruppendynamischer Rollen und sucht nach Gemeinsamkeiten und Parallelen, wobei die Übertragbarkeit von Erkenntnissen der Kleingruppenforschung auf größere und komplexere Gruppenstrukturen hinterfragt wird.
Welche Modelle gruppendynamischer Rollen werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Modelle, darunter das Modell der sozialen Gruppe (Homans, 1972), die Typenlehre von Fritz Künkel, das Rang-Dynamische Positionsmodell von Raoul Schindler (mit Interpretation nach Litke, 2007), das Rollenmodell aus der Praxis und das Belbin-Modell für Teamrollen sowie TMS (der Weg zum Hochleistungsteam).
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Lassen sich Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Modellen gruppendynamischer Rollenstrukturen identifizieren? Die Arbeit untersucht, ob eine grundlegende Rollenstruktur in Gruppen existiert und wie sich Erkenntnisse aus der Kleingruppenforschung auf andere Gruppenkontexte übertragen lassen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung und Begriffsbestimmungen (Gruppe, Gruppendynamik, Strukturbegriff). Es folgt eine detaillierte Erläuterung der Fragestellung und der methodischen Vorgehensweise. Der Hauptteil präsentiert und analysiert die verschiedenen Modelle gruppendynamischer Rollen. Abschließend werden die Gemeinsamkeiten der Modelle identifiziert und diskutiert, und ein Schlusswort fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Übertragbarkeit von Erkenntnissen aus der Kleingruppenforschung, die Analyse verschiedener Modelle gruppendynamischer Rollen, die Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Modellen und die Untersuchung des Einflusses des Kontextes (z.B. "Laborgruppen" vs. reale Gruppen) auf die Rollenstrukturen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Gruppendynamik, Rollenstruktur, Kleingruppenforschung, Gruppenmodelle, soziale Gruppe, Teamrollen, Rollenkonzepte, Gruppenstrukturen, Homans, Künkel, Schindler, Belbin und Gruppenkohäsion.
Wie werden die verschiedenen Modelle verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Modelle, indem sie deren Stärken und Schwächen beleuchtet, ihre Anwendbarkeit auf unterschiedliche Gruppensituationen untersucht und nach Gemeinsamkeiten und Überschneidungen sucht. Der Vergleich dient der Synthese und der Schlussfolgerung über die Existenz einer grundlegenden Rollenstruktur.
Wer sind die relevanten Autoren/Theoretiker?
Die Arbeit bezieht sich auf die Theorien und Modelle von Homans, Künkel, Schindler und Belbin, sowie auf die Interpretation von Litke (2007).
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine systematische Analyse verschiedener theoretischer Perspektiven auf gruppendynamische Rollenstrukturen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu identifizieren. Die genaue methodische Vorgehensweise wird im Kapitel "Erläuterung der Fragestellung" detailliert beschrieben.
- Quote paper
- Magister der Philologie (PL) Kristina Bornemann (Author), 2012, Gruppendynamische Rollen in Laborgruppen und aufgabenorientierten Gruppen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/189331