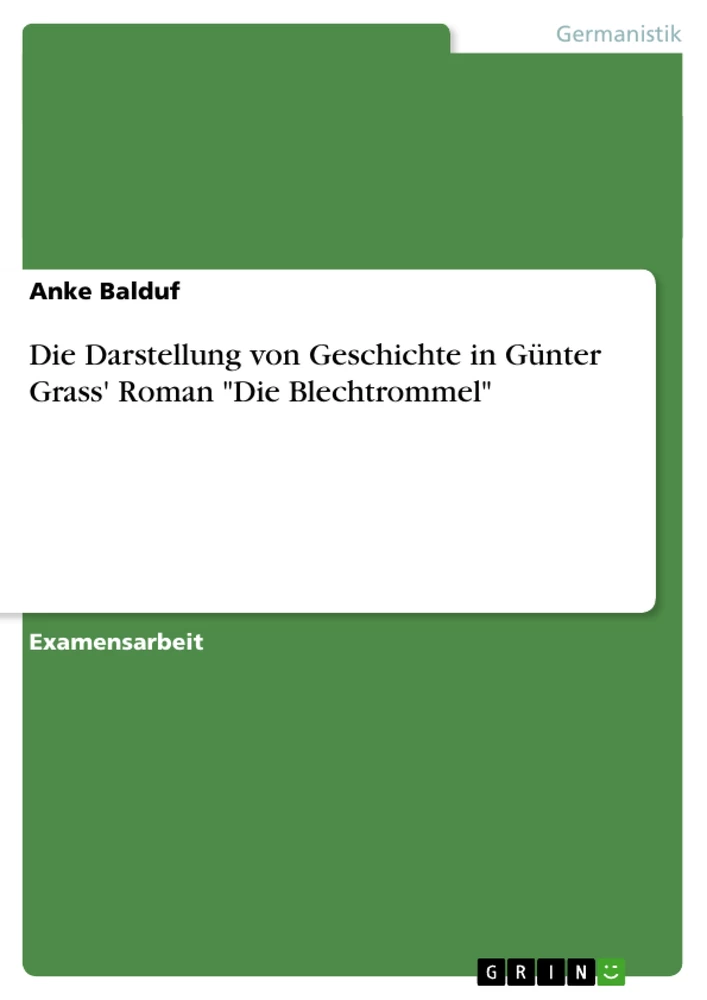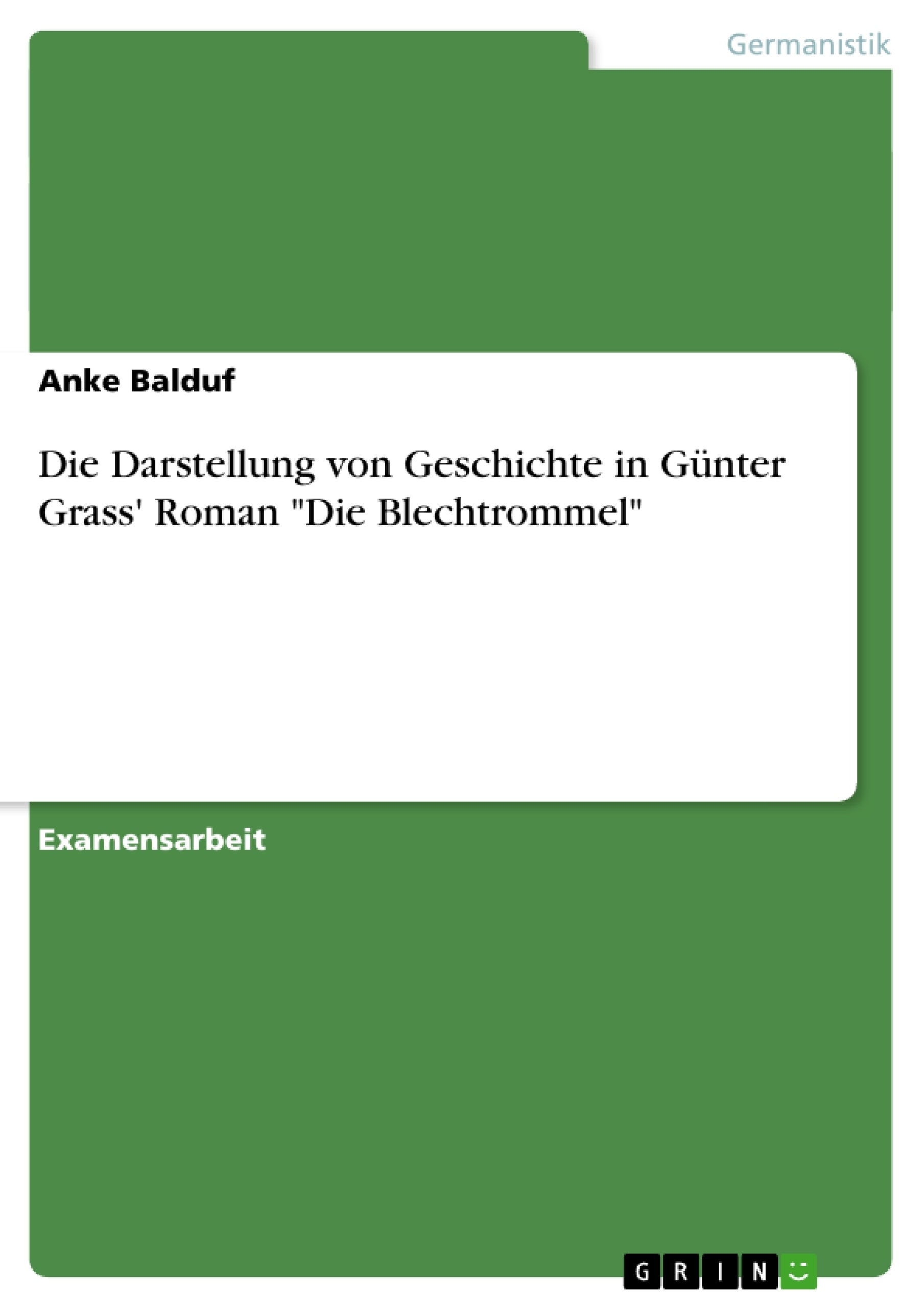Günter Grass’ Roman "Die Blechtrommel" gilt nicht erst seit der Verleihung des Nobelpreises 1999 an den Autor als eines der bedeutendsten Werke deutscher Nachkriegsliteratur. In der Preisbegründung wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es gewesen sei, „als wäre der deutschen Literatur nach Jahrzehnten sprachlicher und moralischer Zerstörung ein neuer Anfang vergönnt worden“. Auf fast 800 Seiten beschreibt Grass mehr als nur ein Stück Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegsgeschichte.
Doch Grass hatte nicht die Absicht, mit der Blechtrommel einen Beitrag zur Bewältigung der deutschen Vergangenheit zu liefern, vielmehr:
„Mich hat nicht edle Absicht getrieben, die deutsche Nachkriegsliteratur um ein robustes Vorzeigestück zu bereichern. Und auch der damals billigen Forderung nach ‚Bewältigung der Vergangenheit’ wollte und konnte ich nicht genügen, denn mein Versuch, den eigenen (verlorenen) Ort zu vermessen und mit Vorzug die Ablagerungen der sogenannten Mittelschicht (proletarisch-kleinbürgerlicher Geschiebemergel) Schicht um Schicht abzutragen, blieb ohne Trost und Katharsis.
Vielleicht gelang es dem Autor, einige neu anmutende Einsichten freizuschaufeln, schon wieder vermummtes Verhalten nackt zu legen, der Dämonisierung des Nationalsozialismus mit kaltem Gelächter den verlogenen Schauer regelrecht zu zersetzen und der bis dahin ängstlich zurückgepfiffenen Sprache Auslauf zu verschaffen; Vergangenheit bewältigen konnte (wollte) er nicht.“ Das Hauptziel der Blechtrommel ist somit Darstellung von Geschichte, genauer gesagt, die Darstellung der nationalsozialistischen Zeit, und der Umgang mit dieser Vergangenheit in der Nachkriegszeit.
Er wollte keine neuen An-, beziehungsweise Einsichten in der Blechtrommel präsentieren, sondern von bereits vorhanden Einsichten ausgehen, die er einfach nur wieder im Bewusstsein des Lesers präsent machen wollte. Dies erreicht Grass, indem er seinen Erzähler Oskar Matzerath die kleinsten Details und die hintersten Winkel des Kleinbürgertums beschreiben und ausleuchten lässt.
Der Blick wird auf das Menschliche gelenkt, auf die Gewohnheiten, Traditionen, Bedürfnisse und Vorlieben. Diese Arbeit soll sich mit der Darstellung der Geschichte in der Blechtrommel befassen, was sowohl die Zeit des Nationalsozialismus wie auch die Nachkriegszeit einschließt. Dabei wird die Künstlerproblematik weitgehend außer Acht gelassen, da der Schwerpunkt auf der Allegoriefunktion des dargestellten Kleinbürgertums liegen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Literaturgeschichtliche Einordnung
- I.1 Die Nachkriegsliteratur
- I.2 Günter Grass
- II. Die formale Darstellung von Geschichte
- II.1 Parallelschaltungen
- II.1.1 Gleichzeitigkeit
- II.1.1.1 Unverbundenheit
- II.1.1.2 Geschichte als Rahmenhandlung
- II.1.1.3 Parodistische Darstellung
- II.1.1.4 Die Aufgabe des Lesers
- II.2 Oskars sarkastische Darstellung
- II.1.1 Gleichzeitigkeit
- II.1 Parallelschaltungen
- III. Allegorie als inhaltliche Darstellung
- III.1 Die Kleinbürger
- III.1.1 Zusammenhang Kleinbürgertum – Nationalsozialismus
- III.1.1.1 Alfred Matzerath
- III.1.1.2 Unpolitische Parteibeitritte
- III.1.1.3 Jan Bronski
- III.1.1.4 Oskar Matzerath
- III.1.1 Zusammenhang Kleinbürgertum – Nationalsozialismus
- III.2 Die Vermittlung politischen Geschehens
- III.2.1 Die Tribüne
- III.2.2 Niobe
- III.2.3 Die Märchen
- III.2.3.1 Der Däumling
- III.2.3.2 Glaube Hoffnung Liebe
- III.2.4 Der erste September 1939
- III.2.5 Skatspiel und Kartenhaus
- III.2.6 Die Ameisenstraße
- III.3 Die Nachkriegszeit
- III.3.1 Erinnerungshilfen
- III.3.1.1 Das Fotoalbum
- III.3.1.2 Die Blechtrommel
- III.3.2 Das Umgehen mit der Vergangenheit
- III.3.2.1 Die unzensierte Erinnerung
- III.3.2.2 Verdrängen und gleichgebliebenes Verhalten
- III.3.2.2.1 Lankes und Herzog
- III.3.2.2.2 Maria und Kurt
- III.3.2.2.3 Viktor und die Grünhüte
- III.3.3 Die Zeit des Wirtschaftswunders
- III.3.3.1 Die neobiedermeierliche Gesellschaft
- III.3.3.2 Bebra und die innere Emigration
- III.3.3.3 Zwiebelkellerinfantilismus
- III.3.3.4 Umschlag und Rückkehr
- III.3.1 Erinnerungshilfen
- III.1 Die Kleinbürger
- IV. Die Aussage der Blechtrommel
- IV.1 Das absurde Geschichtsbild
- IV.1.1 Kreislauf der Geschichte
- IV.1 Das absurde Geschichtsbild
- Schlussbemerkung
- Abkürzungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Darstellung von Geschichte im Roman „Die Blechtrommel" von Günter Grass. Ziel ist es, die vielfältigen Formen der Geschichtsdarstellung in dem Werk zu untersuchen und die Bedeutung von Grass' literarischen Strategien im Kontext der deutschen Nachkriegsliteratur zu beleuchten.
- Die formale Darstellung von Geschichte durch Parallelschaltungen, Oskars sarkastische Erzählweise und den Einsatz von Allegorien
- Die kritische Auseinandersetzung mit dem Kleinbürgertum und seinen Verbindungen zum Nationalsozialismus
- Die Vermittlung politischen Geschehens durch verschiedene literarische Mittel wie Tribüne, Niobe und Märchen
- Die Auseinandersetzung mit der Nachkriegszeit und dem Umgang mit der Vergangenheit in Ost- und Westdeutschland
- Die Analyse des absurden Geschichtsbildes und des Kreislaufs der Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit sowie die Zielsetzung und den Aufbau vor. Das erste Kapitel beleuchtet die literaturgeschichtliche Einordnung der „Blechtrommel" in die deutsche Nachkriegsliteratur und beschreibt die Bedeutung Günter Grass' für diese Epoche. Das zweite Kapitel untersucht die formalen Aspekte der Geschichtsdarstellung in dem Roman, insbesondere die Verwendung von Parallelschaltungen und die sarkastische Erzählweise Oskars. Das dritte Kapitel analysiert die Verwendung von Allegorien als inhaltliche Darstellung. Hierbei werden die Kleinbürger, die Vermittlung politischen Geschehens und die Darstellung der Nachkriegszeit beleuchtet. Schließlich untersucht das vierte Kapitel die Aussagekraft der „Blechtrommel" und beleuchtet das absurde Geschichtsbild und den Kreislauf der Geschichte, die im Roman dargestellt werden.
Schlüsselwörter
Die Blechtrommel, Günter Grass, deutsche Nachkriegsliteratur, Geschichtsdarstellung, Parallelschaltungen, Allegorien, Kleinbürgertum, Nationalsozialismus, Nachkriegszeit, Erinnerungskultur, absurdes Geschichtsbild, Kreislauf der Geschichte.
- Quote paper
- Anke Balduf (Author), 2002, Die Darstellung von Geschichte in Günter Grass' Roman "Die Blechtrommel", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/18931