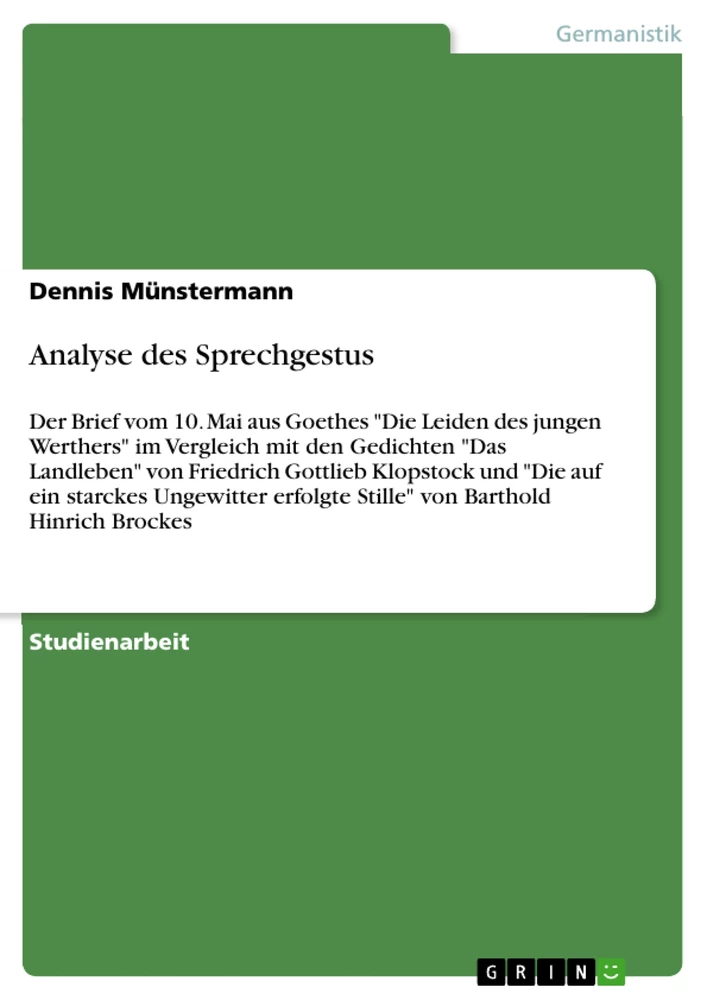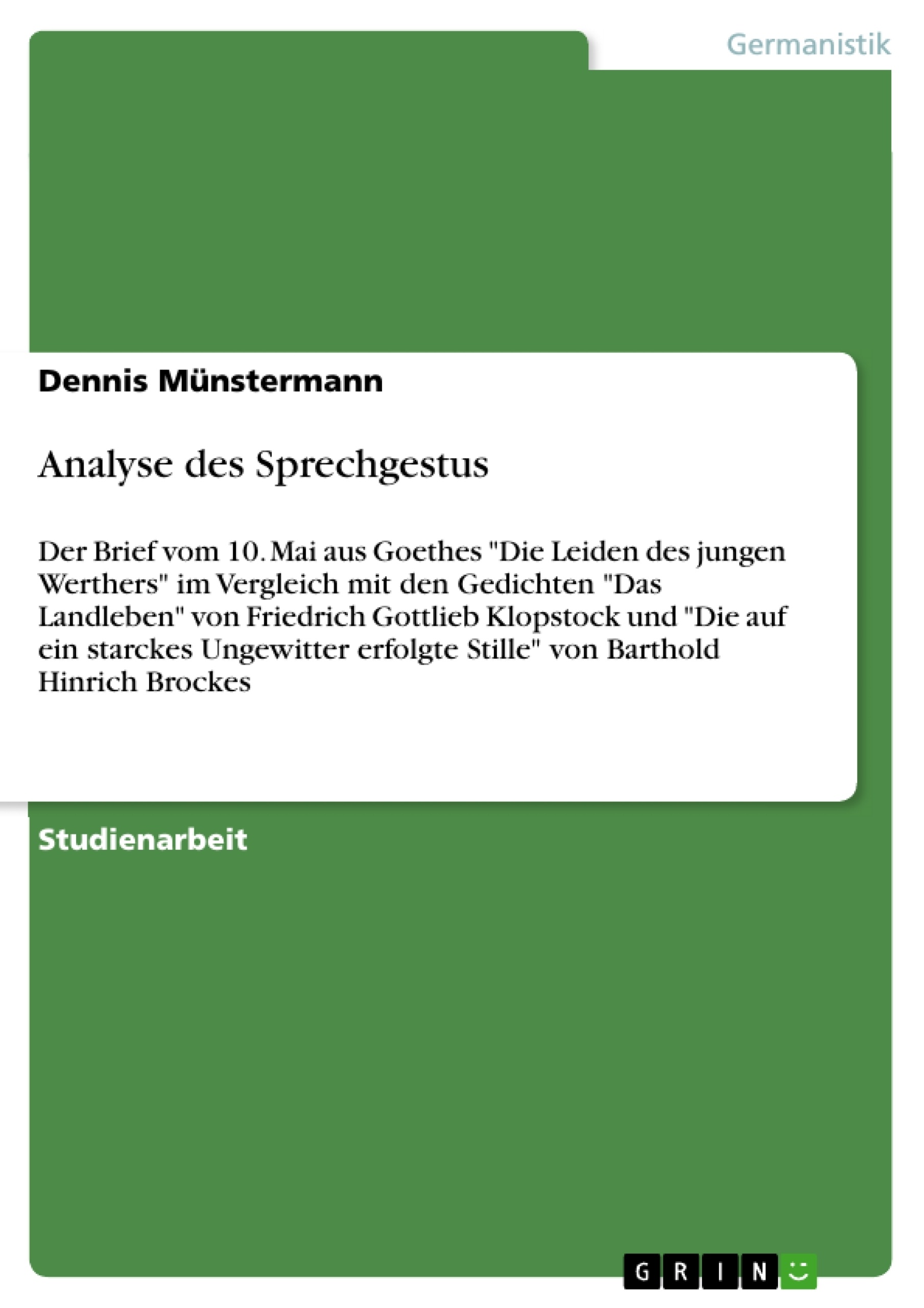Zur Analyse des Sprechgestus des "Werthers" wird exemplarisch der Brief vom 10. Mai verwendet und mit zwei anderen Gedichten verglichen: "Das Landleben" sowie "Die auf ein starckes Ungewitter erfolgte Stille".
„Die Leiden des jungen Werthers“ und „Das Landleben“ weisen dabei viele Parallelen und Gemeinsamkeiten auf.
Auf den folgenden Seiten möchte ich den Sprechgestus des Briefes vom 10. Mai aus Goethes Briefroman „ Die Leiden des jungen Werthers “ analysieren und mit den zwei Gedichten „ Das Landleben “ von Friedrich Gottlieb Klopstock und „ Die auf ein starckes Ungewitter erfolgte Stille “ von Barthold Hinrich Brockes in Bezug setzen und vergleichen. Dabei wird die erste Fassung des Briefes aus dem Jahr 1774 des „Werthers“ für die Analyse herangezogen.
Zuerst werde ich Goethes Werk beleuchten und anschließend mit dem ersten Gedicht „ Das Landleben “ vergleichen, da hier, meiner Meinung nach, Parallelen bestehen. Anschließend komme ich auf das Gedicht von Barthold Hinrich Brockes zu sprechen. Letztere Ergebnisse setze ich dann in Bezug zu den zuvor erzielten Erkenntnissen.
„Die Leiden des jungen Werthers“
Grundsätzlich lässt sich aufzeigen, dass der vorliegende Brief aus parataktischen Sätzen und einigen Konditionalsätzen besteht. Etwas komplexere Satzgefüge findet man selten. Eine Ausnahme bildet hier beispielsweise der erste Satz des Briefes:
„Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich denen süßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen geniesse.“[1]
Wie erwähnt, findet man ferner Konditionalsätze – beispielsweise „Wenn das liebe Thal um mich dampft, und […]“[2] oder „Wenn ich das Wimmeln […]“[3]. Ins Auge fällt jedoch, dass hier der zweite Teil des Satzes fehlt: Was ist denn die Konsequenz, wenn das „liebe Thal“ um den Werther herum dampft? Eine richtige Antwort sucht man vergebens.
Als nächste Auffälligkeit lässt sich anführen, dass dieser Brief sehr subjektiv ist, die Herrlichkeit der Natur schildert bzw. die Überwältigung des Werthers durch die Ansicht der Natur darlegt. Dies kommt zu Stande durch die reichhaltige Verwendung des Personalpronomens „Ich“. „Ich bin so glücklich […]“[4] ; aber auch durch die Diminutivformen für Lebewesen: „Würmgen“[5].
Das Paradoxon am Ende des Briefes („[…] ich erliege unter der Gewalt der Herrlichkeit dieser Erscheinungen“)[6] steigert die eben erwähnte Überwältigung um ein vielfaches – es scheint, als gebe es keinen anderen Anblick, keinen Menschen – rein gar nichts –, was den Werther so beeindrucken kann wie der Anblick der Natur. Diese These wird durch einen Satz zu Beginn des Briefes bestätigt: Der Werther ist allein und freut sich seines Lebens. An einem Ort, der „für solche Seelen geschaffen ist, wie die [s]eine“[7].
„Das Landleben“ sowie der Bezug zum „Werther“
Zu Beginn lässt sich sagen, dass das vorliegende Gedicht in Psalm-Form verfasst wurde, keinen metrischen Vorgaben folgt und keine „Fixierung“ auf rhythmische Regeln erfolgt. Der Autor hat sich also Freiheiten beim Verfassen gelassen. Dies ähnelt dem Stil des Werthers – auch hier hat Goethe sich nicht an orthographische und grammatikalische Regeln gehalten, sondern seinen eigenen Stil verfolgt. Wenngleich man auf der anderen Seite ergänzen muss, dass es damals, zur Zeit des Werthers, keine mit heutigen Normen vergleichbare Regeln, in Bezug auf Orthographie und Grammatik, gab.
Ferner findet man in diesem Gedicht Ausrufe wie „Halleluja! Halleluja!“[8] oder „O du, der seyn wird!“[9]. Insgesamt wird, und in diese Richtung zeigen auch die eben genannten Ausrufe, eine lebendige sowie bildliche Sprache verwendet: „Da rann der Tropfen“[10] ; „[…] die Ströme des Lichts“[11].
Darüber hinaus lässt sich das Gedicht meiner Meinung nach in zwei Teile gliedern. Der erste Teil reicht bis Zeile 72, anschließend wechselt der Sprechgestus. Im ersten Teil wird die Anbetung der Schöpfung geschildert und ferner die Winzigkeit des Wurmes im Vergleich zum Menschen bzw. dessen Winzigkeit im Vergleich zum Frühlingswürmchen bzw. der Größe des Weltalls. Im zweiten Teil wird das konkrete Naturereignis geschildert: Das Gewitter.
An dieser Stelle sind Parallelen zum „Werther“ erkennbar: Es wird im „Werther“ ebenfalls die Natur geschildert - dies erfolgt ebenfalls sehr subjektiv.
Zuallererst aber komme ich auf den ersten Teil zu sprechen. Hier steht das Element „Wasser“ im Vordergrund. Ferner ist die Rede von einem „Frühlingswürmchen“[12]. Auch im „Werther“ ist die Rede von mehreren „Würmgen“[13] – eine weitere Parallele.
Ebenso ist die Rede von einem Tal, welches jedoch nicht so lieblich ist, wie im Werther. Ganz im Gegenteil: Es handelt sich um ein „dunkles Thal“[14], welches mit dem Tod in Verbindung gebracht wird: „O du, der mich durchs dunkle Thal | Des Todes führen wird!“[15].
[...]
[1] Johann Wolfgang Goethe: Die Leiden des jungen Werthers. Abdruck der beiden Fassungen von 1774
und 1787. Hg. v. Matthias Luserke. Stuttgart 1998, S. 34.
[2] Goethe (Anm. 1), S. 12, Z. 7.
[3] Goethe (Anm. 1), S. 12, Z. 12f.
[4] Goethe (Anm. 1), S. 12, Z. 2.
[5] Goethe (Anm. 1), S. 12, Z. 14.
[6] Goethe (Anm. 1), S. 12, Z. 26f.
[7] Goethe (Anm. 1), S.10/12, Z.35ff.
[8] Friedrich Gottlieb Klopstock: Oden. Auswahl und Nachwort von Karl Ludwig Schneider. Stuttgart
1980, S. 58 66, Z. 11.
[9] Klopstock (Anm. 8), Z. 40.
[10] Klopstock (Anm. 8), Z. 18.
[11] Klopstock (Anm. 8), Z. 16.
[12] Klopstock (Anm. 8), Z. 29.
[13] Goethe (Anm. 1), S. 12, Z. 14.
[14] Klopstock (Anm. 8), Z. 43.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes über Goethes "Die Leiden des jungen Werthers"?
Der Text analysiert den Sprechgestus des Briefes vom 10. Mai aus Goethes Briefroman "Die Leiden des jungen Werthers" und vergleicht ihn mit den Gedichten "Das Landleben" von Friedrich Gottlieb Klopstock und "Die auf ein starckes Ungewitter erfolgte Stille" von Barthold Hinrich Brockes.
Welche Fassung des "Werther"-Briefes wird für die Analyse verwendet?
Die erste Fassung des Briefes aus dem Jahr 1774 des "Werthers" wird für die Analyse herangezogen.
Welche sprachlichen Merkmale werden im "Werther"-Brief hervorgehoben?
Der Brief besteht hauptsächlich aus parataktischen Sätzen und einigen Konditionalsätzen. Auffällig ist die subjektive Schilderung der Natur, die durch die Verwendung des Personalpronomens "Ich" und Diminutivformen verstärkt wird. Das Paradoxon am Ende des Briefes unterstreicht die Überwältigung des Werthers durch die Natur.
Welche Parallelen werden zwischen dem "Werther" und Klopstocks "Das Landleben" gezogen?
Beide Werke schildern die Natur subjektiv. Sowohl im "Werther" als auch in "Das Landleben" kommen Diminutive vor ("Würmgen" bzw. "Frühlingswürmchen").
Welche Unterschiede werden zwischen dem "Werther" und Klopstocks "Das Landleben" hervorgehoben?
Während im "Werther" ein liebliches Tal beschrieben wird, ist in "Das Landleben" von einem "dunklen Thal" die Rede, das mit dem Tod in Verbindung gebracht wird. Der "Werther" verstößt bewusst gegen orthographische und grammatikalische Regeln (zumindest für seine Zeit), während "Das Landleben" in Psalm-Form geschrieben ist und Ausrufe enthält.
Wie wird der Stil des "Werther" im Vergleich zu "Das Landleben" beschrieben?
Der Stil des "Werther" wird als weniger formal beschrieben, da Goethe sich nicht strikt an orthographische und grammatikalische Regeln gehalten hat. "Das Landleben" hingegen bedient sich einer lebendigen und bildlichen Sprache, inklusive Ausrufen und Metaphern.
Welche Struktur wird in Klopstocks "Das Landleben" identifiziert?
Das Gedicht wird in zwei Teile gegliedert: Der erste Teil (bis Zeile 72) schildert die Anbetung der Schöpfung, während der zweite Teil ein konkretes Naturereignis, das Gewitter, beschreibt.
- Quote paper
- Dennis Münstermann (Author), 2012, Analyse des Sprechgestus, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/189265