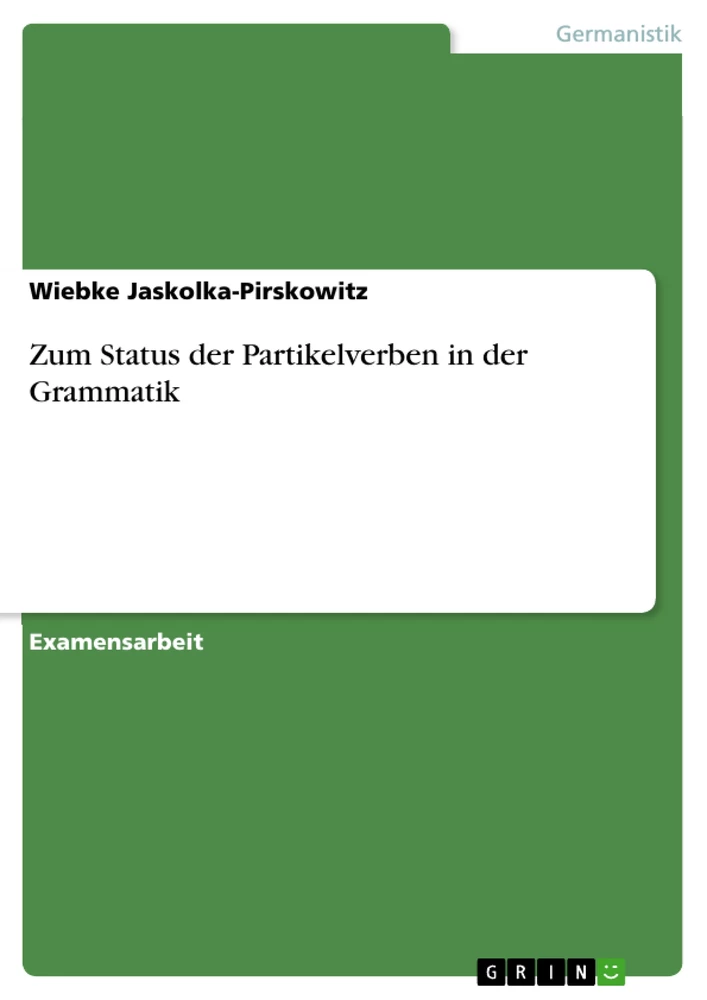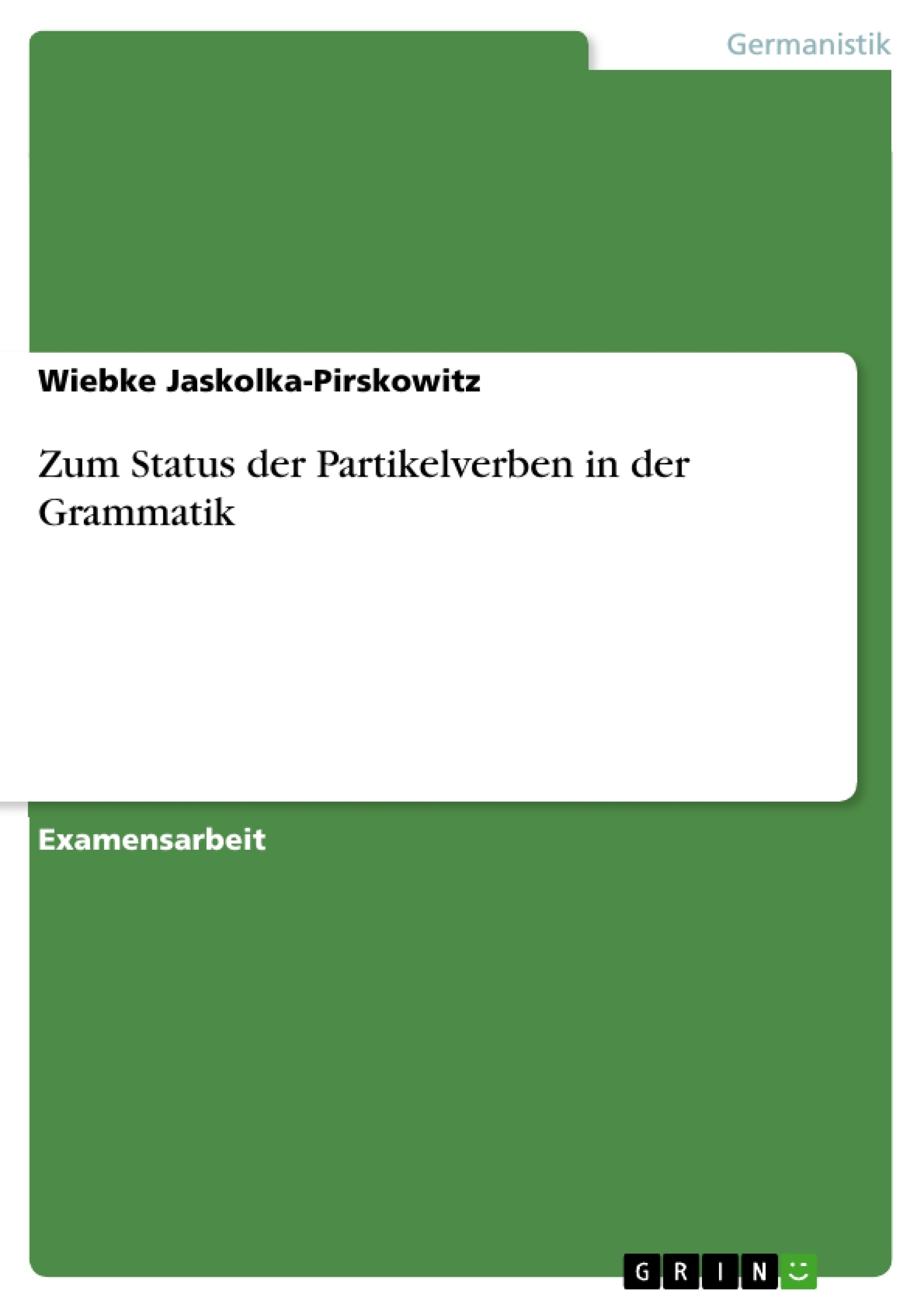Einleitung
In der Forschung hat man sich dem Partikelverb und dessen Status bis zum heutigen Zeitpunkt bereits sehr intensiv und ausführlich gewidmet. Das große Interesse an den Partikel-Verb-Konstruktionen entspringt der Tatsache, dass sie zum einen »über spezifische Eigen-schaften verfügen, die sie von allen anderen [Produkten] der Wortbildung unterscheiden« (Duden 2005: 677), und zum anderen »gegenwärtig zweifellos das produktivste und vielfältigste verbale Wortbildungsmuster« (Altmann/Kemmerling 2006: 82) darstellen. Sie existieren aber nicht nur in germanischen Sprachen wie dem Deutschen und Englischen, sondern auch in vielen anderen Sprachen wie z.B. Afrikaans, Japanisch, Kanakuru, Mandarin oder auch den skandinavischen Sprachen (vgl. Bailey et al. 2010 ), wodurch sie ein höchst interessantes sprachübergreifendes Phänomen repräsentieren.
Die Frage, die sich bei der Betrachtung der Partikelverben also unweigerlich aufwirft, lautet, weshalb sie genau eine Schnittstelle zwischen Morphologie und Syntax (vgl. Eisenberg 2006) bilden. Eine stringente Untersuchung der Partikelverben ist aufgrund ihrer abnormen Eigenschaften und ihres Verhaltens somit ausgeschlossen und es ergeben sich mehr oder weniger große Probleme bei der Analyse des Status. Wären die Partikelverben komplexe Produkte der Morphologie, sprich komplexe Wörter, so müssten sie nach dem CP-Ansatz (complex predicate approach) analysiert werden. Wären sie aber Phrasen, die der Syntax zugehörig sind (vgl. Ramnchand/Svenonius 2002), müssten sie entsprechend nach dem SC-Ansatz (small clause analysis) untersucht werden. Lüdeling, eine Vertreterin der syntaktischen Partikelverbanalyse, postuliert, dass »[t]hese constructions behave like words in some sense, but sometimes they behave more like phrases« (vgl. 1999: 1). Sie haben auf ganzer Linie einen Sonderstatus inne, da das sprachliche Phänomen so zahlreiche Idiosynkrasien aufweist (vgl. McIntyre 2002; Stiebels 1996), dass es weder möglich ist, sie einfach zu definieren, noch deren Bildung durch klare Muster oder in Analogien zu beschreiben und infolge dessen deren Status treffend zu bestimmen. Vor diesem Hintergrund erscheint die Tatsache, dass es dennoch einen geheimen, intuitiven Konsens darüber zu geben scheint, »which constructions should be called particle verbs« (Lüdeling 1999: 1), umso bizarrer.
Erschwert wird die Untersuchung zum Status der Partikelverben zusätzlich durch den Umstand, dass es noch weitere Strömungen gibt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- I. Teil - Theorie
- 2 Was ist ein Partikelverb?
- 2.1 Zur wissenschaftsgeschichtlichen Situation des Partikelverbs
- 2.2 Zur synchronen Situation des Partikelverbs
- 2.2.1 Die zwei Analyseansätze - möglicher Ursprung der Debatte
- 2.3 Die Verbpartikel
- 2.4 Resümee zum definitorischen Problem des Partikelverbs
- 3 Die Partikelverbbildung
- 3.1 Die deverbale und denominale Partikelverbbildung
- 3.1.1 Exkurs 1: Inkorporation
- 3.2 Die Bildungstypen der Partikelverben
- 3.2.1 Der deverbale Partikelverbtyp
- 3.2.1.1 Deverbale Partikelverben mit präpositionalem Erstglied
- 3.2.1.2 Deverbale Partikelverben mit adverbialem Erstglied
- 3.2.1.3 Deverbale Partikelverben mit adjektivischem Erstglied
- 3.2.1.4 Deverbale Partikelverben mit substantivischem Erstglied
- 3.2.2 Denominale Partikelverben
- 3.3 Resümee zu Partikelverbbildung
- 4 Die Semantik der Partikel-Verb-Konstruktion
- 4.1 Exkurs 2: Kurze Erläuterung zum zweistufigen Semantikmodell
- 4.2 Semantik der deverbale Partikelverben
- 4.3 Semantik der denominalen Partikelverben
- 4.4 Resümee zur Semantik der Partikelverben
- 5 Eine Merkmalsbeschreibung des Partikelverbs
- 5.1 Vorbemerkung
- 5.2 Morphologische Merkmale
- 5.2.1 Das Betonungsschema der Partikelverben
- 5.2.2 Die Orthografie der Partikelverben
- 5.2.3 Die morphologische Trennbarkeit der Partikelverben
- 5.2.4 Flexion
- 5.3 Syntaktische Merkmale
- 5.3.1 Die syntaktische Trennbarkeit
- 5.3.2 Verbanhebung
- 5.3.3 Topikalisierung der Verbpartikel
- 5.4 Summa Summarum
- II. Teil-Analysen
- 6 Untersuchung der Analyseansätze
- 6.1 Der morphologische Ansatz
- 6.1.1 Stiebels/Wunderlich (1994)
- 6.1.1.1 Kritik an Stiebels/Wunderlich (1994)
- 6.1.2 McIntyre (2002)
- 6.1.2.1 Kritik an McIntyre (2002)
- 6.2 Der syntaktische Ansatz
- 6.2.1 Wurmbrand (2000)
- 6.2.1.1 Kritik an Wurmbrand (2000)
- 6.2.2 Müller (2002b)
- 6.2.2.1 Kritik an Müller (2002b)
- 6.3 Der alternative Ansatz
- 6.3.1 Legitimierung einer alternativen Betrachtung des Partikelverbstatus
- 6.3.2 Kolehmainen (2005)
- 6.3.2.1 Kritik an Kolehmainen (2005)
- 6.4 Resümee zur Situation der Forschungsansätze
- 7 Eigene Untersuchung zur Aussagekraft des Kriteriums der Topikalisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Status von Partikelverben in der deutschen Grammatik. Ziel ist es, die Schwierigkeiten bei der Analyse ihrer Struktur und den Sonderstatus dieser Sprachphänomene zu beleuchten und verschiedene Forschungsansätze zu vergleichen. Die Arbeit prüft, ob sich das Problem des Status von Partikelverben klären lässt.
- Definition und wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung des Partikelverbs
- Analyse der verschiedenen morphologischen und syntaktischen Ansätze zur Beschreibung von Partikelverben
- Bewertung der Aussagekraft verschiedener Kriterien zur Bestimmung des Status von Partikelverben
- Untersuchung der Semantik der Partikelverben
- Auswertung und Vergleich existierender Forschungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Partikelverben ein und beschreibt deren herausragenden Stellenwert in der linguistischen Forschung aufgrund ihrer produktiven Bildung und ihres komplexen Status zwischen Morphologie und Syntax. Sie skizziert die zentrale Forschungsfrage nach dem Status der Partikelverben und die damit verbundenen analytischen Herausforderungen, die durch die abweichenden Eigenschaften und das unterschiedliche Verhalten dieser Verbkonstruktionen entstehen. Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die verschiedenen Forschungsansätze zu betrachten und zu evaluieren.
2 Was ist ein Partikelverb?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und der wissenschaftsgeschichtlichen Entwicklung des Konzepts "Partikelverb". Es untersucht die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung und Definition des Partikelverbs aufgrund seiner Eigenschaften, die sowohl morphologische als auch syntaktische Aspekte aufweisen. Es wird die Debatte um die zwei Hauptanalyseansätze (morphologisch und syntaktisch) erörtert und der Versuch unternommen, die Problematik der Definition zu verdeutlichen.
3 Die Partikelverbbildung: Dieses Kapitel behandelt die Bildung von Partikelverben, indem es die deverbale und denominale Bildungsweise detailliert darstellt. Es beleuchtet die verschiedenen Bildungstypen, wie z.B. die Bildung mit präpositionalen, adverbialen, adjektivischen und substantivischen Erstgliedern. Die Diskussion umfasst auch den Exkurs zur Inkorporation als ein syntaktisches Muster der deverbialen Partikelverbbildung, sowie ein Resümee über die Partikelverbbildung insgesamt.
4 Die Semantik der Partikel-Verb-Konstruktion: Das Kapitel analysiert die semantischen Aspekte von Partikelverben. Es beschreibt die Semantik der deverbialen und denominalen Partikelverben, wobei ein zweistufiges Semantikmodell als Grundlage dient. Die Bedeutung der Partikel und deren Einfluss auf die Gesamtbedeutung der Konstruktion werden eingehend untersucht. Das Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung der semantischen Aspekte der Partikelverben.
5 Eine Merkmalsbeschreibung des Partikelverbs: Dieses Kapitel beschreibt die Merkmale von Partikelverben, sowohl morphologisch als auch syntaktisch. Es werden Kriterien wie Betonung, Orthographie, Trennbarkeit, Flexion, Verbanhebung und Topikalisierung behandelt, um ein umfassendes Bild der Eigenschaften von Partikelverben zu zeichnen. Das Kapitel bietet eine systematische Übersicht der Merkmale, die für die Klassifizierung und Analyse von Partikelverben relevant sind.
6 Untersuchung der Analyseansätze: In diesem Kapitel werden die verschiedenen Forschungsansätze zur Analyse von Partikelverben kritisch untersucht und verglichen. Es werden die morphologischen Ansätze von Stiebels/Wunderlich und McIntyre sowie die syntaktischen Ansätze von Wurmbrand und Müller analysiert und bewertet. Darüber hinaus wird ein alternativer Ansatz betrachtet und diskutiert. Das Kapitel endet mit einem Resümee zur Situation der Forschungsansätze.
7 Eigene Untersuchung zur Aussagekraft des Kriteriums der Topikalisierung: Dieses Kapitel präsentiert eine eigene Untersuchung zu einem spezifischen Kriterium zur Analyse von Partikelverben, nämlich der Topikalisierung. Es evaluiert die Aussagekraft dieses Kriteriums im Kontext der bestehenden Debatte um den Status von Partikelverben und trägt somit zur Klärung der Forschungsfrage bei.
Schlüsselwörter
Partikelverb, Morphologie, Syntax, Wortbildung, Semantik, Analyseansätze, Forschungsstand, deutsche Grammatik, Trennbarkeit, Topikalisierung, morphologische Merkmale, syntaktische Merkmale.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Partikelverben im Deutschen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse von Partikelverben in der deutschen Grammatik. Sie untersucht den komplexen Status dieser Sprachphänomene und vergleicht verschiedene Forschungsansätze zu ihrer Beschreibung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung des Partikelverbs, Analyse verschiedener morphologischer und syntaktischer Ansätze, Bewertung der Aussagekraft verschiedener Kriterien zur Bestimmung des Partikelverb-Status, Untersuchung der Semantik von Partikelverben, Auswertung und Vergleich existierender Forschungsansätze, sowie eine eigene Untersuchung zur Aussagekraft des Kriteriums der Topikalisierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert: Teil I (Theorie) umfasst Kapitel zur Definition, Bildung und Semantik von Partikelverben sowie eine Merkmalsbeschreibung. Teil II (Analysen) beinhaltet eine kritische Untersuchung verschiedener Forschungsansätze und eine eigene Untersuchung zum Kriterium der Topikalisierung. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung und Resümee.
Welche Forschungsansätze werden untersucht?
Die Arbeit analysiert und vergleicht kritisch verschiedene morphologische und syntaktische Ansätze zur Beschreibung von Partikelverben. Genannt werden die Ansätze von Stiebels/Wunderlich (1994), McIntyre (2002), Wurmbrand (2000), Müller (2002b) und Kolehmainen (2005). Jeder Ansatz wird einzeln beleuchtet und kritisch bewertet.
Welche Kriterien werden zur Bestimmung des Partikelverb-Status verwendet?
Die Arbeit untersucht verschiedene Kriterien zur Bestimmung des Status von Partikelverben, einschließlich morphologischer Merkmale (Betonung, Orthografie, Trennbarkeit, Flexion) und syntaktischer Merkmale (syntaktische Trennbarkeit, Verbanhebung, Topikalisierung).
Welche Rolle spielt die Semantik?
Die Semantik der Partikelverben wird ausführlich behandelt. Die Arbeit analysiert die Bedeutung der Partikel und deren Einfluss auf die Gesamtbedeutung der Partikelverbkonstruktion. Dabei wird ein zweistufiges Semantikmodell verwendet.
Was ist das Ergebnis der eigenen Untersuchung?
Das Kapitel "Eigene Untersuchung zur Aussagekraft des Kriteriums der Topikalisierung" präsentiert die Ergebnisse einer eigenen empirischen Analyse dieses Kriteriums im Kontext der bestehenden Debatte um den Status von Partikelverben. Die konkreten Ergebnisse sind im Text der Arbeit selbst nachzulesen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Partikelverb, Morphologie, Syntax, Wortbildung, Semantik, Analyseansätze, Forschungsstand, deutsche Grammatik, Trennbarkeit, Topikalisierung, morphologische Merkmale, syntaktische Merkmale.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Linguisten, Germanisten, Sprachwissenschaftler und alle, die sich für die deutsche Grammatik und die Analyse komplexer Sprachphänomene interessieren.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text dieser Arbeit ist (vermutlich) beim Verlag erhältlich, der die OCR-Daten bereitgestellt hat. Weitere Informationen darüber können beim Verlag angefragt werden.
- Quote paper
- Wiebke Jaskolka-Pirskowitz (Author), 2011, Zum Status der Partikelverben in der Grammatik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/188625