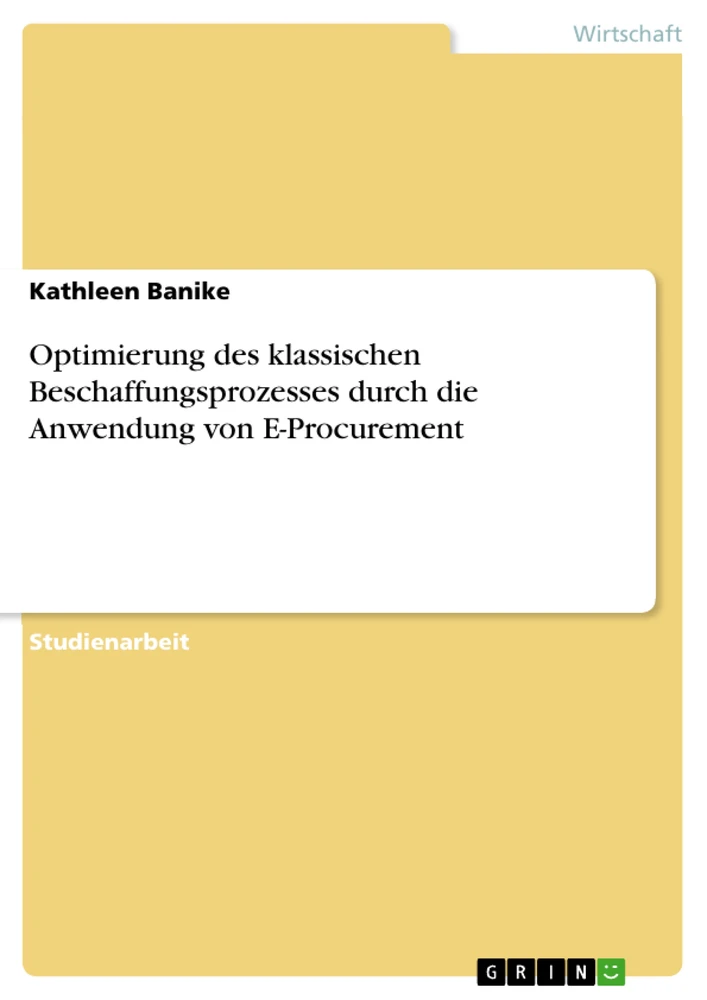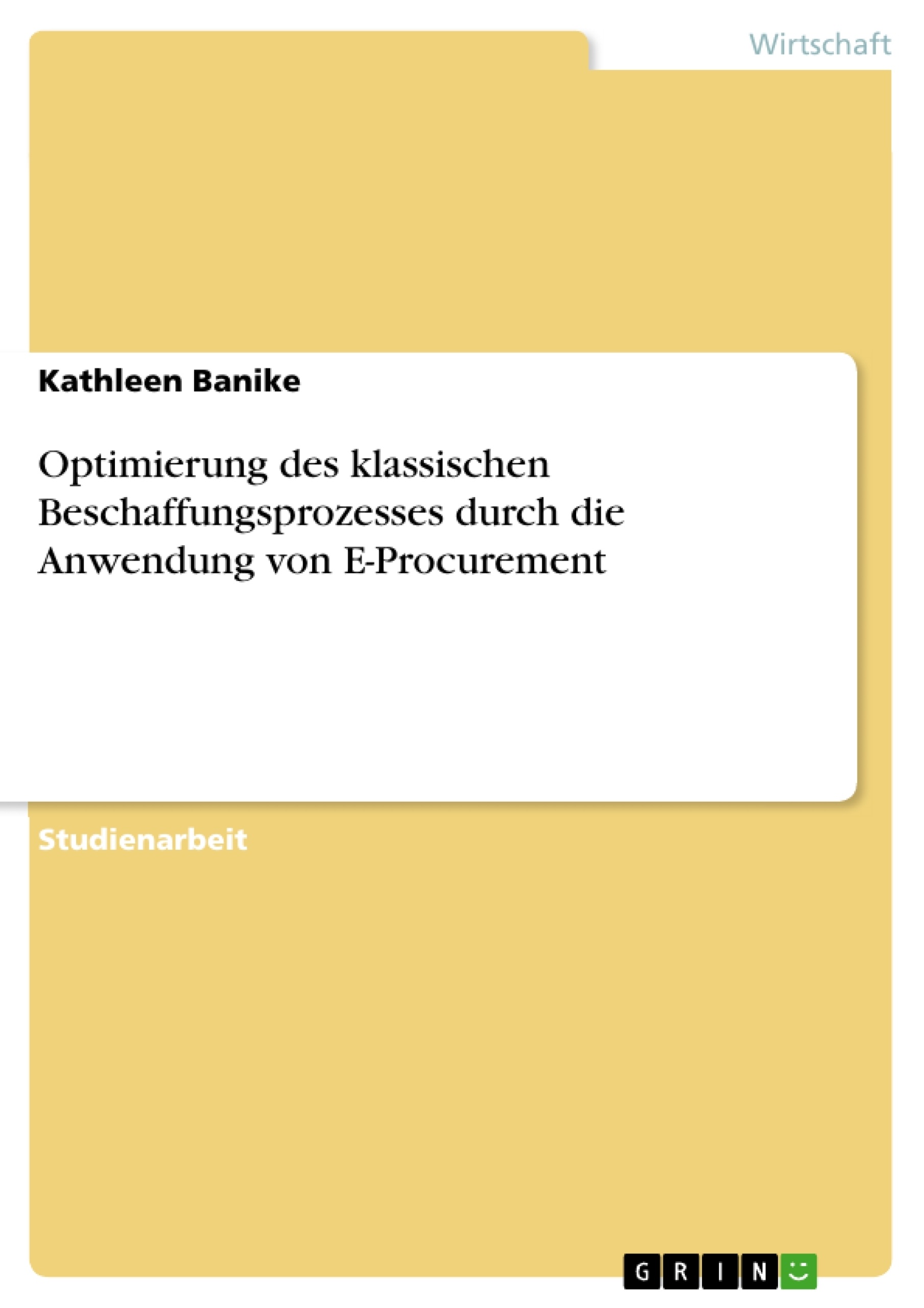1 Einleitung
Spätestens seit Beginn der 90er Jahre hat die moderne Informations- und Kommunikationstechnik einen Wandel im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich herbeigeführt. Noch vor wenigen Jahren waren Computer und Internet nur einigen Spezialisten zugänglich, heute aber sind sie aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Der ständige technische Fortschritt und der Ausbau und die Verknüpfung von Datenwegen bilden zudem die Grundlage für eine neue Dimension des wirtschaftlichen Handelns. Nachdem Effizienzsteigerungspotenziale in Produktion und Vertrieb weitestgehend ausgeschöpft wurden, konzentrieren sich die Unternehmen jetzt zunehmend auf die Optimierung betrieblicher Beschaffungsprozesse , welche die Betriebsressourcen in nicht geringem Maße belasten. E-Procurement ist zurzeit eines der wichtigsten Themengebiete, mit dem sich die EU und die Schweiz auseinandersetzen. Durch die elektronische Beschaffung ist es Mitarbeitern möglich, direkt von ihren Arbeitsplätzen aus über ein Desktop Purchasing System auf Produktkataloge zuzugreifen, die Produkte zu vergleichen und auszuwählen und sie anschließend zu bestellen. Über E-Procurement werden zumeist MRO-Güter beschafft, die zwar nur einen geringen Wert (ca. 10 Prozent) des Beschaffungsvolumens eines Unternehmens, jedoch ca. 70 Prozent des Beschaffungsaufwandes ausmachen. Das Einsparpotenzial bei der elektronischen Beschaffung von C-Artikeln ist beachtlich. Laut Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) nutzen bereits 80 Prozent der deutschen Unternehmen elektronische Produktkataloge. Der Anteil der Unternehmen, die elektronische Beschaffungslösungen bisher einsetzen, ist branchenabhängig jedoch sehr verschieden.
In der vorliegenden Arbeit sollen Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung der Beschaf-fung durch den Einsatz von verschiedenen E-Procurement-Lösungen näher erläutert und kritisch betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen und begriffliche Abgrenzung
- E-Business
- E-Commerce
- Beschaffung
- E-Sourcing
- E-Ordering
- E-Procurement
- E-Procurement-Tools
- Enterprise Ressource Planning Systeme
- Vor- und Nachteile von Enterprise Ressource Planning Systemen
- Desktop Purchasing Systeme
- Vor- und Nachteile von Desktop Purchasing Systemen
- Elektronische Märkte
- Vor- und Nachteile elektronischer Märkte
- Wesentliche Arten von E-Procurement
- E-Ordering
- Buy-Side
- Sell-Side
- Katalogbasierte Marktplätze
- E-Sourcing
- Online-Ausschreibungen
- Online-Auktionen
- Verkaufsauktionen
- Einkaufsauktionen
- Börsen
- E-Collaboration
- E-Ordering
- Systeme und Ausrichtungen des E-Procurement
- Systeme
- Offene Systeme
- Halboffene Systeme
- Geschlossene Systeme
- Ausrichtungen
- Horizontale Ausrichtung
- Vertikale Ausrichtung
- Systeme
- Der klassische Beschaffungsprozess
- Anbahnungsphase
- Vereinbarungsphase
- Abwicklungsphase
- Der Beschaffungsprozess unter Anwendung eines DPS
- E-Search- und E-Order-Prozess
- E-Transaction- und E-Fulfillment-Prozess
- E-Tracking- und E-Distribution-Prozess
- E-Payment- und E-Reporting-Prozess
- Wichtige Zahlungsmethoden im elektronischen Einkauf
- Gutschriftsverfahren
- Purchasing Card
- Kritische Betrachtungsweise des E-Procurement
- Chancen
- Problembereiche
- Zukunftsaussichten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Optimierung des klassischen Beschaffungsprozesses durch die Anwendung von E-Procurement. Ziel ist es, die Vorteile und Herausforderungen von E-Procurement-Lösungen aufzuzeigen und deren Einsatz im Kontext verschiedener Systeme und Ausrichtungen zu analysieren.
- Begriffliche Abgrenzung von E-Business, E-Commerce und E-Procurement
- Analyse verschiedener E-Procurement-Tools und -Systeme
- Vergleich des klassischen Beschaffungsprozesses mit dem E-Procurement-Prozess
- Bewertung der Chancen und Risiken von E-Procurement
- Zukunftsperspektiven von E-Procurement
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Optimierung des Beschaffungsprozesses durch E-Procurement ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie legt den Fokus auf die Effizienzsteigerung und Kostenreduktion durch den Einsatz elektronischer Lösungen.
Grundlagen und begriffliche Abgrenzung: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie E-Business, E-Commerce, Beschaffung, E-Sourcing und E-Procurement und grenzt diese voneinander ab. Es bildet die Grundlage für das Verständnis der späteren Kapitel und stellt die verschiedenen Stufen der elektronischen Beschaffung dar, beginnend mit der umfassenden Definition von E-Business bis hin zur detaillierten Erklärung des E-Procurement. Der Zusammenhang zwischen diesen Begriffen wird deutlich herausgearbeitet, um ein umfassendes Verständnis des Themenfeldes zu ermöglichen.
E-Procurement-Tools: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen E-Procurement-Tools wie ERP-Systemen und Desktop Purchasing Systemen sowie elektronischen Marktplätzen. Es werden deren Vor- und Nachteile im Detail analysiert und verglichen, um ein umfassendes Bild der verfügbaren Möglichkeiten zu zeichnen. Der Fokus liegt auf den jeweiligen Funktionalitäten und ihrer Eignung für unterschiedliche Unternehmensgrößen und Branchen. Die Kapitel beleuchtet die jeweiligen Stärken und Schwächen, um Entscheidungshilfen für die Auswahl geeigneter Tools zu liefern.
Wesentliche Arten von E-Procurement: Hier werden die verschiedenen Arten von E-Procurement, insbesondere E-Ordering und E-Sourcing, mit ihren jeweiligen Unterkategorien (z.B. Buy-Side, Sell-Side, Online-Auktionen) detailliert beschrieben und analysiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Funktionsweise und den Anwendungsbereichen der einzelnen Methoden. Es wird aufgezeigt, wie diese Methoden zur Optimierung des Beschaffungsprozesses beitragen und welche spezifischen Vorteile sie bieten. Die Kapitel veranschaulicht die Interdependenzen der verschiedenen Arten von E-Procurement und ihren Beitrag zu einem effizienten Beschaffungsprozess.
Systeme und Ausrichtungen des E-Procurement: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Systemen (offene, halboffene, geschlossene Systeme) und Ausrichtungen (horizontale, vertikale Ausrichtung) von E-Procurement-Lösungen. Es wird untersucht, wie diese Systeme und Ausrichtungen die Effizienz und die Kosten des Beschaffungsprozesses beeinflussen. Die Beschreibung der verschiedenen Systeme und Ausrichtungen bietet einen umfassenden Überblick über die unterschiedlichen Implementierungsstrategien und deren jeweilige Vor- und Nachteile. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen der gewählten System- und Ausrichtungsstrategie auf den Erfolg des E-Procurement-Einsatzes.
Der klassische Beschaffungsprozess: Dieses Kapitel beschreibt den traditionellen Beschaffungsprozess, unterteilt in die Phasen Anbahnung, Vereinbarung und Abwicklung. Es dient als Vergleichsmaßstab für den optimierten Prozess unter Anwendung von E-Procurement. Die einzelnen Phasen werden detailliert dargestellt und analysiert, um die Schwachstellen des traditionellen Prozesses aufzuzeigen und den Bedarf an Optimierung aufzuzeigen. Die Kapitel dient als Basis für den Vergleich mit dem modernen, durch E-Procurement optimierten Beschaffungsprozess.
Der Beschaffungsprozess unter Anwendung eines DPS: Dieses Kapitel beschreibt den Beschaffungsprozess unter Verwendung eines Desktop Purchasing Systems (DPS). Die einzelnen Prozessphasen (E-Search, E-Order, E-Transaction usw.) werden detailliert erläutert und mit dem klassischen Beschaffungsprozess verglichen. Die Darstellung der einzelnen Prozessphasen im Kontext eines DPS verdeutlicht die Effizienzsteigerung und die Vereinfachung des Beschaffungsprozesses durch den Einsatz elektronischer Lösungen. Der Vergleich mit dem klassischen Beschaffungsprozess unterstreicht die Vorteile des E-Procurement.
Wichtige Zahlungsmethoden im elektronischen Einkauf: Dieses Kapitel behandelt gängige Zahlungsmethoden im elektronischen Einkauf, wie z.B. das Gutschriftsverfahren und die Purchasing Card. Es werden die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methoden im Detail erläutert, um Entscheidungshilfen für die Auswahl der geeigneten Zahlungsmethode im Kontext von E-Procurement zu bieten. Die Kapitel konzentriert sich auf die spezifischen Anforderungen an Zahlungsabwicklungen im elektronischen Umfeld und deren Auswirkungen auf die Effizienz und Sicherheit des Beschaffungsprozesses.
Kritische Betrachtungsweise des E-Procurement: Dieses Kapitel bietet eine kritische Auseinandersetzung mit den Chancen und Herausforderungen von E-Procurement. Es werden sowohl die Vorteile (z.B. Kostenreduktion, Effizienzsteigerung) als auch die Risiken (z.B. Sicherheitsaspekte, Implementierungskosten) beleuchtet. Es bietet eine ausgewogene Betrachtung des Themas, um ein realistisches Bild der Möglichkeiten und Grenzen von E-Procurement zu vermitteln. Die Kapitel berücksichtigt sowohl die technologischen als auch die organisatorischen Aspekte, um eine umfassende Bewertung des E-Procurement-Einsatzes zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
E-Procurement, E-Sourcing, E-Ordering, Beschaffungsprozessoptimierung, ERP-Systeme, Desktop Purchasing Systeme, elektronische Märkte, Online-Auktionen, Kostenreduktion, Effizienzsteigerung, Risiken, Chancen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Optimierung des Beschaffungsprozesses durch E-Procurement
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über E-Procurement, inklusive einer Einleitung, eines Inhaltsverzeichnisses, der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffen. Es analysiert die Optimierung des klassischen Beschaffungsprozesses durch den Einsatz von E-Procurement, untersucht verschiedene E-Procurement-Tools und -Systeme, vergleicht den traditionellen mit dem elektronischen Beschaffungsprozess und bewertet die Chancen und Risiken von E-Procurement.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen im Detail: Begriffliche Abgrenzung von E-Business, E-Commerce und E-Procurement; Analyse verschiedener E-Procurement-Tools wie ERP-Systeme und Desktop Purchasing Systeme sowie elektronischer Märkte; Vergleich des klassischen Beschaffungsprozesses mit dem E-Procurement-Prozess; unterschiedliche Arten von E-Procurement (E-Ordering und E-Sourcing); Systeme und Ausrichtungen von E-Procurement (offene, halboffene, geschlossene Systeme; horizontale und vertikale Ausrichtung); wichtige Zahlungsmethoden im elektronischen Einkauf; eine kritische Betrachtung der Chancen und Herausforderungen von E-Procurement.
Welche E-Procurement-Tools werden vorgestellt?
Das Dokument stellt verschiedene E-Procurement-Tools vor, darunter Enterprise Ressource Planning (ERP) Systeme, Desktop Purchasing Systeme und elektronische Märkte. Es analysiert die Vor- und Nachteile jedes Tools und vergleicht deren Eignung für unterschiedliche Unternehmensgrößen und Branchen.
Wie wird der klassische Beschaffungsprozess mit dem E-Procurement-Prozess verglichen?
Das Dokument beschreibt den traditionellen Beschaffungsprozess in seinen Phasen (Anbahnung, Vereinbarung, Abwicklung) und vergleicht ihn detailliert mit dem optimierten Prozess unter Anwendung von E-Procurement, insbesondere unter Verwendung eines Desktop Purchasing Systems (DPS). Der Vergleich verdeutlicht die Effizienzsteigerung und Vereinfachung durch E-Procurement.
Welche Zahlungsmethoden im elektronischen Einkauf werden behandelt?
Das Dokument behandelt gängige Zahlungsmethoden im elektronischen Einkauf, wie das Gutschriftsverfahren und die Purchasing Card. Es werden die jeweiligen Vor- und Nachteile erläutert, um Entscheidungshilfen für die Auswahl der geeigneten Methode im Kontext von E-Procurement zu bieten.
Welche Chancen und Risiken von E-Procurement werden angesprochen?
Das Dokument bietet eine kritische Betrachtung der Chancen (z.B. Kostenreduktion, Effizienzsteigerung) und Risiken (z.B. Sicherheitsaspekte, Implementierungskosten) von E-Procurement. Es liefert eine ausgewogene Bewertung der Möglichkeiten und Grenzen von E-Procurement, unter Berücksichtigung sowohl technologischer als auch organisatorischer Aspekte.
Welche Arten von E-Procurement werden unterschieden?
Das Dokument unterscheidet hauptsächlich zwischen E-Ordering (mit Buy-Side, Sell-Side und katalogbasierten Marktplätzen) und E-Sourcing (mit Online-Ausschreibungen, Online-Auktionen, Börsen und E-Collaboration).
Welche Systeme und Ausrichtungen von E-Procurement werden beschrieben?
Es werden offene, halboffene und geschlossene Systeme sowie horizontale und vertikale Ausrichtungen von E-Procurement-Lösungen beschrieben und deren Einfluss auf Effizienz und Kosten analysiert.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für alle, die sich mit der Optimierung von Beschaffungsprozessen beschäftigen, insbesondere im Kontext von E-Procurement. Es richtet sich an Studierende, Wissenschaftler und Praktiker, die ein umfassendes Verständnis von E-Procurement und seinen Implikationen benötigen.
Wo finde ich die Schlüsselbegriffe des Dokuments?
Die Schlüsselbegriffe des Dokuments finden Sie am Ende des Dokuments in einem separaten Abschnitt. Zu den wichtigsten Begriffen gehören E-Procurement, E-Sourcing, E-Ordering, Beschaffungsprozessoptimierung, ERP-Systeme, Desktop Purchasing Systeme, elektronische Märkte, Online-Auktionen, Kostenreduktion, Effizienzsteigerung, Risiken und Chancen.
- Arbeit zitieren
- Kathleen Banike (Autor:in), 2010, Optimierung des klassischen Beschaffungsprozesses durch die Anwendung von E-Procurement, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/188195