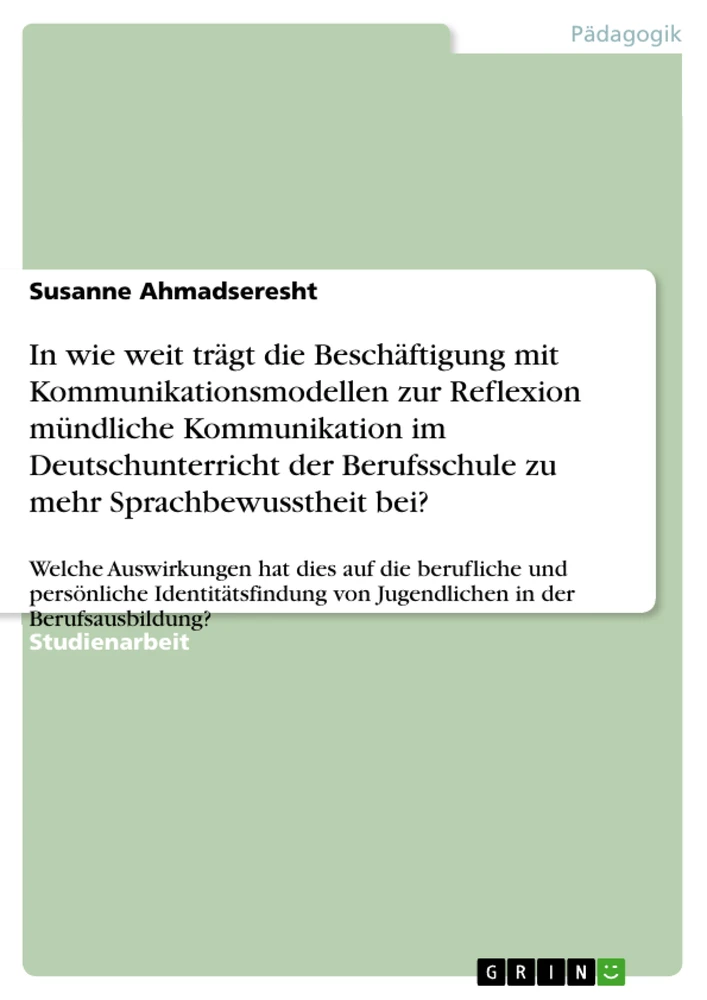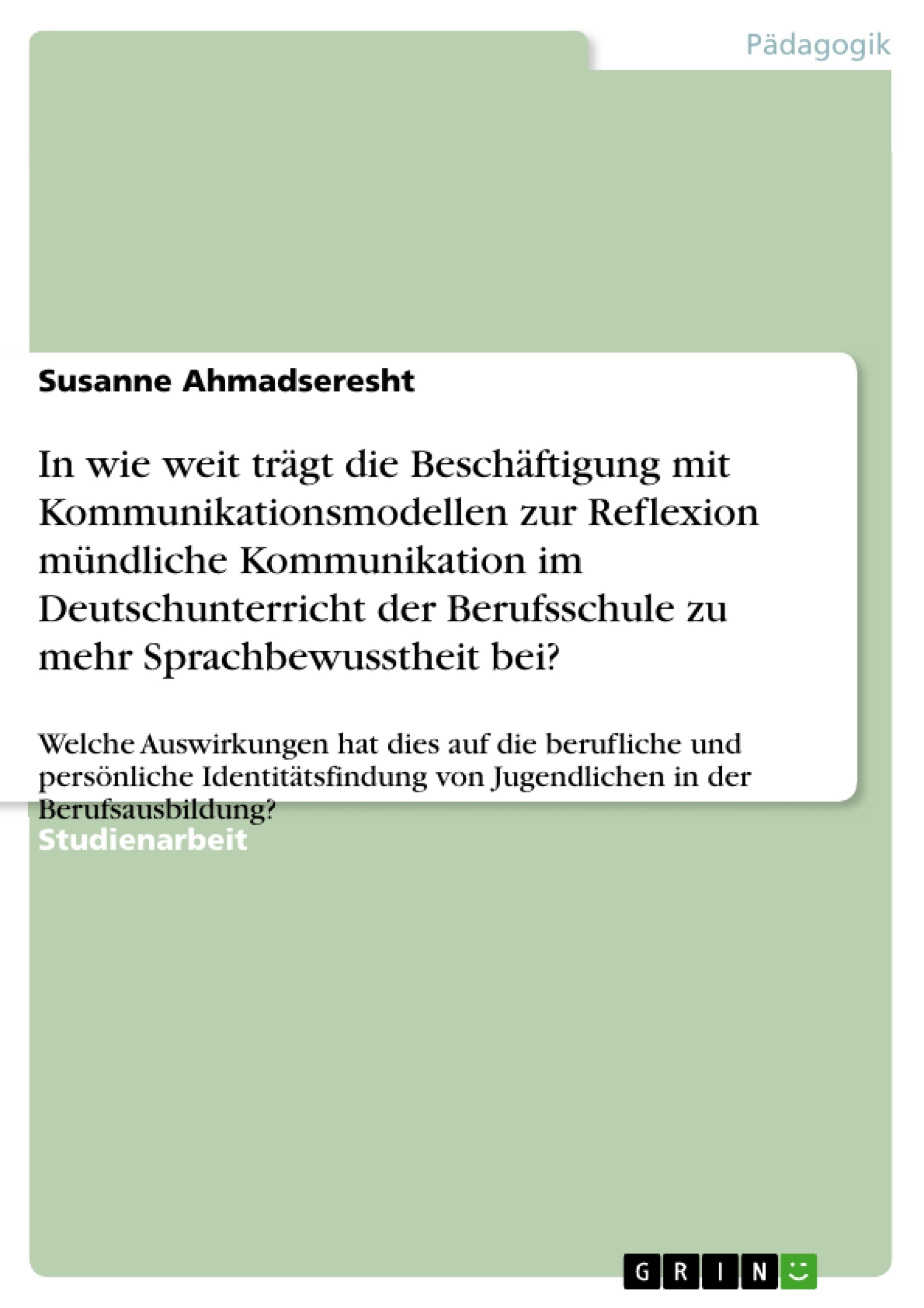In ihrer Ausbildung sollen sich Jugendliche möglichst umfassend qualifizieren, damit sie für ihren Beruf gut gerüstet sind. Neue Techniken und gestiegene Arbeitsanforderungen benöti¬gen immer besser ausgebildete Fachkräfte, die sich mit ihrem Beruf weiter entwickeln, bereit sind ihr Fachwissen in ihrem Beruf lebenslang zu erweitern und ein hohes Maß an Allgemeinbildung vorweisen. All dies ist aber an sprachliche Fähigkeiten gebunden.
Die Berufsschule trägt hier eine große Verantwortung, denn sie hat die Aufgabe, sowohl die berufliche Handlungskompetenz als auch die Persönlichkeitsbildung der Jugendlichen zu fördern.
Welchen Beitrag kann hier der Deutschunterricht und insbesondere die Reflektion mündli¬cher Kommunikation mit Hilfe von Kommunikationsmodellen leisten? Auch darauf möchte ich eine Antwort finden.
Diese Hausarbeit ist dreigeteilt: Sie beginnt mit einem Blick in den Rahmenplan der Hanse¬stadt Hamburg für Sprache und Kommunikation an Berufsschulen, um zu sehen, welchen Stellenwert dem Thema „Beschäftigung und Auseinandersetzung mit Kommunika¬tionsmo¬dellen“ beigemessen wird.
Im zweiten Kapitel werde ich mich fachlich mit der Entwicklung eines Kommunikations¬mo¬dells beschäftigen, um mich dann im dritten Kapitel mit der didaktischen Umsetzung des Themas im Deutschunterricht der Schule zu befassen. Hier werde ich u.a. auf den Aufbau von Sprachbewusstheit eingehen, klären welche Rolle in diesem Zusammenhang die Schule bzw. Berufsschule spielt und welche Auswirkungen dies auf Jugendliche und junge Erwachsene haben kann. Im Anschluss folgt ein kurzer Abriss über didaktische Konzepte zur mündlichen Kommunikation, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Anschließend werde ich kurz beleuchten, wie Kommunikationsmodelle im Deutschunterricht eingesetzt werden können und welche Voraussetzungen Schülerinnen und Schüler dazu bereits mit¬bringen sollten, damit Unterricht gelingen kann. Am Ende dieses Kapitels werde ich in groben Zügen aufzeigen, wie das Modell von Schulz von Thun im Deutschunterricht der Berufsschule eingesetzt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Der Rahmenplan
- 2. Die Entwicklung eines Kommunikationsmodells
- 2.1 Der Begriff Kommunikation
- 2.2 Das sprachliche Kommunikationsmodell
- 2.3 Das Organon-Modell von Karl Bühler
- 2.4 Paul Watzlawick
- 2.5 Friedemann Schulz von Thun
- 3. Didaktische Betrachtungen
- 3.1 Der Aufbau von Sprachbewusstheit
- 3.2 Didaktische Konzepte zur mündlichen Kommunikation
- 3.3 Kommunikationsmodelle und ihr Einsatz im Deutschunterricht
- 3.4 Voraussetzungen für den Einsatz von Kommunikationsmodellen im Unterricht
- 3.5 Das Vier-Seiten-Modell von Friedemann Schulz von Thun
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Beitrag der Beschäftigung mit Kommunikationsmodellen zur Reflexion mündlicher Kommunikation im Deutschunterricht der Berufsschule. Das zentrale Ziel ist es, die Auswirkungen dieser Beschäftigung auf die Sprachbewusstheit und die berufliche sowie persönliche Identitätsfindung von Jugendlichen in der Berufsausbildung zu analysieren.
- Der Stellenwert der mündlichen Kommunikation im Rahmenplan der Berufsschule
- Die Entwicklung und Anwendung verschiedener Kommunikationsmodelle
- Der Aufbau von Sprachbewusstheit durch Reflexion der Kommunikation
- Didaktische Konzepte für den Unterricht mündlicher Kommunikation
- Der Einfluss auf berufliche und persönliche Identitätsfindung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Beitrag von Kommunikationsmodellen zur Sprachbewusstheit und Identitätsfindung von Berufsschülern. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich in drei Kapitel gliedert: den Rahmenplan, die Entwicklung von Kommunikationsmodellen und deren didaktische Umsetzung im Unterricht.
1. Der Rahmenplan: Dieses Kapitel analysiert den Rahmenplan der Hansestadt Hamburg für Sprache und Kommunikation an Berufsschulen. Es zeigt den Stellenwert der kommunikativen Kompetenz und der Sprachreflexion für die berufliche Handlungskompetenz und Persönlichkeitsbildung der Jugendlichen. Der Rahmenplan betont die Notwendigkeit, dass Berufsschüler in der Lage sein sollen, in verschiedenen Kontexten sachgerecht, durchdacht und sozial verantwortlich zu kommunizieren. Die bewusste Auseinandersetzung mit Sprache, wie es der Rahmenplan fordert, soll zur Entwicklung von Sprachbewusstsein führen.
Schlüsselwörter
Kommunikationsmodelle, Mündliche Kommunikation, Sprachbewusstheit, Deutschunterricht, Berufsschule, Identitätsfindung, Berufsausbildung, Rahmenplan, Didaktik, Sprachreflexion, Handlungskompetenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Kommunikationsmodelle im Deutschunterricht der Berufsschule
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, wie die Beschäftigung mit Kommunikationsmodellen die Reflexion mündlicher Kommunikation im Deutschunterricht der Berufsschule fördert und sich auf die Sprachbewusstheit und die berufliche sowie persönliche Identitätsfindung von Jugendlichen auswirkt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und einen Schluss mit Literaturverzeichnis. Kapitel 1 analysiert den Rahmenplan der Berufsschule bezüglich Sprache und Kommunikation. Kapitel 2 befasst sich mit der Entwicklung verschiedener Kommunikationsmodelle (z.B. Bühler, Watzlawick, Schulz von Thun). Kapitel 3 behandelt die didaktische Umsetzung dieser Modelle im Unterricht.
Welche Kommunikationsmodelle werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Kommunikationsmodelle, darunter das sprachliche Kommunikationsmodell, das Organon-Modell von Karl Bühler, die Ansätze von Paul Watzlawick und insbesondere das Vier-Seiten-Modell von Friedemann Schulz von Thun.
Welchen Stellenwert hat der Rahmenplan?
Der Rahmenplan der Hansestadt Hamburg (als Beispiel) wird analysiert, um den Stellenwert der kommunikativen Kompetenz und Sprachreflexion für die berufliche Handlungskompetenz und Persönlichkeitsentwicklung der Schüler aufzuzeigen. Der Rahmenplan betont die Bedeutung von sachgerechter, durchdachter und sozial verantwortlicher Kommunikation.
Wie wird Sprachbewusstsein aufgebaut?
Die Arbeit untersucht, wie die Reflexion von Kommunikation durch den Einsatz von Kommunikationsmodellen zum Aufbau von Sprachbewusstsein beiträgt. Didaktische Konzepte für den Unterricht mündlicher Kommunikation werden vorgestellt und diskutiert.
Welchen Einfluss haben Kommunikationsmodelle auf die Identitätsfindung?
Die Arbeit analysiert den Einfluss der Beschäftigung mit Kommunikationsmodellen auf die berufliche und persönliche Identitätsfindung der Berufsschüler. Die bewusste Auseinandersetzung mit Sprache soll zur Entwicklung von Sprachbewusstsein und damit zur Identitätsfindung beitragen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kommunikationsmodelle, Mündliche Kommunikation, Sprachbewusstheit, Deutschunterricht, Berufsschule, Identitätsfindung, Berufsausbildung, Rahmenplan, Didaktik, Sprachreflexion, Handlungskompetenz.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welchen Beitrag leisten Kommunikationsmodelle zur Sprachbewusstheit und Identitätsfindung von Berufsschülern?
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das zentrale Ziel ist die Analyse der Auswirkungen der Beschäftigung mit Kommunikationsmodellen auf die Sprachbewusstheit und die berufliche sowie persönliche Identitätsfindung von Jugendlichen in der Berufsausbildung. Die Arbeit untersucht den Stellenwert mündlicher Kommunikation im Rahmenplan und die Entwicklung sowie Anwendung verschiedener Kommunikationsmodelle im Unterricht.
- Quote paper
- Susanne Ahmadseresht (Author), 2011, In wie weit trägt die Beschäftigung mit Kommunikationsmodellen zur Reflexion mündliche Kommunikation im Deutschunterricht der Berufsschule zu mehr Sprachbewusstheit bei?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/187869