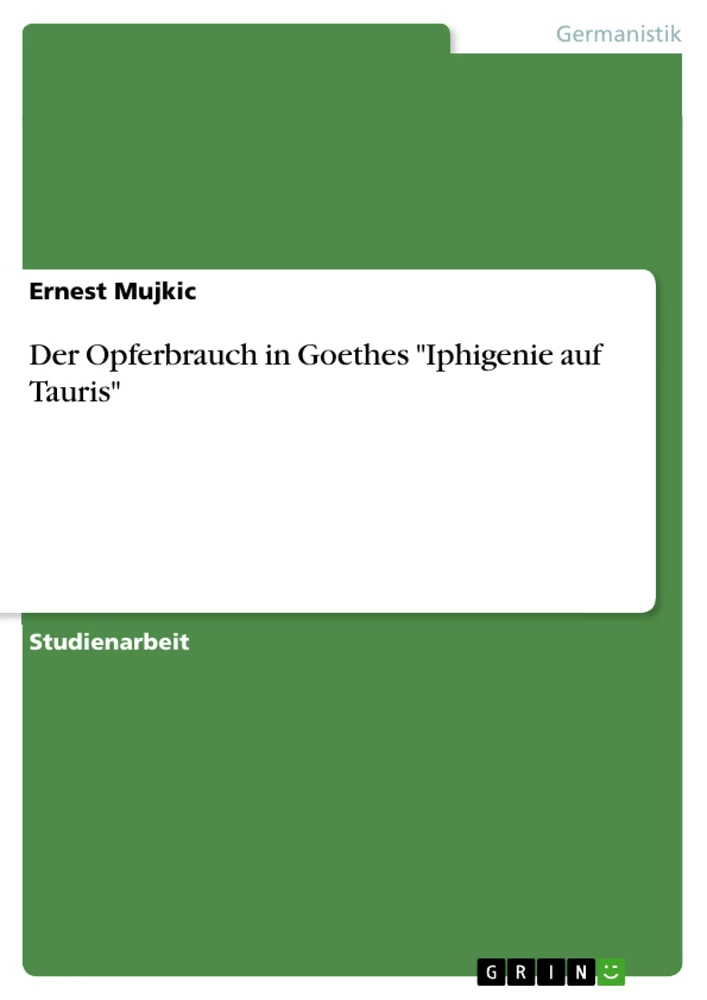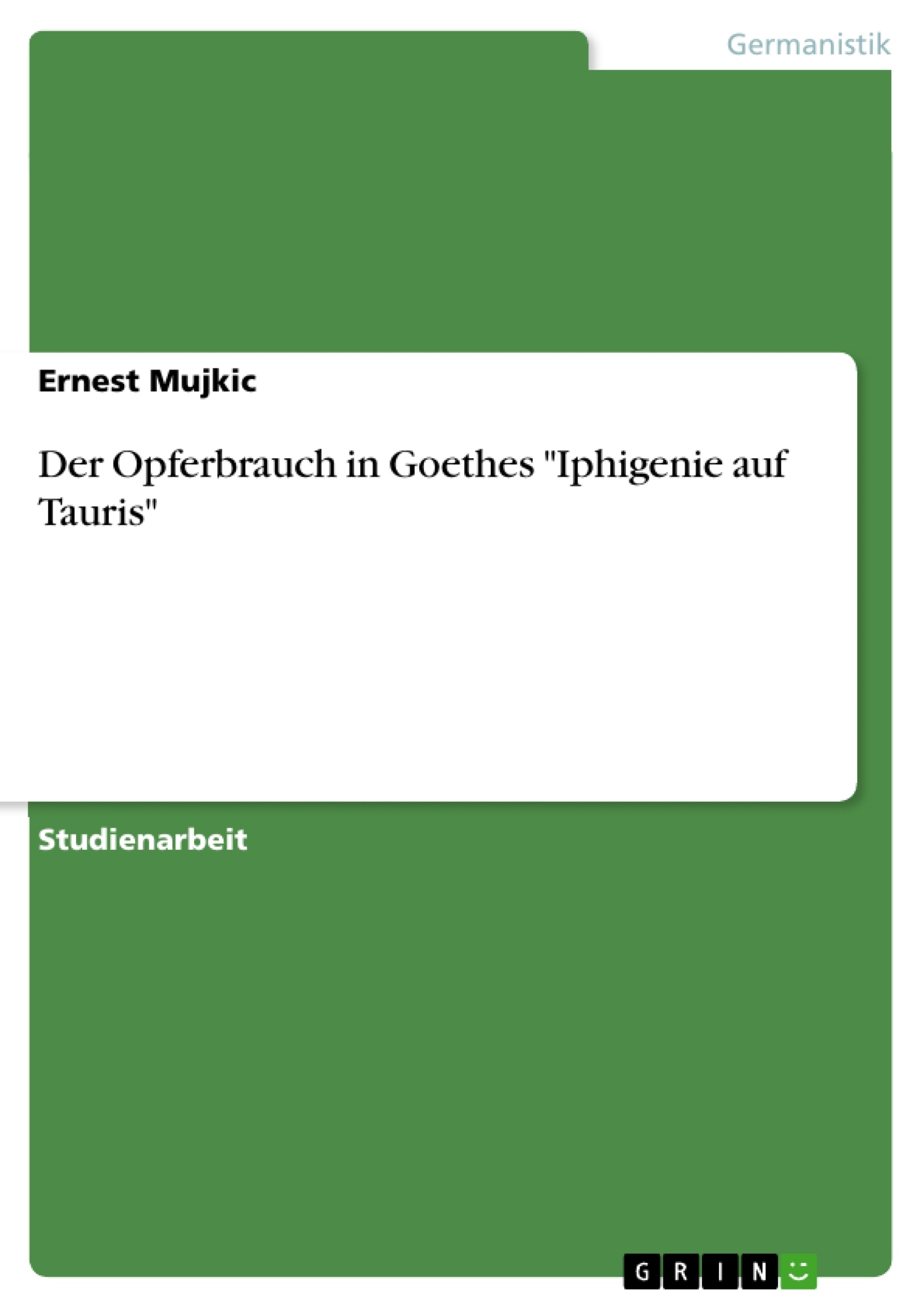Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie Goethe die Thematik der Opferpraxis in seiner "Iphigenie auf Tauris" behandelt. Obgleich die Menschenopferpraxis der antiken Welt in Goethes "Iphigenie" eine Abwertung und Ablehnung erfährt, bleibt der durch individuelle Verinnerlichung der Opferpraxis suggerierte Lösungsansatz deshalb unsicher, weil der Opferdiskurs keiner vollständigen Lösung zugeführt wurde und, wie die Arbeit zu zeigen versucht, keiner vollständigen Lösung zugeführt werden kann. Das heißt, auch dann, wenn im Äußeren auf gewaltsame Menschenopferung verzichtet wird, bleibt der Opfermechanismus erhalten, und zwar in der Konformitätsforderung, um des individuell guten Lebens in der Gemeinschaft willen Opfer zu bringen. Diese Anpassungsnotwendigkeit, die dem aufgeklärten Bewusstsein der Individuen erwächst und in der Einschränkung der persönlichen Freiheit besteht, ist das Restopfer, das nach der Moralisierung der Religion und Verinnerlichung des Opfermythos bleibt. Goethes Absicht scheint gewesen zu sein, Iphigenie deshalb nicht als Opfer am Altar sterben zu lassen, weil er auf diese Weise die katholische auf Menschenopfer begründete Humanitätsvorstellung kritisieren kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Literaturhistorischer und religiöser Hintergrund Goethes Behandlung des Opferbrauchs in „Iphigenie auf Tauris“
- 2. Dramaturgie des Menschenopferdiskurses in „Iphigenie auf Tauris“
- 2.1 Der Zweifel an der Legitimation und am Zweck des Opferbrauchs
- 2.2 Der argumentative Kampf um die Deutung der Begründung des Menschenopfers
- 2.3 Der Opferbrauch und die Sakralisierung von Gesetzen
- 3. Der Opferbrauch als Ort der Religionskritik
- 3.1 Zur Moralisierung der Religion – Trennung zwischen Opferbrauch und Religiosität
- 3.2 Zur Sakralisierung der Moral – Trennung zwischen Mythos und Opferbrauch
- 4. Die Folgen autonomen Handelns von Iphigenie für den Opferbrauch
- 4.1 Iphigenies Kritik am Stellvertreteropfer
- 4.2 Iphigenies Bedeutungsverschiebung des Opferbegriffs
- 5. Verteufelte Humanität oder das Kreuz mit dem Opfer.
- 5.1 Zur Bedeutung des individuellen Widerstands gegen die Praxis der Gewalt
- 5.2 Zum Vorwurf der Inhumanität individueller Freiheitsbehauptung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Goethes „Iphigenie auf Tauris“ im Hinblick auf die Darstellung und Kritik des Menschenopferbrauchs. Die Analyse beleuchtet den literaturhistorischen und religiösen Kontext, die dramaturgische Umsetzung des Opferdiskurses und die Folgen des individuellen Handelns Iphigenies für die Praxis des Opferns.
- Goethes Kritik an der religiösen Begründung des Opferbrauchs
- Die dramaturgische Darstellung des Zweifels an der Legitimität des Opferns
- Iphigenies Rolle in der Humanisierung und Bedeutungsverschiebung des Opferbegriffs
- Die Auseinandersetzung mit der Moral und Religion im Kontext des Opferbrauchs
- Die Folgen individuellen Widerstands gegen Gewalt
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet den literaturhistorischen und religiösen Hintergrund von Goethes Behandlung des Opferbrauchs in „Iphigenie auf Tauris“, in Bezugnahme auf Euripides und Goethes eigene Auseinandersetzung mit dem Christentum. Kapitel 2 analysiert die dramaturgische Umsetzung des Menschenopferdiskurses, den Zweifel an dessen Legitimität und den argumentativen Kampf um dessen Begründung. Kapitel 3 fokussiert auf den Opferbrauch als Ort der Religionskritik und die Trennung zwischen Opferbrauch und Religiosität bzw. Mythos und Opferbrauch. Kapitel 4 untersucht die Folgen von Iphigenies autonomem Handeln für den Opferbrauch, ihre Kritik am Stellvertreteropfer und ihre Bedeutungsverschiebung des Opferbegriffs. Kapitel 5 diskutiert die Auswirkungen der Bedeutungsverschiebung im Kontext von Goethes Problematisierung der Humanität Iphigenies.
Schlüsselwörter
Iphigenie auf Tauris, Goethe, Menschenopfer, Religionskritik, Humanität, Opferbrauch, Dramaturgie, Moral, Individuum, Kollektiv, Stellvertreteropfer, Bedeutungsverschiebung.
- Quote paper
- Ernest Mujkic (Author), 2011, Der Opferbrauch in Goethes "Iphigenie auf Tauris", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/187576