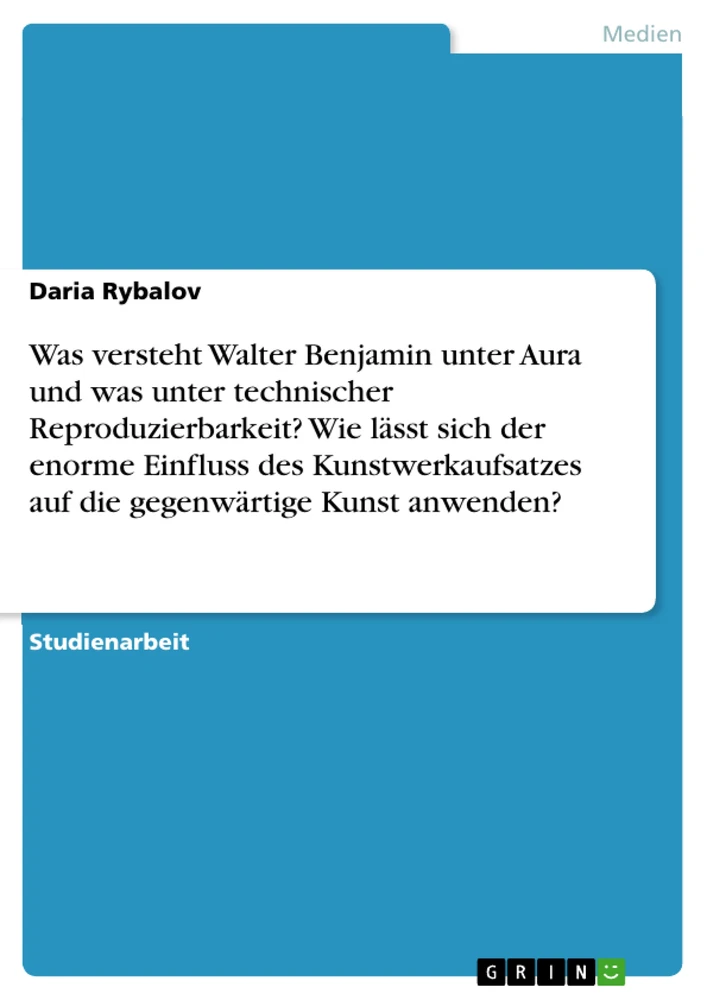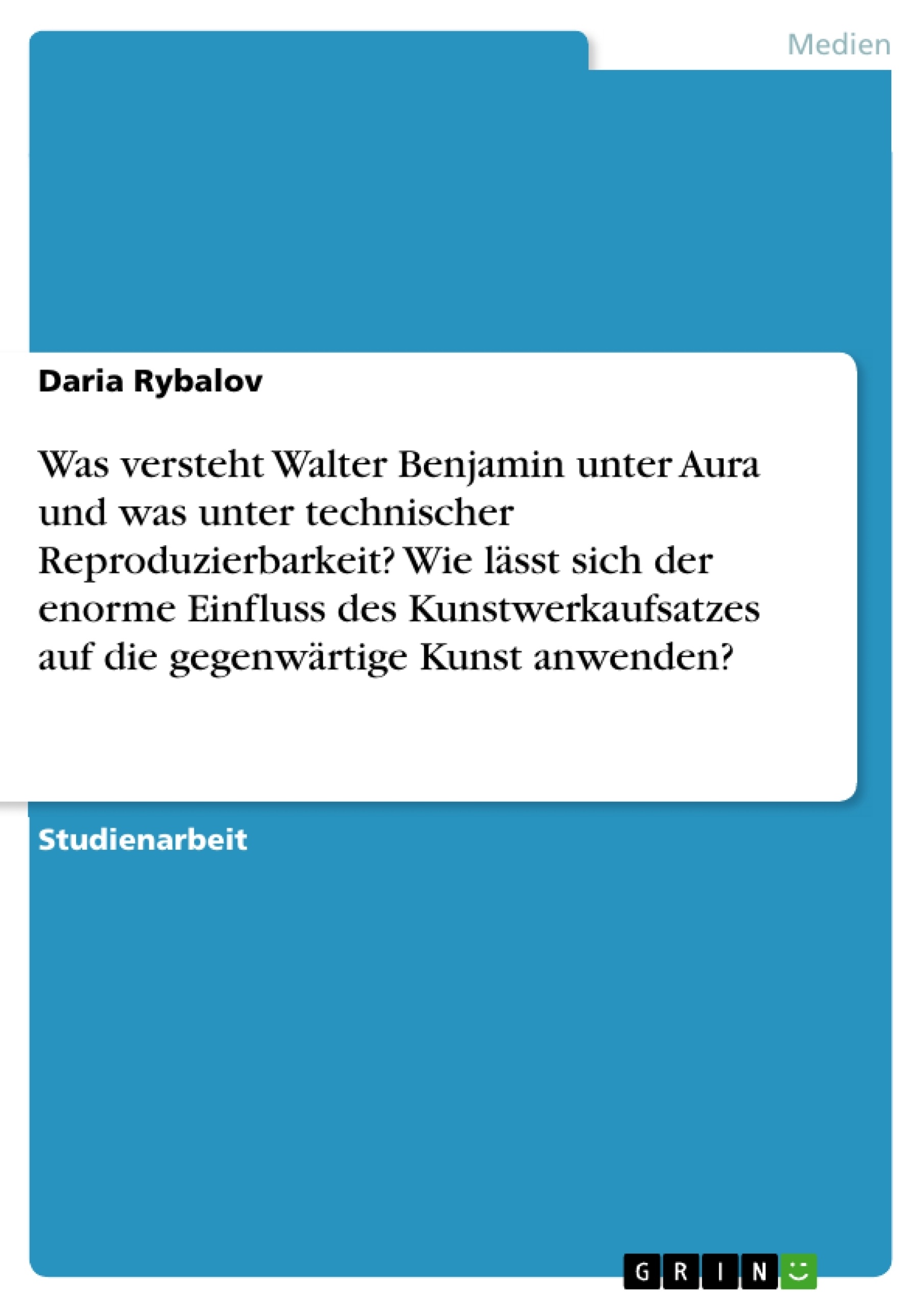Das Bedürfnis der Menschheit nach Reproduktion von Gegenständen oder gar der Imitation von Verhaltensweisen scheint eine im menschlichen Organismus selbst manifestierte Eigenschaft zu sein, die uns das Überleben in einem bestimmten und abgegrenzten Raum erleichtern soll. Die Herstellung uniformer Werkzeuge, militärischer Waffensysteme und die stilistischen Gemeinsamkeiten im Bereich der Baukunst zeugen schon früh vom menschlichen Trieb zum Rationalismus, ganz im Sinne der McLuhan`schen Prothesentheorie. Sich dieser historischen und jüngst sogar medienwissenschaftlichen Ereigniskette bewusst, unterscheidet Walter Benjamin in seinem Kunstwerkaufsatz explizit zwischen Original, Nachbildung und technischer Reproduktion. Die Darlegungen Benjamins, welcher vom Haus aus als Kunstkritiker gilt, verleiten nur allzu leicht dazu, den Überblick zu verlieren. Daher bietet es sich an, die von ihm aufgeführten Begrifflichkeiten separiert zu analysieren und im Anschluss verstärkt auf die Auswirkungen seines Aufsatzes in Bezug auf die heutige Kunst-, Medien- und Bildtheorie einzugehen. Ob und in welcher Art und Weise seine Arbeit noch heutzutage Aktualität besitzt, soll im Folgenden an Hand von kritischen Denkansätzen und den Arbeiten von Andy Warhol und Douglas Crimp betrachtet werden. Um in angemessenem Maße den medienrevolutionären Charakter seiner interdisziplinären Werke hervorzuheben, wird der unabstreitbaren Relevanz der Erfindung Gutenbergs bezüglich technischer Reproduktion, zumindest in dieser Arbeit und entgegen der gängigen Praxis, kein bis wenig Platz zur Erörterung bereitgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit
- Die „Aura“- Walter Benjamin
- Technische Reproduzierbarkeit – Walter Benjamin
- Der Kunstwerkaufsatz und seine Auswirkung auf die Bild- und Medientheorie
- Andy Warhol und Walter Benjamins These vom Auraverlust
- Andy Warhol
- Andy Warhols Reproduktion der Mona Lisa
- Douglas Crimp
- Die,,angeeignete Aura“
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text beschäftigt sich mit der These von Walter Benjamin, dass das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit seine Aura verliert. Im Mittelpunkt steht die Analyse des Begriffs der Aura und der technischen Reproduzierbarkeit, sowie deren Auswirkungen auf die Kunst- und Medientheorie.
- Der Begriff der Aura nach Walter Benjamin
- Die Auswirkungen der technischen Reproduzierbarkeit auf das Kunstwerk
- Die Aktualität von Benjamins These im Kontext der heutigen Bild- und Medientheorie
- Die Rezeption von Benjamins Kunstwerkaufsatz bei Andy Warhol und Douglas Crimp
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird das Bedürfnis der Menschheit nach Reproduktion von Gegenständen und Verhaltensweisen als eine im menschlichen Organismus selbst manifestierte Eigenschaft vorgestellt. Walter Benjamins Kunstwerkaufsatz wird im Kontext dieser historischen und medienwissenschaftlichen Entwicklungen betrachtet.
Kapitel 2.1 analysiert den Begriff der Aura nach Walter Benjamin. Die Aura wird als ein „Gespinst von Raum und Zeit“ definiert, das ein Kunstwerk in seinem einmaligen Dasein am Ort seiner Entstehung umgibt und seine Einbettung in Geschichte und Tradition repräsentiert. Die Aura wird als schwer zu erfassender Aspekt des Kunstwerks dargestellt, der sich der technischen Reproduzierbarkeit entzieht.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks und deren Auswirkungen auf die Aura. Benjamin argumentiert, dass durch die Massenproduktion von Kopien das Kunstwerk seine Einzigartigkeit und somit auch seine Aura verliert. Die technischen Reproduktionen lösen das Original von seinem Ort und seiner Geschichte und machen es für eine breite Masse zugänglich.
Kapitel 3 beleuchtet die weitreichenden Auswirkungen von Benjamins Kunstwerkaufsatz auf die Bild- und Medientheorie.
Das vierte Kapitel untersucht die Arbeit von Andy Warhol im Kontext von Benjamins These vom Auraverlust. Warhols Wiederholung und Reproduktion von Alltagsobjekten und ikonischen Bildern wird in Bezug zu Benjamins Argumentation betrachtet.
Kapitel 5 analysiert die Arbeiten von Douglas Crimp und dessen Auseinandersetzung mit der Aura im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit.
Schlüsselwörter
Der Text befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Aura, technische Reproduzierbarkeit, Kunstwerk, Original, Nachbildung, Zeitgeist, Massenmedien, Kunsttheorie, Medientheorie, Andy Warhol, Douglas Crimp.
- Arbeit zitieren
- Daria Rybalov (Autor:in), 2011, Was versteht Walter Benjamin unter Aura und was unter technischer Reproduzierbarkeit? Wie lässt sich der enorme Einfluss des Kunstwerkaufsatzes auf die gegenwärtige Kunst anwenden?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/187385