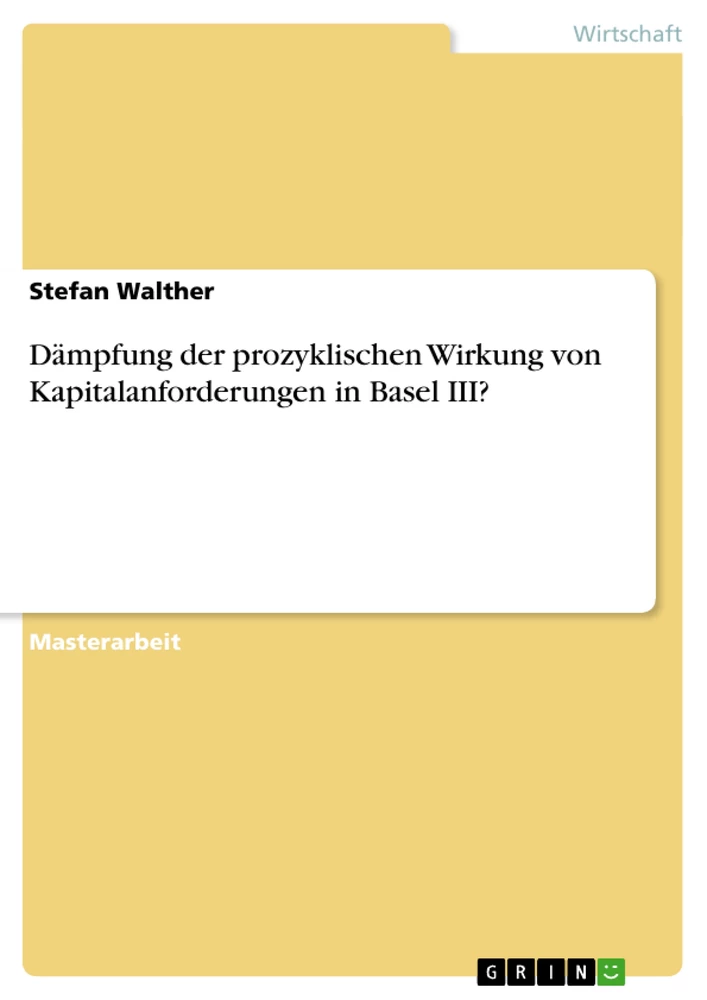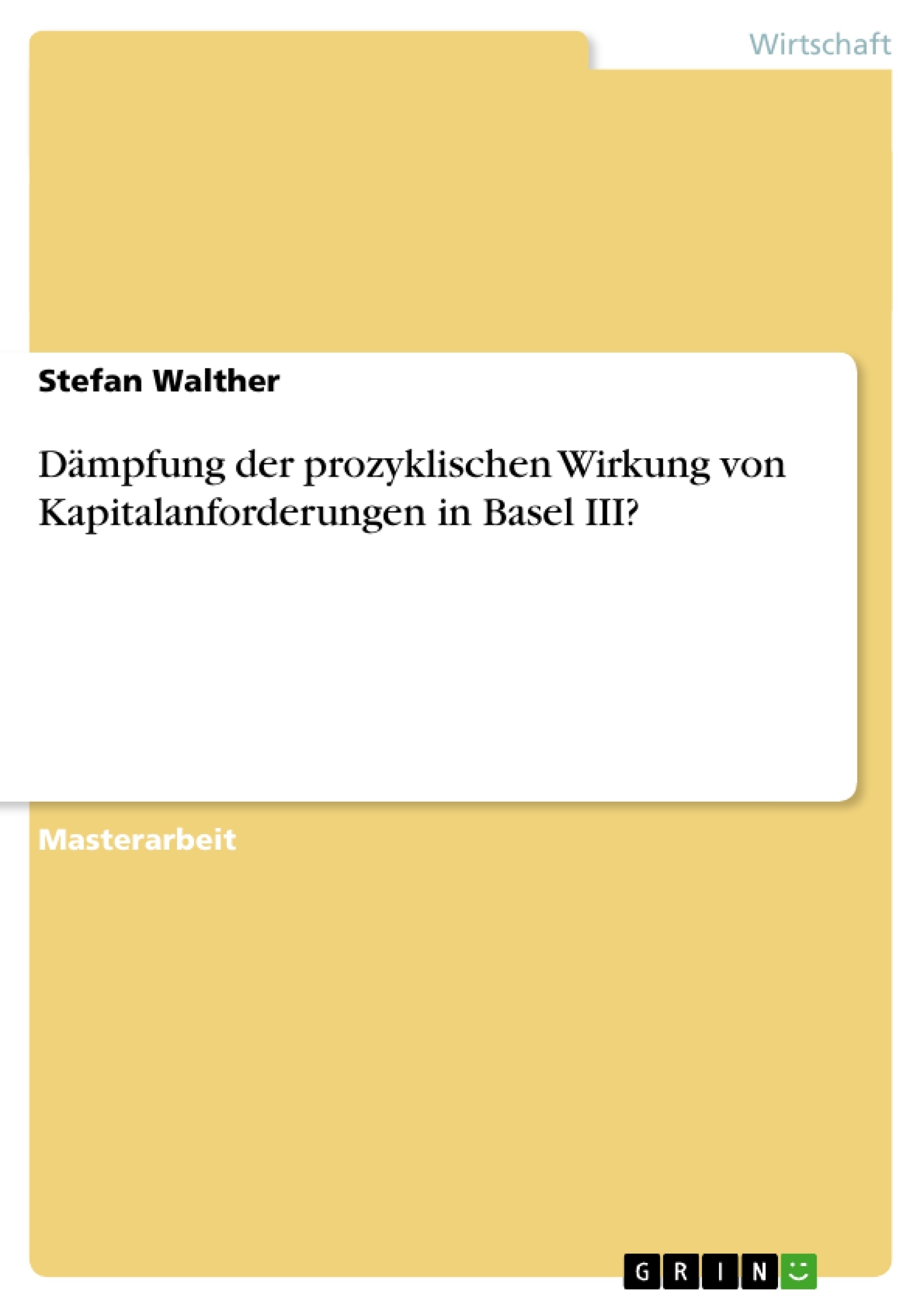Ungeachtet ihrer Bedeutung für die Solvenz der Institute werden risikoorientierte Mindesteigenkapitalanforderungen durchaus kritisch diskutiert. Sie stehen, nicht zuletzt durch die jüngste weltweite Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, im Verdacht, die per se prozyklische Tendenz der Bankenbranche zu verstärken. Verschiedene, im Laufe der Ausführungen noch zu erarbeitende Determinanten wirken mit dem Zyklus auf das Eigenkapital der Bank. Dies führt im Abschwung unter Umständen zu einer starken Reduktion der Kapitalbasis, während es unter wirtschaftlich besseren Rahmenbedingungen gegebenenfalls zu einer Überschätzung der tatsächlich vorhandenen Risikodeckungsmasse kommt. Im Kontext dieser Master-Thesis monieren Literatur und Praxis folglich die mit den regulatorischen Kapitalanforderungen einhergehenden Anreize für Institute, in konjunkturellen Boomphasen die Kreditvergabe exzessiv auszuweiten, während in Rezessionsphasen aufgrund steigender Kreditausfälle und höherer Kapitalanforderungen für die bestehenden Risikopositionen eine Neigung zur übermäßig restriktiven Kreditvergabe vorherrscht. Es besteht somit die Gefahr, dass durch das beschriebene Bankverhalten negative Rückkopplungen auf die Realwirtschaft entstehen, etwa wenn es durch angebotsseitige Verknappung der Darlehen zu einer Kreditklemme kommt. Diese Reduzierung der Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen und Haushalte könnte ceteris paribus zu einer Beschleunigung der Abwärtsdynamik beitragen sowie im Allgemeinen aufgrund der Verstärkung der jeweiligen Konjunkturphase dem originären wirtschaftspolitischen Ziel eines stetigen Wachstums entgegenwirken. Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht sieht in der prozyklischen Tendenz der Marktteilnehmer gar "… einen der stärksten destabilisierenden Einflüsse der Krise …".
Das Ziel der Arbeit ist es daher, neben einem Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur Problemstellung auch den Status quo der Reformbemühungen zu erarbeiten. Insbesondere sollen die vom Baseler Ausschuss vorgestellten Maßnahmen analysiert und im Kern die Frage beantwortet werden, ob es Basel III besser gelingen kann, die Prozyklizität der Mindestkapitalanforderungen zu dämpfen, als dies bisher festzustellen war.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Hintergründe der Prozyklizität von Mindestkapitalanforderungen
- 2.1 Risikosensitive Bankenregulierung unter Basel II
- 2.2 Aktuell potenziell prozyklisch wirkende Normen
- 2.2.1 Determinanten der Rechnungslegungsvorschriften
- 2.2.2 Determinanten der Bankenaufsicht
- 2.3 Lässt sich die Existenz der Prozyklizität empirisch belegen?
- 2.4 Zwischenfazit zu Auswirkungen und Bedeutung der Prozyklizität
- 3. Maßnahmen zur Dämpfung der Prozyklizität unter Basel III
- 3.1 Wesentliche Änderungen durch Basel III im Überblick
- 3.2 Die Maßnahmen des Baseler Ausschusses
- 3.2.1 Aufbau von Kapitalerhaltungspolstern
- 3.2.2 Anreize gegen eine exzessive Kreditausweitung
- 3.2.3 Reform der Risikovorsorge
- 3.2.4 Verringerung der Prozyklizität des IRB-Ansatzes
- 3.3 Zwischenfazit hinsichtlich der zu erwartenden Wirkungen
- 4. Dämpfung der Prozyklizität? – Kritische Würdigung ausgewählter Maßnahmen
- 4.1 Indikatoren zum Auf- und Abbau des antizyklischen Kapitalpuffers
- 4.1.1 Das Credit-to-GDP-Gap am Beispiel von Deutschland
- 4.1.2 Implikationen aus der Analyse bezüglich eines geeigneteren Indikators
- 4.2 Mögliche Folgen der Implementation der PD-Anpassung des CEBS
- 4.2.1 Die Auswirkungen am Beispiel eines Kreditportfolios
- 4.2.2 Begünstigt die PD-Anpassung risikoreichere Geschäfte?
- 4.3 Zwischenfazit zu den ausgewählten Maßnahmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die prozyklische Wirkung von Kapitalanforderungen im Rahmen von Basel III und analysiert Maßnahmen zur Dämpfung dieser Prozyklizität. Es werden Experteninterviews zur Einordnung der wissenschaftlichen Literatur und empirischen Daten herangezogen.
- Prozyklizität von Mindestkapitalanforderungen unter Basel II und Basel III
- Analyse der Maßnahmen des Baseler Ausschusses zur Dämpfung der Prozyklizität
- Kritische Würdigung ausgewählter Maßnahmen unter Berücksichtigung empirischer Daten
- Bewertung von Indikatoren für den Auf- und Abbau antizyklischer Kapitalpuffer
- Auswirkungen der PD-Anpassung des CEBS auf die Eigenkapitalunterlegung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 dient als Einleitung. Kapitel 2 beleuchtet die Hintergründe der Prozyklizität von Mindestkapitalanforderungen unter Basel II, analysiert potenziell prozyklisch wirkende Normen und untersucht die empirische Belegbarkeit der Prozyklizität. Kapitel 3 beschreibt die Maßnahmen des Baseler Ausschusses unter Basel III zur Dämpfung der Prozyklizität, inklusive Kapitalerhaltungspolster, Anreize gegen exzessive Kreditausweitung und Reform der Risikovorsorge. Kapitel 4 befasst sich kritisch mit ausgewählten Maßnahmen, untersucht Indikatoren zum Auf- und Abbau des antizyklischen Kapitalpuffers und analysiert die Folgen der PD-Anpassung des CEBS.
Schlüsselwörter
Basel III, Prozyklizität, Mindestkapitalanforderungen, Risikovorsorge, antizyklischer Kapitalpuffer, Credit-to-GDP-Gap, PD-Anpassung, CEBS, Bankenregulierung, empirische Analyse.
- Quote paper
- Stefan Walther (Author), 2011, Dämpfung der prozyklischen Wirkung von Kapitalanforderungen in Basel III?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/187030