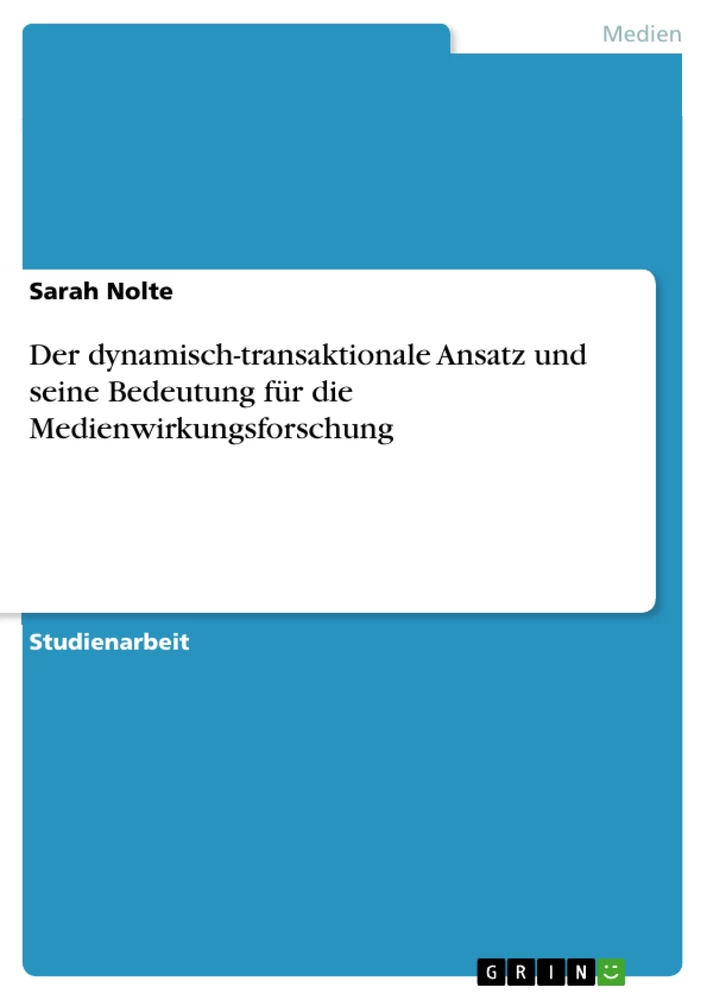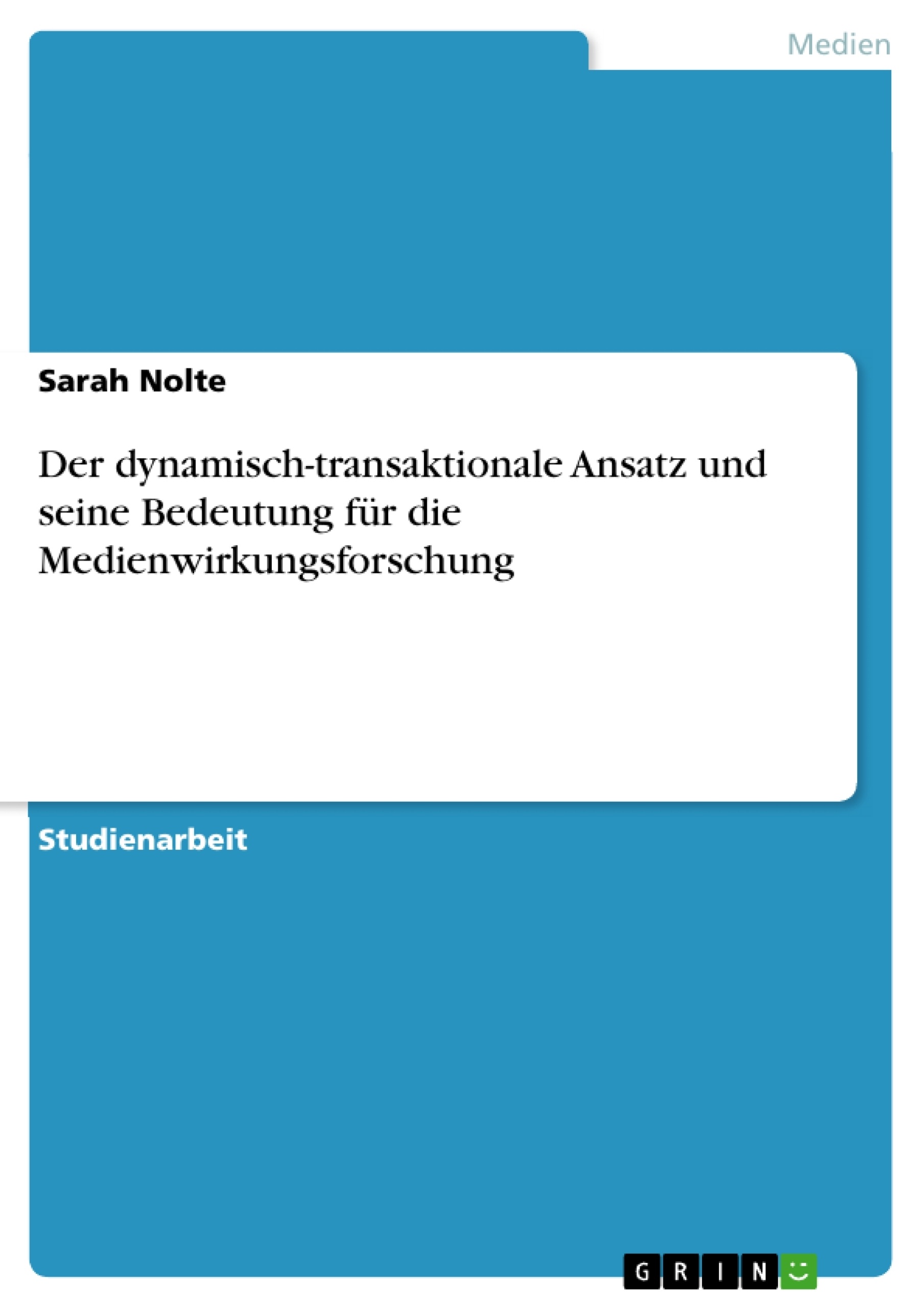Mehr als 20 Jahre nach Veröffentlichung der beiden Grundlagenartikel zum dynamisch-transaktionalen Ansatz durch Werner Früh und Klaus Schönbach, vermittelt die Forschungsliteratur immer noch kein eindeutiges Bild über den Wert des Ansatzes für die Kommunikationswissenschaft. Zwar ist der Ansatz aus der einschlägigen Literatur, aus Lehrbüchern und Lehrplänen nicht mehr wegzudenken, trotzdem wird er zum Teil negativ beurteilt. Außerdem halten sich hartnäckig Vorwürfe wie Überkomplexität und fehlende empirische Überprüfbarkeit.
Das Ziel dieser Arbeit soll nun darin bestehen, die Bedeutung des dynamisch-transaktionalen Ansatzes für die Medienwirkungsforschung herauszuarbeiten. Hierbei ist es unerlässlich sich zu Beginn mit dem Begriff der Medienwirkung auseinanderzusetzen, um die Veränderung in der Forschung besser nachvollziehen zu können. Hierbei soll aber eine einheitliche und auch moderne Definition gefunden werden, um die veränderte Sichtweise offenzulegen.
Rückblickend und als Grundlage für den späteren Teil der Ausarbeitung sollen zwei der grundlegenden Modelle der Wirkungsforschung in ihren Grundzügen kurz umrissen werden. Denn um ein Verständnis der Annnahmen des dynamisch-transaktionalen Ansatzes zu gewährleisten, ist einer Auseinandersetzung mit der Stimulus-Response-Theorie und des Uses- and- Gratification- Approach unerlässlich, da Schönbach und Früh auf diesen Ansätzen aufbauen und auf diese Weise auch der Neuwert ihrer Überlegungen deutlich wird. Nachdem nun der Ansatz in seinen wesentlichen Elementen vorgestellt wurde, soll nun seine Umsetzung und Anwendbarkeit am Beispiel der Dortmund- Studie diskutiert werden, welche 1984 auf sich aufmerksam machte. Abschließend wird der Versuch unternommen den Nutzen des Ansatzes in Form einer kritischen Auseinadersetzung herauszuarbeiten.
Die Untersuchung stützt sich schwerpunktmäßig auf die zwei Hauptwerke von Werner Früh: „Medienwirkungen: Das dynamisch-transaktionale Modell“ und „Realitätsvermittlung durch Massenmedien“, in denen die theoretischen Aspekte des Ansatzes dargelegt werden. Die Tatsache, dass die Fachliteratur von den Entwicklern des Ansatzes selbst verfasst wurde und andere Auseinandersetzungen mit dem Thema meist sehr kurz gehalten sind, soll in dieser Arbeit Berücksichtigung finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition des Begriffs Medienwirkung
- Grundlegende Modelle der Medienwirkungsforschung
- Stimulus-Response-Theorie
- Uses-and-Gratification-Approach
- Ein Paradigmenwechsel: Der dynamisch-transaktionale Ansatz
- Kernaussagen und Grundmodell
- Rezipient versus Kommunikator
- Transaktion
- Molare Sichtweise
- Dynamisierung
- Anwendung des Ansatzes in der Forschung
- Die Dortmund-Studie
- Mehrwert des dynamisch-transaktionalen Modells
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung des dynamisch-transaktionalen Ansatzes für die Medienwirkungsforschung. Sie beleuchtet die Entwicklung des Begriffs "Medienwirkung" und vergleicht ihn mit grundlegenden Modellen der Wirkungsforschung, um den Neuwert des dynamisch-transaktionalen Ansatzes hervorzuheben. Die Anwendung des Ansatzes wird anhand der Dortmund-Studie diskutiert. Abschließend wird der Nutzen des Ansatzes kritisch bewertet.
- Entwicklung des Begriffs Medienwirkung
- Vergleichende Analyse der Stimulus-Response-Theorie und des Uses-and-Gratification-Approach
- Darlegung des dynamisch-transaktionalen Ansatzes und seiner Kernelemente
- Anwendung des Ansatzes in der empirischen Forschung (Dortmund-Studie)
- Bewertung des Mehrwerts des dynamisch-transaktionalen Ansatzes für die Medienwirkungsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Forschungslücke bezüglich des dynamisch-transaktionalen Ansatzes in der Kommunikationswissenschaft. Sie begründet die Notwendigkeit einer tiefergehenden Auseinandersetzung mit diesem Ansatz und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit der Definition von Medienwirkung, grundlegenden Wirkungsmodellen und schließlich mit dem dynamisch-transaktionalen Ansatz selbst befasst, um dessen Bedeutung für die Medienwirkungsforschung herauszuarbeiten. Die Arbeit konzentriert sich dabei insbesondere auf die Werke von Werner Früh.
Definition des Begriffs Medienwirkung: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Begriffs „Medienwirkung“ in der Kommunikations- und Medienwissenschaft. Es zeigt, wie sich die Sichtweise auf das Manipulations- und Wirkungspotenzial von Medien im Laufe der Zeit verändert hat und wie der Begriff heute verstanden wird, nämlich als alle Veränderungen, die ganz oder teilweise auf den Kontakt mit Medien und deren Inhalten zurückgeführt werden können. Es wird betont, dass diese Wirkungen einzelne Rezipienten, Gruppen oder die Gesellschaft betreffen können und kurz-, mittel- oder langfristig auftreten. Die Definition berücksichtigt die Komplexität des Prozesses und den Einfluss verschiedener Faktoren.
Grundlegende Modelle der Medienwirkungsforschung: Dieses Kapitel stellt zwei grundlegende Modelle der Medienwirkungsforschung gegenüber: die Stimulus-Response-Theorie und den Uses-and-Gratification-Approach. Die Stimulus-Response-Theorie repräsentiert eine frühe, medienzentrierte Sichtweise, die von einer direkten, kausalen Beziehung zwischen Stimulus (Medieninhalt) und Response (Wirkung) ausgeht. Im Gegensatz dazu steht der Uses-and-Gratification-Approach, der eine rezipientenzentrierte Perspektive einnimmt und betont, dass Rezipienten Medien aktiv nutzen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Der Vergleich dieser beiden gegensätzlichen Ansätze bildet die Grundlage für das Verständnis des dynamisch-transaktionalen Ansatzes, der als Synthese beider betrachtet werden kann.
Ein Paradigmenwechsel: Der dynamisch-transaktionale Ansatz: Dieses Kapitel beschreibt den dynamisch-transaktionalen Ansatz von Schönbach und Früh als ein neues Paradigma der Medienwirkungsforschung. Es überwindet die einseitigen Perspektiven der vorherigen Modelle, indem es die Wechselwirkung zwischen Medien und Rezipienten in den Mittelpunkt stellt. Die Kernaussagen und das Grundmodell werden erläutert, wobei die Konzepte der Transaktion, der molaren Sichtweise und der Dynamisierung im Detail behandelt werden. Der Ansatz geht über eine einfache Synthese der vorherigen Modelle hinaus und bietet eine komplexere und umfassendere Erklärung von Medienwirkungen.
Anwendung des Ansatzes in der Forschung: Dieser Abschnitt diskutiert die Anwendung des dynamisch-transaktionalen Ansatzes in der Forschung, speziell anhand der Dortmund-Studie. Der Mehrwert des Modells wird im Kontext der empirischen Forschung beleuchtet und dessen Bedeutung für ein tieferes Verständnis von Medienwirkungen herausgestellt. Die Diskussion konzentriert sich auf die praktische Anwendbarkeit und die Erkenntnisse, die durch die Anwendung des Modells gewonnen werden können.
Schlüsselwörter
Dynamisch-transaktionaler Ansatz, Medienwirkung, Stimulus-Response-Theorie, Uses-and-Gratification-Approach, Medienrezeption, Kommunikationsprozess, Dortmund-Studie, Wirkungsforschung, Rezipient, Kommunikator, Transaktion, molare Sichtweise, Dynamisierung.
Häufig gestellte Fragen: Dynamisch-transaktionaler Ansatz in der Medienwirkungsforschung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den dynamisch-transaktionalen Ansatz in der Medienwirkungsforschung. Sie beleuchtet dessen Bedeutung, vergleicht ihn mit älteren Modellen und diskutiert seine Anwendung anhand der Dortmund-Studie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Begriffs "Medienwirkung", vergleicht die Stimulus-Response-Theorie und den Uses-and-Gratification-Approach, erläutert den dynamisch-transaktionalen Ansatz (inkl. Kernelemente wie Transaktion, molare Sichtweise und Dynamisierung) und diskutiert dessen Anwendung in der empirischen Forschung (Dortmund-Studie). Der Mehrwert des Ansatzes wird kritisch bewertet.
Welche Modelle der Medienwirkungsforschung werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Stimulus-Response-Theorie (eine medienzentrierte, kausale Sichtweise) und den Uses-and-Gratification-Approach (eine rezipientenzentrierte Perspektive, die die Bedürfnisse der Rezipienten betont). Der dynamisch-transaktionale Ansatz wird als Synthese und Weiterentwicklung dieser beiden Modelle dargestellt.
Was ist der dynamisch-transaktionale Ansatz?
Der dynamisch-transaktionale Ansatz, insbesondere von Schönbach und Früh, stellt ein neues Paradigma in der Medienwirkungsforschung dar. Er überwindet die einseitigen Perspektiven älterer Modelle, indem er die Wechselwirkung zwischen Medien und Rezipienten in den Mittelpunkt stellt. Kernkonzepte sind Transaktion, molare Sichtweise und Dynamisierung.
Welche Rolle spielt die Dortmund-Studie?
Die Dortmund-Studie dient als Beispiel für die Anwendung des dynamisch-transaktionalen Ansatzes in der empirischen Forschung. Die Arbeit analysiert, welchen Mehrwert das Modell in diesem Kontext bietet und welche Erkenntnisse durch seine Anwendung gewonnen werden können.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dynamisch-transaktionaler Ansatz, Medienwirkung, Stimulus-Response-Theorie, Uses-and-Gratification-Approach, Medienrezeption, Kommunikationsprozess, Dortmund-Studie, Wirkungsforschung, Rezipient, Kommunikator, Transaktion, molare Sichtweise, Dynamisierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Definition von Medienwirkung, zu grundlegenden Wirkungsmodellen (Stimulus-Response und Uses-and-Gratification), zum dynamisch-transaktionalen Ansatz, zu dessen Anwendung in der Forschung (Dortmund-Studie) und eine Schlussbetrachtung. Ein Inhaltsverzeichnis und Kapitelzusammenfassungen sind enthalten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende und Wissenschaftler der Kommunikationswissenschaft, Medienwissenschaft und verwandter Disziplinen, die sich mit Medienwirkungen und -rezeption auseinandersetzen.
Welche Forschungslücke schließt die Arbeit?
Die Arbeit adressiert die Forschungslücke bezüglich der umfassenden Darstellung und Bewertung des dynamisch-transaktionalen Ansatzes in der Kommunikationswissenschaft und hebt dessen Bedeutung für ein tieferes Verständnis von Medienwirkungen hervor.
- Quote paper
- Sarah Nolte (Author), 2007, Der dynamisch-transaktionale Ansatz und seine Bedeutung für die Medienwirkungsforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/186976