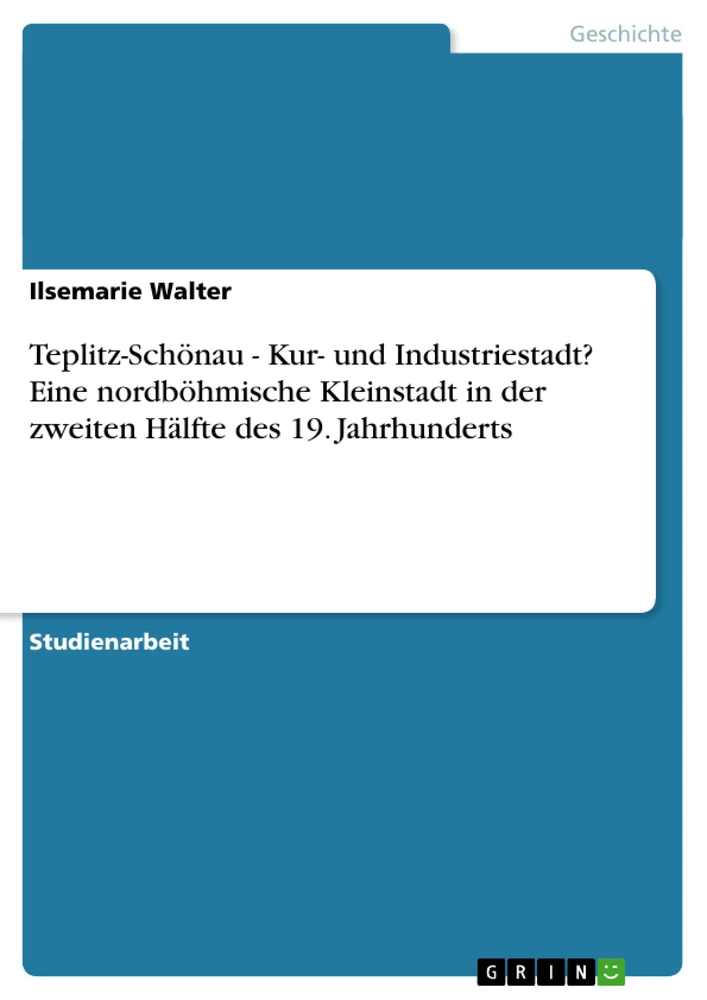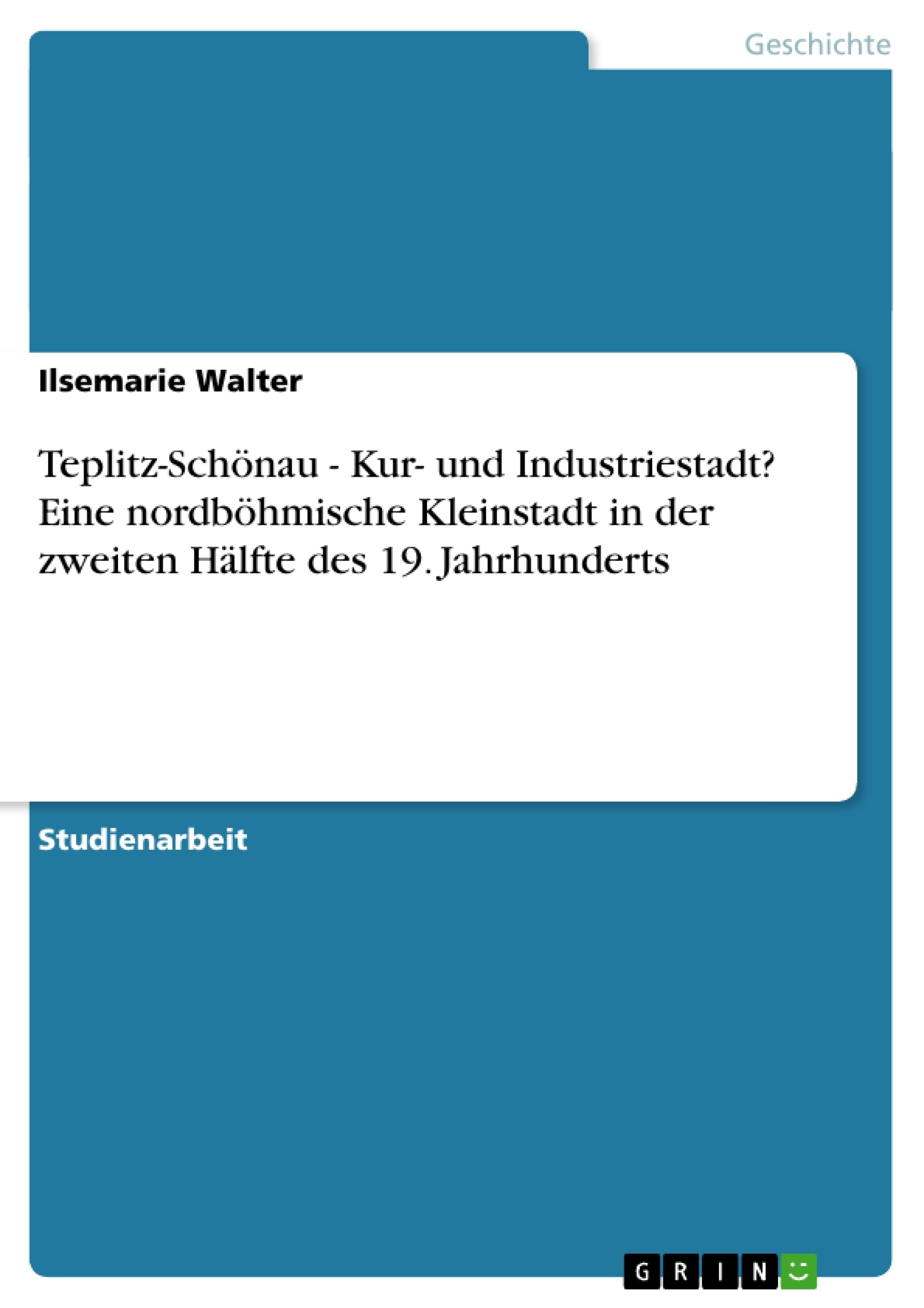In der Literatur über berühmte Badeorte wird Teplitz-Schönau meist in eine Reihe mit den anderen drei nordböhmischen Kurorten Karlsbad, Marienbad und Franzensbad gestellt. Erst bei genauerem Lesen findet man kurze Bemerkungen darüber, dass Teplitz auch ein bedeutender Industrieort war. Im Zentrum dieser Arbeit steht die Frage, wie zwei so widersprüchliche Entwicklungen miteinander zu vereinbaren waren.
Der erste Teil der Arbeit enthält einige allgemeine Angaben über die Entwicklung der Stadt. Im Anschluss daran werden drei Ereignisse aus der Geschichte der Stadt herausgegriffen: der Anschluss an das Eisenbahnnetz (1858), die sogenannte „Quellkatastrophe von Teplitz“ (1879) und der Streit um die Abhaltung eines tschechischen Turnerfestes (1896).
Die Weichen in Richtung Industrialisierung wurden in Teplitz schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Eisenbahnbau gestellt. Nach außen hin wurde jedoch das Image der „uralten Thermenstadt“ immer aufrecht erhalten. Bedingt durch die reichen Kohlevorkommen waren viele Unternehmen in der Teplitzer Gegend auf wirtschaftliche Zusammenschlüsse ausgerichtet. Sie waren finanzkräftig und konnten daher auch beträchtlichen Einfluss auf die Teplitzer Gemeindepolitik ausüben. Nationalistische Tendenzen waren unter Teilen der deutschen Bürgerlichen schon Mitte des Jahrhunderts spürbar; gegen Ende des Jahrhunderts wurden auch die Deutschliberalen immer stärker in diese Richtung gedrängt. Wer in der Gemeindepolitik bestehen wollte, musste sich verbal – mit mehr oder weniger innerer Überzeugung – zum „Deutschtum“ und zum Doppelcharakter der Stadt (Kurort und Industriestadt) bekennen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahm der Antisemitismus in Teplitz zu, einer Stadt mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an jüdischer Bevölkerung.
Aus heutiger Sicht gesehen wird deutlich, dass bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Teplitz die Basis zu zwei Prozessen gelegt wurde, deren katastrophale Folgen erst später sichtbar wurden: zur Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen und zur Umweltzerstörung. Der Nationalitätenhass trug wesentlich zu den unheilvollen Ereignissen von 1938, 1939 und 1945 bei. Die Auswirkungen der Umweltzerstörung wurden erst 1989, als die durch die Politik aufgerichteten Kommunikationsschranken fielen, in ihrem vollen Ausmaß offenbar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Fragestellung der Arbeit
- 2. Benützte Quellen
- 3. Die Stadt Teplitz – Daten und Zahlen
- 3.1 Teplitz die „uralte Thermenstadt“
- 3.2 Teplitz die wachsende Industrie- und Schulstadt
- 3.3 Die Bewohner von Teplitz
- 3.4 Die Gemeindeverwaltung
- 3.5 Schönau, kleine Schwester und Konkurrentin
- 3.6 Zentrum oder Peripherie?
- 4. Der Anschluss an das Eisenbahnnetz 1858
- 4.1 Die „Cur-Commission“
- 4.2 Finanzierungsprobleme
- 4.3 Nicht offen ausgesprochene Motive
- 4.4 Die folgenden Jahre
- 4.5 Resümee
- 5. Die „Quellkatastrophe“ von 1879
- 5.1 Die Ereignisse
- 5.2 Der 16jährige Streit zwischen Quellen- und Bergwerksbesitzern
- 5.3 Verschiedene Interessen
- 6. Der Streit um das in Teplitz geplante „Sokolfest“ 1896
- 6.1 Die Verhinderung des Festes
- 6.2 Die einzelnen Positionen
- 6.3 Einige Ereignisse der folgenden Jahre
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die komplexe Entwicklung der nordböhmischen Kleinstadt Teplitz-Schönau in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie beleuchtet den scheinbaren Widerspruch zwischen der Entwicklung als Kurort und als bedeutender Industriestandort. Die Arbeit analysiert die Entscheidungsfindungsprozesse, identifiziert Konfliktlinien und untersucht die Einstellungen der Bevölkerung zu diesen Herausforderungen.
- Die Koexistenz von Kur- und Industrietätigkeit in Teplitz-Schönau.
- Die Rolle der Eisenbahn im Prozess der Industrialisierung.
- Die „Quellkatastrophe“ von 1879 und ihre Auswirkungen.
- Der nationale Konflikt um das geplante „Sokolfest“ 1896.
- Machtstrukturen und Entscheidungsfindungsprozesse in Teplitz-Schönau.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Fragestellung der Arbeit: Die Arbeit untersucht die scheinbar widersprüchliche Entwicklung Teplitz-Schönaus als Kur- und Industriestadt im 19. Jahrhundert. Sie fragt nach den Entscheidungsträgern, Konfliktlinien und der öffentlichen Meinung zu diesem Thema. Die Arbeit konzentriert sich auf drei Schlüsselereignisse: den Eisenbahnbau (1858), die „Quellkatastrophe“ (1879) und den Streit um das Sokolfest (1896), um die Machtverhältnisse zu analysieren.
2. Benützte Quellen: Aufgrund von Zeit- und Zugangsbeschränkungen konzentriert sich die Autorin auf in Teplitz erschienene Zeitungen, lokalgeschichtliche Darstellungen, Stadtführer, Statistiken und weitere Literatur. Der Mangel an lokalen Archivalien wie Wählerlisten wird als Einschränkung erwähnt. Die Autorin beschreibt die verwendeten Zeitungen, darunter den „Teplitz-Schönauer Anzeiger“, das „Teplitzer Wochenblatt“, die „Teplitz-Schönauer Nachrichten“ und die „Teplitzer Zeitung“, und hebt deren unterschiedliche politische Ausrichtungen hervor. Sie analysiert auch zwei lokalhistorische Werke: Hallwichs deutschnational geprägtes Werk und Johns kommunalpolitisch geprägte Chronik, wobei sie die Vor- und Nachteile beider Quellen kritisch bewertet. Weitere Informationen liefert die Arbeit von Paul Wanie.
3. Die Stadt Teplitz – Daten und Zahlen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Entwicklung Teplitz, beginnend mit seiner Geschichte als alter Kurort und seiner wachsenden Bedeutung als Industriestadt. Es beleuchtet die demografische Entwicklung, die Struktur der Gemeindeverwaltung und den Einfluss der Schwesterstadt Schönau. Es analysiert die Stellung Teplitz im Kontext der Region – Zentrum oder Peripherie – im 19. Jahrhundert. Die Kapitelteil behandeln die verschiedenen Aspekte von Teplitz als Kurort und Industriestadt und analysieren die jeweiligen Entwicklungen.
4. Der Anschluss an das Eisenbahnnetz 1858: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Einfluss des Eisenbahnanschlusses 1858 auf Teplitz. Es untersucht die Rolle der „Cur-Commission“, die Finanzierungsprobleme und die nicht offen ausgesprochenen Motive hinter dem Projekt. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des Eisenbahnanschlusses für die Industrialisierung der Stadt und die sich daraus ergebenden Veränderungen. Die Analyse der folgenden Jahre zeigt die langfristigen Auswirkungen dieser Entwicklung.
5. Die „Quellkatastrophe“ von 1879: Dieses Kapitel beschreibt die „Quellkatastrophe“ und den 16-jährigen Rechtsstreit zwischen Quellen- und Bergwerksbesitzern. Es analysiert die verschiedenen Interessen und ihre Auswirkungen auf die Stadt, insbesondere die Bedrohung der Kurortfunktion. Der Fokus liegt auf den Folgen des Konflikts für die Stadt und deren Bewohner.
6. Der Streit um das in Teplitz geplante „Sokolfest“ 1896: Dieses Kapitel analysiert den nationalen Konflikt um die Abhaltung eines tschechischen Turnerfestes in Teplitz-Schönau 1896. Es beschreibt die Verhinderung des Festes, die beteiligten Positionen und die Ereignisse der Folgejahre. Das Kapitel beleuchtet die nationalen Spannungen und ihre Auswirkung auf die Stadt.
Schlüsselwörter
Teplitz-Schönau, Nordböhmen, Kurort, Industriestadt, 19. Jahrhundert, Industrialisierung, Eisenbahn, „Quellkatastrophe“, Sokolfest, Nationalitätenkonflikt, Gemeindeverwaltung, Machtstrukturen, Lokalgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über Teplitz-Schönau
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der nordböhmischen Stadt Teplitz-Schönau im 19. Jahrhundert, insbesondere den scheinbaren Widerspruch zwischen ihrer Funktion als Kurort und als bedeutender Industriestandort. Sie analysiert Entscheidungsfindungsprozesse, Konflikte und die öffentliche Meinung zu diesen Herausforderungen.
Welche Zeitspanne wird betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Welche Schlüsselereignisse werden analysiert?
Drei zentrale Ereignisse stehen im Mittelpunkt der Analyse: der Anschluss an das Eisenbahnnetz 1858, die „Quellkatastrophe“ von 1879 und der Streit um das geplante „Sokolfest“ 1896. Diese Ereignisse dienen der Untersuchung von Machtstrukturen und Konflikten in der Stadt.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf in Teplitz erschienenen Zeitungen (z.B. „Teplitz-Schönauer Anzeiger“, „Teplitzer Wochenblatt“, „Teplitz-Schönauer Nachrichten“, „Teplitzer Zeitung“), lokalgeschichtlichen Darstellungen (u.a. Werke von Hallwich und Johns), Stadtführern, Statistiken und weiterer Literatur. Der Mangel an lokalen Archivalien wird als Einschränkung genannt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Koexistenz von Kur- und Industrietätigkeit, die Rolle der Eisenbahn bei der Industrialisierung, die „Quellkatastrophe“ und ihre Folgen, den nationalen Konflikt um das Sokolfest, sowie Machtstrukturen und Entscheidungsfindungsprozesse in Teplitz-Schönau.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Fragestellung, benutzte Quellen, Daten und Zahlen zu Teplitz, der Eisenbahnbau, die „Quellkatastrophe“, der Streit um das Sokolfest und eine Zusammenfassung. Jedes Kapitel untersucht einen Aspekt der Entwicklung Teplitz-Schönaus im 19. Jahrhundert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit analysiert die komplexen Entwicklungsprozesse in Teplitz-Schönau und zeigt die Herausforderungen und Konflikte auf, die sich aus der Koexistenz von Kur- und Industrietätigkeit, sowie aus nationalen Spannungen ergaben. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Kapitel "Zusammenfassung" detailliert beschrieben.
Welche Einschränkungen gibt es?
Die Autorin weist auf den Mangel an lokalen Archivalien (z.B. Wählerlisten) hin, der die Forschung einschränkte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Teplitz-Schönau, Nordböhmen, Kurort, Industriestadt, 19. Jahrhundert, Industrialisierung, Eisenbahn, „Quellkatastrophe“, Sokolfest, Nationalitätenkonflikt, Gemeindeverwaltung, Machtstrukturen, Lokalgeschichte.
- Quote paper
- Ilsemarie Walter (Author), 2002, Teplitz-Schönau: Kur- und Industriestadt? Eine nordböhmische Kleinstadt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/18696