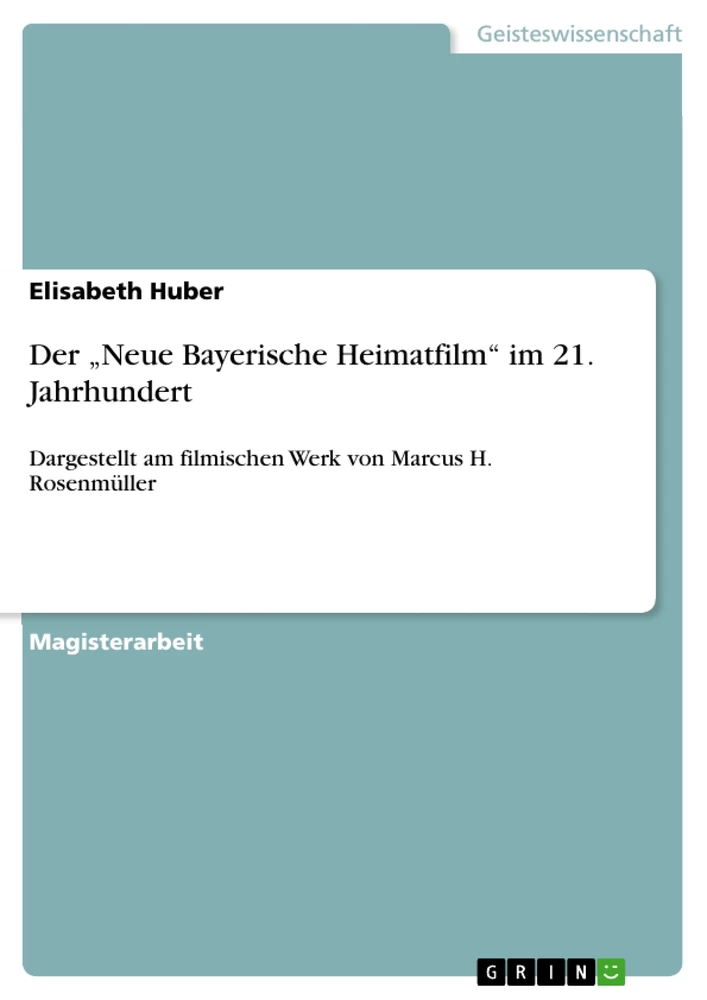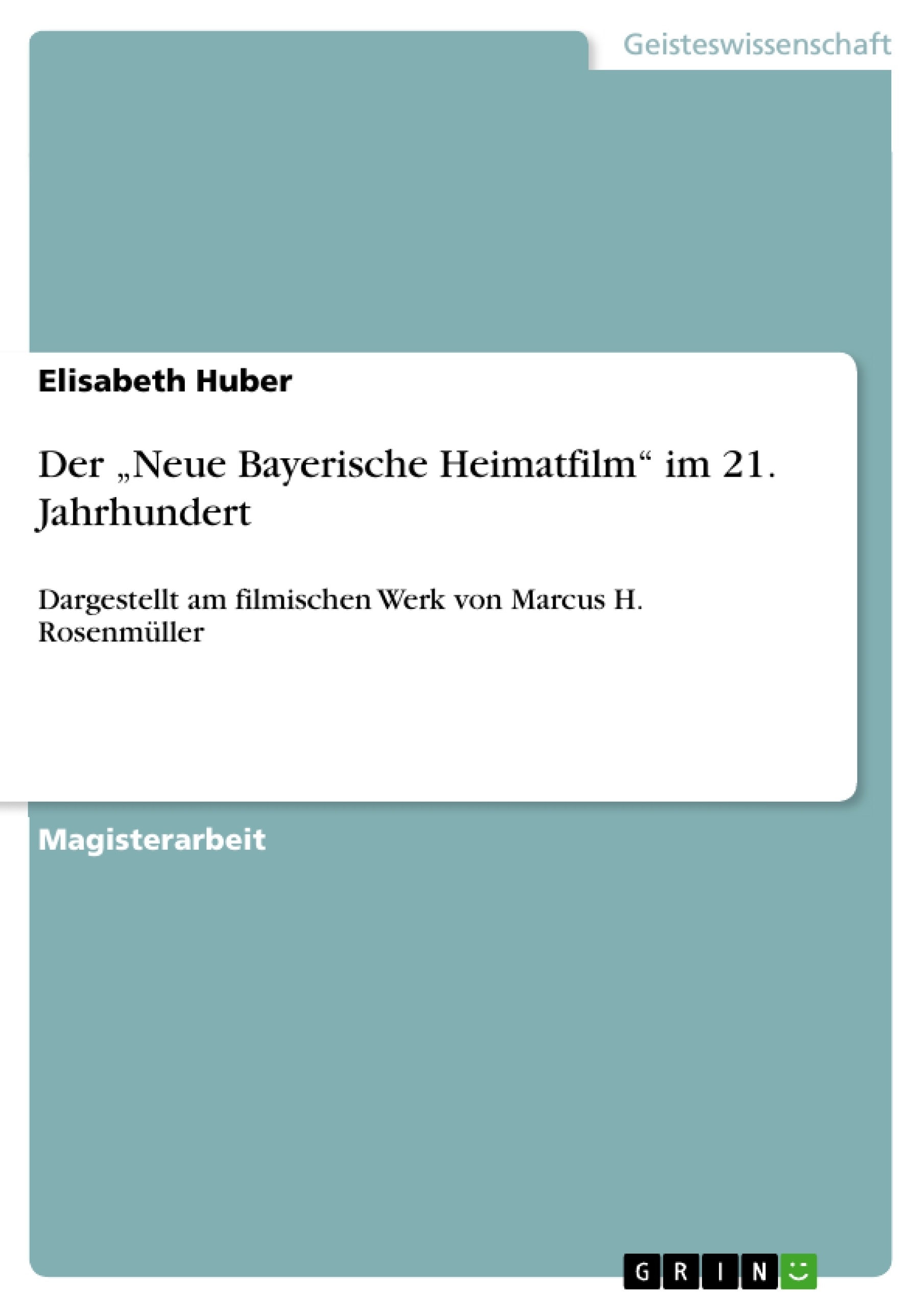Heimatfilm: Kitsch, ‚heile-Welt‘, Schwarzwald, Folklorismus, Heide, idyllische Natur, Heimat, Trivialität, Provinz ‚Zieprack‘ , Happy End.
Dies sind Assoziationen, die mit dem Wort Heimatfilm in Verbindung gebracht werden. In den 1950er Jahren entstand dieses erste genuin deutsche Genre, das durchaus grob gekürzt mit diesen Vokabeln definiert werden kann. Bis zum Ende der 1960er Jahre konnte der traditionelle Heimatfilm große kommerzielle Erfolge feiern. Doch der Beigeschmack der Trivialität blieb die Jahrzehnte hindurch an diesem Genre haften. Kein Regisseur, der als Künstler ernst genommen werden wollte, beschäftigte sich mit dieser Filmgattung. Vereinzelt wurden in den 1970er Jahren Heimatfilme produziert, die solche Begriffe, wie oben genannt, als zynisches Zitat aufnahmen und gesellschaftskritisch auftraten. Doch diese Filme blieben die Minderheit.
Im Jahr 2001 schließlich kam der Film DIE SCHEINHEILIGEN in die Kinos, gefolgt von HIERANKL 2003 und 2005 GRENZEVERKEHR. Plötzlich gab es Regisseure, die sich wieder dem Thema Heimat und der Provinz zuwandten. Der „Charme des Regionalen“ hielt wieder Einzug in die bayerische Kinolandschaft und das mit Erfolg. Maßgeblich dazu beigetragen haben auch die Filme von Marcus H. Rosenmüller. Allen voran sein Erstlingswerk WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOT, der in etwa 2 Millionen Zuschauer bundesweit verzeichnen konnte. Damit haben die Regisseure Hans Steinbichler (HIERANKL), Thomas Kronthaler (DIE SCHEINHEILIGEN), Stefan Betz (GRENZVERKEHR) und Marcus H. Rosenmüller (WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOT) eine Entwicklung angestoßen, die Kritiker und Filmtheoretiker mit der „Neue Bayerische Heimatfilm“ betiteln. Die „Neuen Wilden“, wie es in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung hieß, gehen sorglos mit ihren bayerischen Wurzeln um. Heimat ist bei ihnen keine kitschig-heile Welt, aber auch nicht das ‚Schreckbild-Land‘, wie einst kritische Heimatfilme wie von Volker Schlöndorff das Bild Heimat zeichneten.
Diese Arbeit geht nun der Frage nach, wie die „Neuen Bayerischen Heimatfilme“ in die Tradition der klassischen Heimatfilme eingeordnet werden können. Außerdem betrachtet die Arbeit die Filme von Marcus H. Rosenmüller genauer, um herauszufinden, was die Besonderheiten der Filme sind und warum sie dem „Neuen Bayerischen Heimatfilmen“ zugeordnet werden können.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- 1 Das Genre Heimatfilm und seine Merkmale
- 1.1 Der traditionelle Heimatfilm
- 1.2 Der kritische Heimatfilm
- 2 Die Geschichte des Heimatfilms von 1918 bis 2011
- 2.1 Der Berg- und Volksfilm als Vorreiter des Heimatfilms
- 2.2 Der Heimatfilm und seine Rolle im Nationalsozialismus
- 2.3 Die Trümmerfilme in den Nachkriegsjahren
- 2.4 Die Fünfziger Jahre und der Heimatfilm-Boom
- 2.5 Der Jägerporno und der Touristenfilm in den 1960er und 1970er Jahren
- 2.6 Das „Oberhausener Manifest“ und der „kritische Heimatfilm“
- 2.7 Die neue Vielseitigkeit des Heimatfilms in den 1980er Jahren
- 2.8 Die 1990er Jahre und die Flaute der Heimatfilm-Produktionen
- 2.9 Das Jahr 2001 und die Geburt des „Neuen Bayerischen Heimatfilms“
- II Marcus H. Rosenmüller und sein filmisches Werk
- 1 Die Biographie
- 2 Die Filmographie
- 3 Die Filme: Beschreibung des Inhalts, Darstellung der vorhandenen Genremerkmale und Besonderheiten, Untersuchung der Rezensionen
- 3.1 Wer früher stirbt ist länger tot
- 3.2 Schwere Jungs
- 3.3 Beste Zeit
- 3.4 Beste Gegend
- 3.5 Räuber Kneissl
- 3.6 Die Perlmutterfarbe
- III Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einordnung des „Neuen Bayerischen Heimatfilms“ in die Tradition des klassischen Heimatfilms. Der Fokus liegt auf den Filmen von Marcus H. Rosenmüller, um deren Besonderheiten und die Gründe für ihre Zuordnung zum „Neuen Bayerischen Heimatfilm“ zu ergründen.
- Definition des Genres „Heimatfilm“ und dessen Merkmale (traditionell und kritisch)
- Historische Entwicklung des Heimatfilms von den Anfängen bis zum Jahr 2011
- Analyse der Filme von Marcus H. Rosenmüller hinsichtlich ihrer Genremerkmale und Besonderheiten
- Untersuchung der Rezensionen zu den Filmen von Marcus H. Rosenmüller
- Einordnung der Filme von Marcus H. Rosenmüller in den Kontext des „Neuen Bayerischen Heimatfilms“
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die gängigen Assoziationen mit dem Begriff „Heimatfilm“. Sie skizziert die Entwicklung vom traditionellen, kommerziell erfolgreichen Heimatfilm der 1950er Jahre hin zum kritischen Heimatfilm und schließlich zum „Neuen Bayerischen Heimatfilm“, der seit Anfang der 2000er Jahre eine Renaissance des Genres markiert, beispielhaft dargestellt an den Werken von Regisseuren wie Marcus H. Rosenmüller. Die Arbeit benennt die Forschungsfrage nach der Einordnung der „Neuen Bayerischen Heimatfilme“ in die Tradition des klassischen Heimatfilms und skizziert die Methodik.
1 Das Genre Heimatfilm und seine Merkmale: Dieses Kapitel definiert das Genre „Heimatfilm“, indem es die Merkmale des traditionellen und des kritischen Heimatfilms differenziert darstellt. Der traditionelle Heimatfilm wird anhand von Aspekten wie Milieu, Natur, Personen, Wertesystem und Handlung charakterisiert, während der kritische Heimatfilm als Gegenbewegung mit gesellschaftskritischen Elementen und ironischer Brechung der traditionellen Klischees beschrieben wird. Die Kapitel analysieren die jeweiligen Eigenheiten und Unterschiede der beiden Strömungen.
2 Die Geschichte des Heimatfilms von 1918 bis 2011: Dieses Kapitel bietet eine chronologische Übersicht über die Geschichte des Heimatfilms, beginnend mit den Berg- und Volksfilmen der 1920er Jahre. Es beleuchtet die Rolle des Heimatfilms im Nationalsozialismus, die Trümmerfilme der Nachkriegszeit, den Boom der 1950er Jahre, die kritischen Filme der 1960er und 70er Jahre, die Entwicklungen der 1980er und 90er, und schließlich den Aufstieg des „Neuen Bayerischen Heimatfilms“ um die Jahrtausendwende. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von ästhetischen und inhaltlichen Merkmalen im Kontext der jeweiligen gesellschaftlichen und politischen Situation.
II Marcus H. Rosenmüller und sein filmisches Werk: Dieser Teil der Arbeit konzentriert sich auf das filmische Werk von Marcus H. Rosenmüller. Nach einer kurzen Biographie und Filmographie werden sechs seiner Filme im Detail analysiert. Für jeden Film werden allgemeine Informationen (Darsteller, Drehorte etc.), der Inhalt, Genremerkmale und Besonderheiten sowie Rezensionen von Filmkritikern dargestellt. Die Analyse zielt darauf ab, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu traditionellen und kritischen Heimatfilmen aufzuzeigen und die Einordnung in den „Neuen Bayerischen Heimatfilm“ zu begründen.
Schlüsselwörter
Heimatfilm, Neuer Bayerischer Heimatfilm, Marcus H. Rosenmüller, traditioneller Heimatfilm, kritischer Heimatfilm, Genremerkmale, Filmgeschichte, regionale Identität, Bayern, Provinz, Gesellschaftskritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse des „Neuen Bayerischen Heimatfilms“ am Beispiel von Marcus H. Rosenmüller
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den „Neuen Bayerischen Heimatfilm“ und seine Einordnung in die Tradition des klassischen Heimatfilms. Der Fokus liegt dabei auf den Filmen von Regisseur Marcus H. Rosenmüller.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Merkmale des Heimatfilm-Genres (traditionell und kritisch), die historische Entwicklung des Heimatfilms von 1918 bis 2011, eine detaillierte Analyse der Filme von Marcus H. Rosenmüller (inkl. Inhaltsangaben, Genremerkmale und Rezensionen), und schließlich die Einordnung von Rosenmüllers Filmen in den Kontext des „Neuen Bayerischen Heimatfilms“.
Welche Filme von Marcus H. Rosenmüller werden analysiert?
Die Arbeit analysiert folgende sechs Filme von Marcus H. Rosenmüller: „Wer früher stirbt ist länger tot“, „Schwere Jungs“, „Beste Zeit“, „Beste Gegend“, „Räuber Kneissl“ und „Die Perlmutterfarbe“.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Einleitung, die den Kontext und die Forschungsfrage beschreibt; einen Abschnitt über das Genre Heimatfilm und dessen Geschichte; und einen Abschnitt, der sich intensiv mit dem Werk von Marcus H. Rosenmüller auseinandersetzt. Ein Fazit rundet die Arbeit ab.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine genreanalytische Methode, die sowohl traditionelle als auch kritische Merkmale des Heimatfilms betrachtet. Die Analyse der Filme von Marcus H. Rosenmüller beinhaltet die Untersuchung der Inhaltsangaben, der Genremerkmale, Besonderheiten und der Rezensionen der Filme.
Was ist die Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie lassen sich die „Neuen Bayerischen Heimatfilme“, insbesondere die Werke von Marcus H. Rosenmüller, in die Tradition des klassischen Heimatfilms einordnen?
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heimatfilm, Neuer Bayerischer Heimatfilm, Marcus H. Rosenmüller, traditioneller Heimatfilm, kritischer Heimatfilm, Genremerkmale, Filmgeschichte, regionale Identität, Bayern, Provinz, Gesellschaftskritik.
Welche historische Entwicklung des Heimatfilms wird dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die Entwicklung des Heimatfilms von seinen Vorläufern (Berg- und Volksfilme) über die Zeit des Nationalsozialismus, die Nachkriegszeit (Trümmerfilme), den Boom der 1950er Jahre, die kritischen Filme der 1960er und 70er Jahre bis hin zum „Neuen Bayerischen Heimatfilm“ um die Jahrtausendwende.
Wie werden die Filme von Marcus H. Rosenmüller analysiert?
Für jeden analysierten Film werden Inhalt, Genremerkmale, Besonderheiten und Rezensionen von Filmkritikern dargestellt. Die Analyse zielt darauf ab, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu traditionellen und kritischen Heimatfilmen aufzuzeigen und die Einordnung in den „Neuen Bayerischen Heimatfilm“ zu begründen.
Was ist der Unterschied zwischen traditionellem und kritischem Heimatfilm?
Der traditionelle Heimatfilm zeichnet sich durch bestimmte Milieus, Naturdarstellungen, Personen, ein spezifisches Wertesystem und Handlungsmuster aus. Der kritische Heimatfilm hingegen bricht mit diesen traditionellen Klischees und integriert gesellschaftskritische Elemente, oft mit ironischer Brechung.
- Quote paper
- M.A. Elisabeth Huber (Author), 2011, Der „Neue Bayerische Heimatfilm“ im 21. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/186956