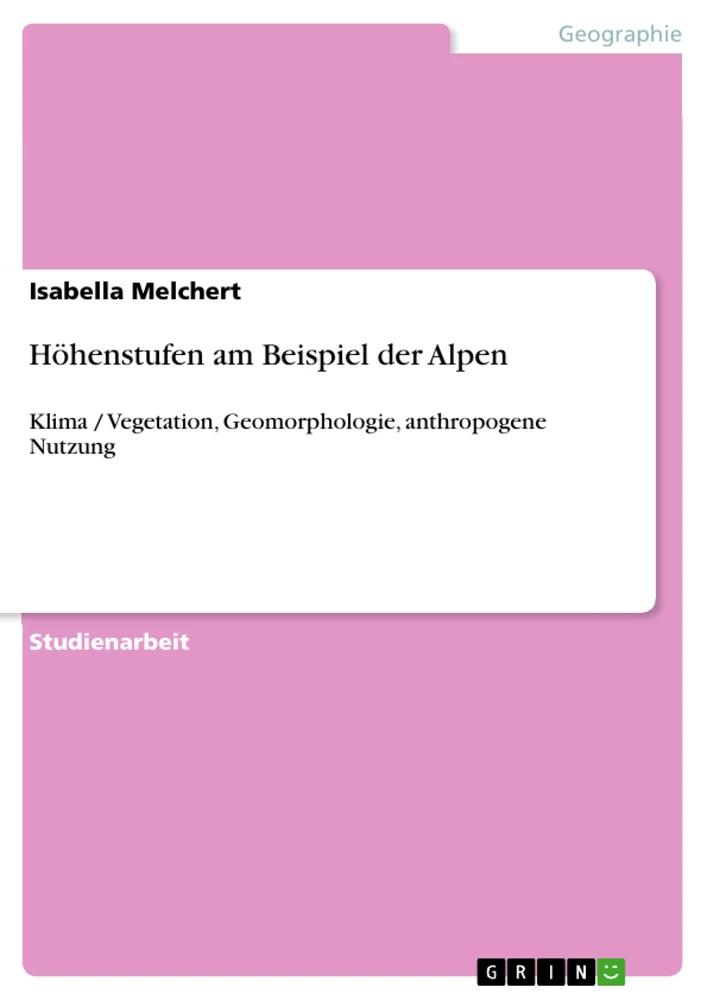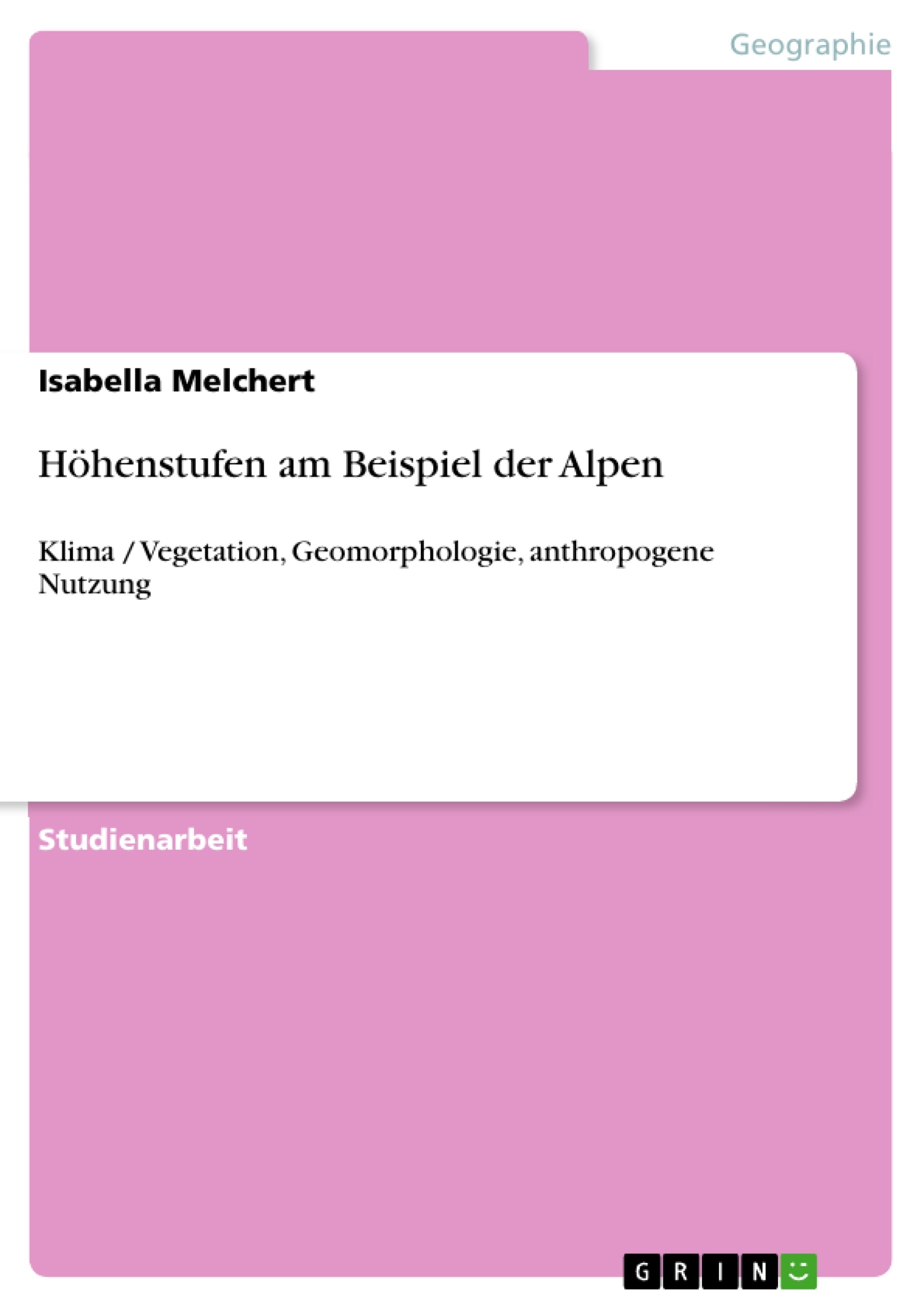Rund 93 Prozent der Alpen liegen oberhalb der 2000m-Grenze. Vor allem gelten Temperatur und Niederschlag als wichtige Faktoren für das Herausbilden der Vegetationshöhenstufen. Die Temperaturabnahme mit der Höhe bedingt eine Verkürzung der Vegetationszeit von sechs bis neun Tagen pro 100m Höhe. In den Alpen haben sich in Folge dessen sechs Höhenstufen herausgebildet: die colline, montane, subalpine, alpine, subnivale und nivale Stufe. Diese Höhenstufen lassen sich auch anhand geomorphologischer Prozesse differenzieren: mediterran, gemäßigt-humid, periglazial, nival und glazial.
Das alpine Gebirge wird negativ anthropogen beeinflusst, z.B. durch Landwirtschafts- und Tourismusaktivitäten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Alpen: Geographische Lage und Abgrenzung
- 2. Klima als Voraussetzung für das Auftreten von Vegetationshöhenstufen
- 3. Höhenstufen der alpinen Vegetation
- 3.1 Colline Höhenstufe
- 3.2 Montane Höhenstufe
- 3.3 Subalpine Höhenstufe
- 3.4 Alpine Höhenstufe
- 3.5 Subnivale und nivale Höhenstufe
- 4. Anthropogene Nutzungsformen und dessen Folgen
- 4.1 Landwirtschaft
- 4.2 Wasser als regenerierbare Energiequelle
- 4.3 Tourismus
- 5. Geomorphologische Gliederung der Höhenstufen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Höhenstufen der Alpen und untersucht die Zusammenhänge zwischen Klima, Vegetation, Geomorphologie und anthropogener Nutzung in verschiedenen Höhenlagen. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die verschiedenen Höhenstufen und ihre spezifischen Eigenschaften zu entwickeln.
- Geographische Lage und Abgrenzung der Alpen
- Einfluss des alpinen Klimas auf die Entstehung von Vegetationshöhenstufen
- Charakterisierung der verschiedenen Höhenstufen der alpinen Vegetation
- Anthropogene Nutzung der Alpen und deren Folgen
- Geomorphologische Gliederung der Höhenstufen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die geographische Lage und Abgrenzung der Alpen. Es wird die Entstehung des Gebirges erläutert und seine Flächenausdehnung in Bezug auf die 2000 m-Grenze beschrieben. Darüber hinaus werden die Breitenausdehnung, die höchsten Erhebungen und die politischen Teilungen der Alpen behandelt.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem alpinen Klima als entscheidender Faktor für die Ausbildung der Vegetationshöhenstufen. Hier werden die Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse in den Alpen sowie deren Einfluss auf die Vegetation beschrieben. Insbesondere werden die Unterschiede zwischen Nord- und Südhängen sowie die Auswirkungen der Schneedecke auf die Pflanzenwelt beleuchtet.
Kapitel 3 stellt die verschiedenen Höhenstufen der alpinen Vegetation vor. Es werden die charakteristischen Merkmale und Pflanzenarten der Collinen, Montanen, Subalpinen, Alpinen und Subnivalen/Nivalen Höhenstufe erläutert.
Kapitel 4 widmet sich den anthropogenen Nutzungsformen und deren Folgen für die Alpen. Es werden die Landwirtschaft, die Nutzung von Wasser als Energiequelle und der Tourismus sowie deren Auswirkungen auf die Umwelt und die verschiedenen Höhenstufen betrachtet.
Schlüsselwörter
Alpen, Höhenstufen, Klima, Vegetation, Geomorphologie, anthropogene Nutzung, Landwirtschaft, Wasserkraft, Tourismus, Schneedecke, Aperzeit, Temperatur, Niederschlag, Vegetationszonen.
- Quote paper
- Isabella Melchert (Author), 2009, Höhenstufen am Beispiel der Alpen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/186945