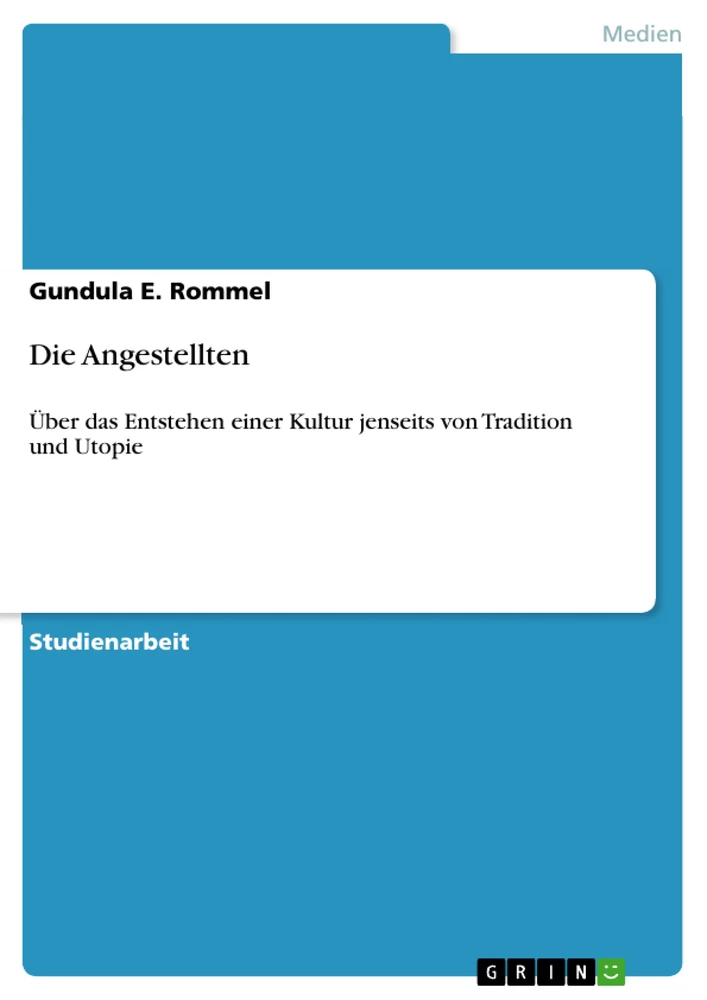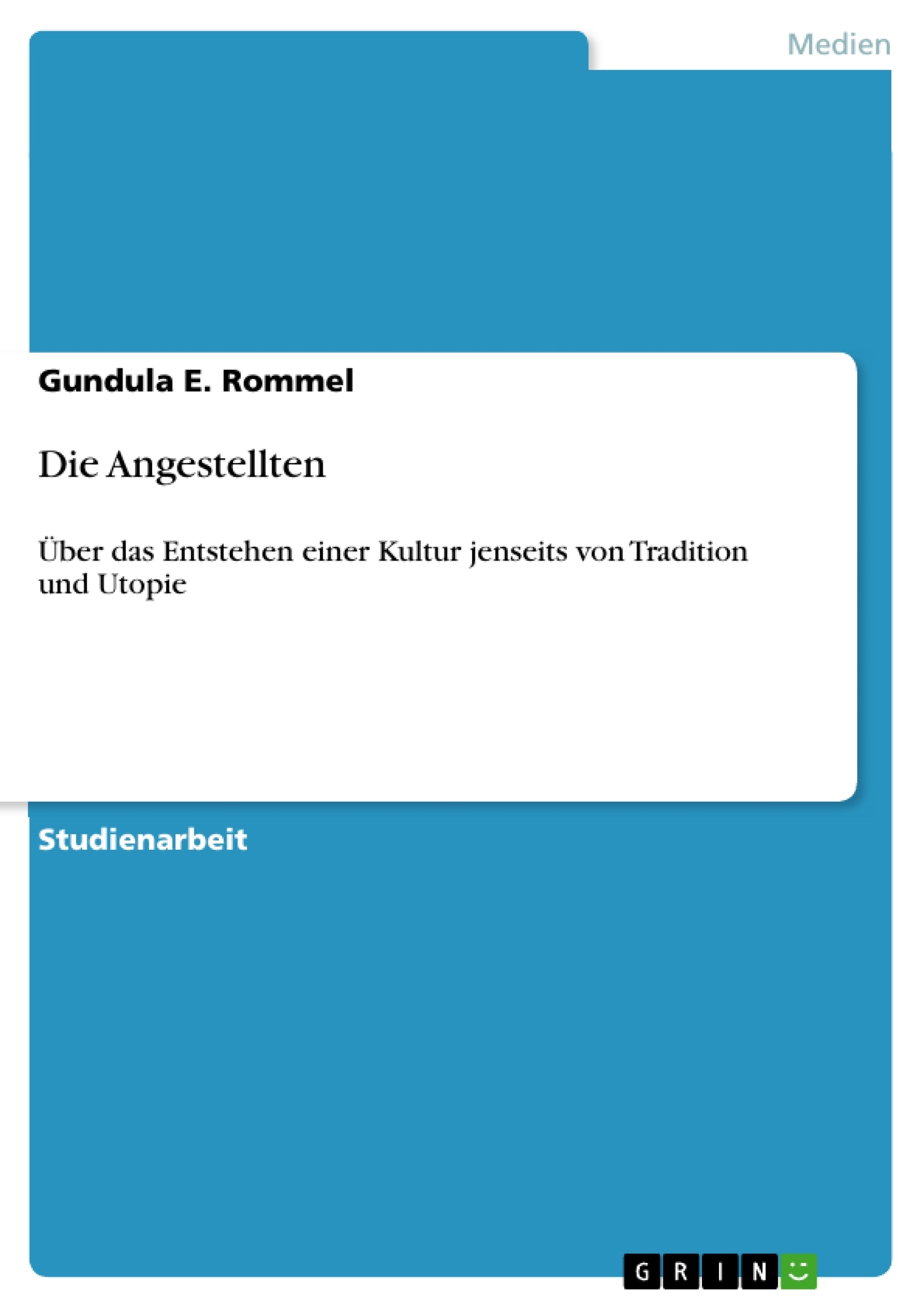„Aus dem neuesten Deutschland“, so überschrieb Siegfried Kracauer seine Studie über das Leben der Angestellten in der Weimarer Republik. Erstmals 1929 in Fortsetzungen im Feuilleton der Frankfurter Zeitung erschienen und im folgenden Jahr als Buch veröffentlicht, machte Kracauers Schrift sofort von sich Reden. Was aber war das eigentlich Neue an der deutschen Angestelltenschicht in den ausgehenden zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts? Und was verlieh Kracauers Analyse in den Augen seiner Zeitgenossen eine solche aktuelle Brisanz? Um diese Fragen zu beantworten, skizziert diese Arbeit zunächst den diskursiven Hintergrund, vor dem Kracauers Studie erschien. Zudem wird in einem Exkurs näher auf die sozialgeschichtliche Genese der Angestelltenschicht eingegangen. Dieser Exkurs bietet auch Anhaltspunkte für ein Verständnis des anschließend beschriebenen bürgerlichen Standesbewußtseins, welches für viele Angestellte damals charakteristisch war und von Zeitgenossen vielfach thematisiert wurde. Ob dieses elitäre Selbstverständnis berechtigt sei oder nicht, an der Beantwortung dieser Frage schieden sich die konkurrierenden Gewerkschaftsverbände wie auch die großen politischen Fraktionen. Eine Gegenüberstellung der verschiedenen Ansichten und ihrer Argumentationen vermittelt ein Bild von jener Auseinandersetzung, die Kracauer mit der Veröffentlichung von „Die Angestellten“ zum Brennpunkt seiner diskursiven Intervention machte. So wie es in dieser politischen Auseinandersetzung eigentlich um die Zukunft der Weimarer Republik insgesamt ging, weitete auch Kracauer seine Analyse der Angestelltenschicht zu einer umfassenden Gesellschaftskritik aus. Eine zusammenfassende Darstellung seiner Beobachtungen und Schlußfolgerungen sowie der Implikationen, die sich nach meiner Lesart daraus ergeben, bildet den Hauptteil der vorliegenden Arbeit. Abschließend soll diese Arbeit den Leser zum Nachdenken darüber anregen, inwieweit einige der von Kracauer aufgezeigten Aspekte für unser Verständnis der weiteren gesellschaftlichen Entwicklung Deutschlands und auch noch der aktuellen Situation relevant sind.
Inhaltsverzeichnis
- NEUIGKEITEN? - ZUR EINFÜHRUNG
- EIN ZANKAPFEL REIFT
- EXKURS: SOZIALGESCHICHTLICHER ABRISS
- BÜRGERLICHES STANDESBEWUSSTSEIN
- DIE POLITISCHE AUSEINANDERSETZUNG
- KRITIK UND ANALYSE
- AUSBLICK
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Angestelltenkultur in der Weimarer Republik und analysiert die Entstehung einer Kultur jenseits von Tradition und Utopie. Sie untersucht die diskursiven Hintergründe der Debatte um die Angestellten und beleuchtet die sozialgeschichtliche Entwicklung der Angestelltenschicht.
- Die Entstehung der Angestelltenkultur in der Weimarer Republik
- Die diskursiven Hintergründe der Debatte um die Angestellten
- Die sozialgeschichtliche Entwicklung der Angestelltenschicht
- Das bürgerliche Standesbewusstsein der Angestellten
- Die politische Auseinandersetzung um die Angestellten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet die Aktualität von Kracauers Analyse der Angestellten in der Weimarer Republik. Es wird der diskursive Hintergrund der Debatte um die Angestellten skizziert und die Bedeutung der Einordnung des Textes in seine kulturgeschichtlichen Zusammenhänge hervorgehoben.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der sozialgeschichtlichen Entwicklung der Angestelltenschicht und zeigt auf, wie die Angestellten im 19. Jahrhundert aus dem Mittelstand rekrutiert wurden und ein höheres soziales Prestige genossen als das Proletariat. Es wird die Entwicklung von der traditionellen Angestelltenkultur hin zur modernen, bürokratischen Arbeitswelt beschrieben.
Das dritte Kapitel analysiert das bürgerliche Standesbewusstsein der Angestellten in der Weimarer Republik und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf die soziale Verortung der Angestellten. Es werden die konkurrierenden Gewerkschaftsverbände und politischen Fraktionen vorgestellt, die sich in der Debatte um die Angestelltenfrage auseinandersetzten.
Das vierte Kapitel widmet sich der politischen Auseinandersetzung um die Angestellten in der Weimarer Republik. Es werden die verschiedenen Ansichten und Argumentationen der politischen Lager gegenübergestellt und die Bedeutung der Angestelltenfrage für die Zukunft der Weimarer Republik beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Angestelltenkultur, die Weimarer Republik, die sozialgeschichtliche Entwicklung, das bürgerliche Standesbewusstsein, die politische Auseinandersetzung, die Kritik und Analyse von Siegfried Kracauers Werk "Die Angestellten".
- Quote paper
- Gundula E. Rommel (Author), 2001, Die Angestellten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/184710