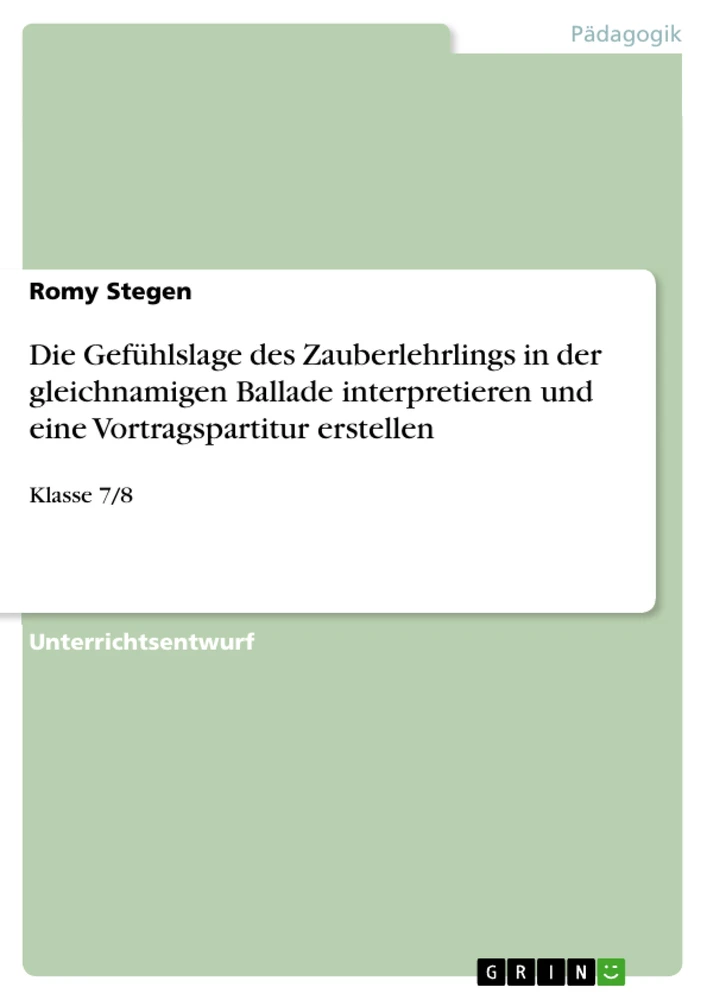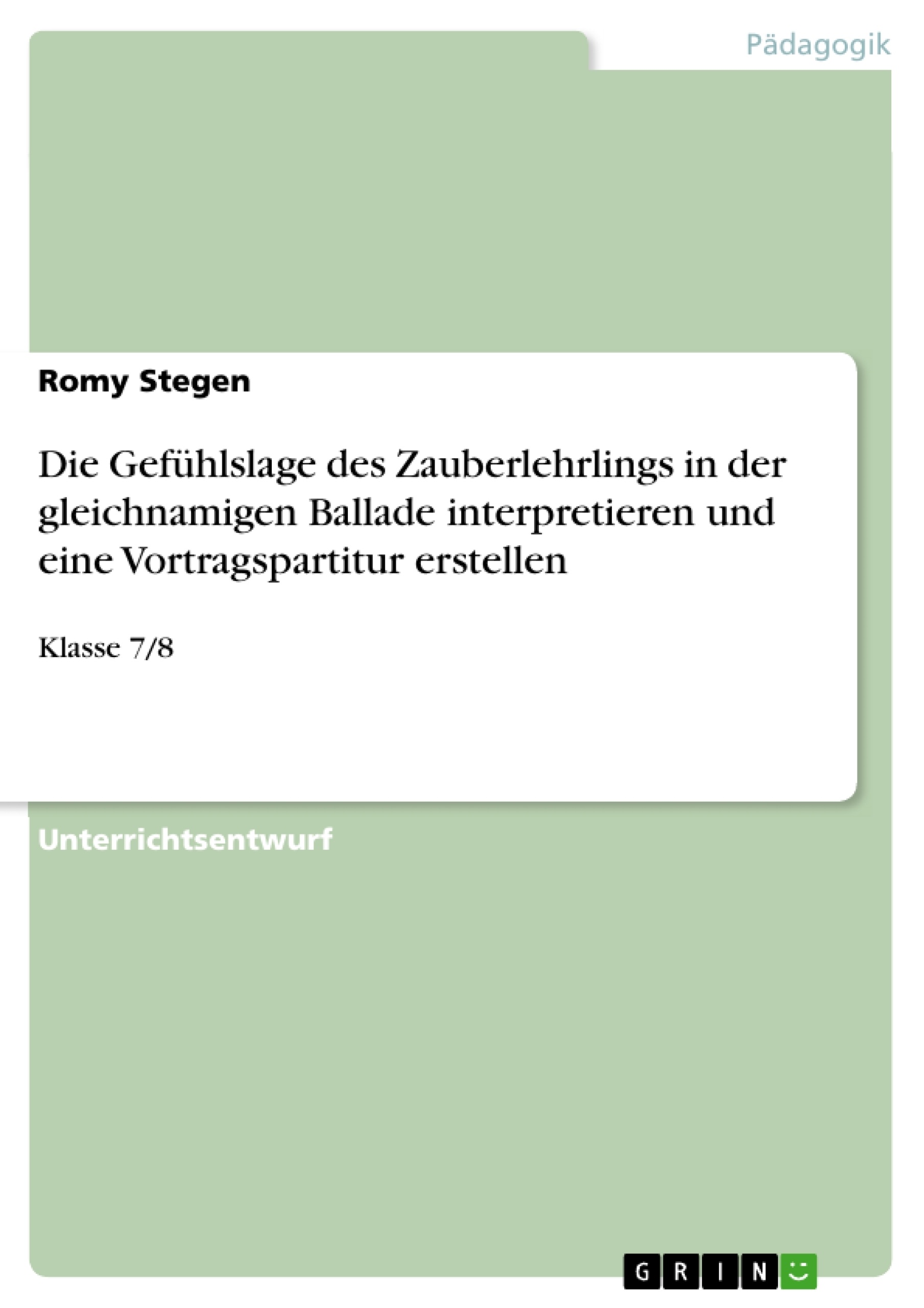2.1 Die Ballade
Das Geburtsjahr der Kunstballade ist das Jahr 1773, in dem Gottfried August Bürger ein Erzählgedicht mit dem Titel „Leonore“ veröffentlichte. Dieser wurde für viele Autoren seiner Zeit zum großen Vorbild. Balladen haben oftmals einen spektakulären Inhalt, der von einem außergewöhnlichen oder dramatischen Ereignis erzählt. Man unterscheidet unterschiedliche Formen: die naturmagische Ballade, die Heldenballade oder die Ideenballade. Balladendichter bedienen sich verschiedener Quellen wie zum Beispiel Sagen aus alter Zeit, der Geschichtsschreibung, Mythen und biblische Erzählungen oder auch aktuelle Ereignisse. Das Besondere an einer Ballade ist die Vereinigung der drei literarischen Gattungen. So enthält sie im Regelfall Elemente aus der Epik, der Lyrik und dem Drama.
„Die Ballade erzählt wie in epischen Texten eine zusammenhängende Geschichte über eine interessante Begebenheit. Ähnlich wie im Drama kommen dabei Figuren in direkter Rede zu Wort und vermitteln dem Hörer oder Leser den Eindruck, hautnah dabei zu sein. Wie ein Gedicht ist die Ballade in Verse und Strophen gefasst und enthält meistens auch Reime.“
Aufgrund der Dichte einer Ballade ist die Erzählform gerafft, somit setzt die Handlung ganz unvermittelt ein. Spannung wird schrittweise erzeugt, unwichtige Einzelheiten werden ausgespart. Oftmals kommt das Ende überraschend.
Inhaltsverzeichnis
- I Analyseteil
- 1. Situationsanalyse
- 1.1 Rahmenbedingungen
- 1.2 Lernvoraussetzungen
- 2. Sachanalyse
- 2.1 Die Ballade
- 2.2 Johann Wolfgang Goethe: Der Zauberlehrling
- 2.3 Vortragsgestaltung einer Ballade
- 3. Didaktische Analyse
- 4. Kompetenzorientierung
- II Entscheidungsteil
- 5. Methodische Entscheidungen
- 5.1 Einstieg
- 5.2 Hinführung
- 5.3 Erarbeitungsphase I und Ergebnissicherung I
- 5.4 Erarbeitungsphase II und Ergebnissicherung II
- 5.5 Erarbeitungsphase III und Ergebnissicherung III
- 5.6 Ausstieg
- III Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Gefühlslage des Zauberlehrlings in Goethes gleichnamiger Ballade und erstellt eine Vortragspartitur. Ziel ist es, die emotionale Entwicklung der Figur im Verlauf der Ballade zu untersuchen und diese Erkenntnisse für die Gestaltung eines wirkungsvollen Vortrags zu nutzen. Die Arbeit verbindet literarische Analyse mit didaktischen Überlegungen für den Unterricht.
- Analyse der Gefühlslage des Zauberlehrlings
- Entwicklung der emotionalen Dynamik in der Ballade
- Methodische Vorgehensweisen für einen effektiven Vortrag
- Didaktische Überlegungen zur Umsetzung im Unterricht
- Verbindung von Literaturanalyse und Vortragsgestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
I Analyseteil: Dieser Teil der Arbeit beginnt mit einer Situationsanalyse der Klasse 7a, in der die Ballade behandelt wird, inklusive der Rahmenbedingungen und Lernvoraussetzungen der Schüler. Es folgt eine detaillierte Sachanalyse der Ballade im Allgemeinen, mit Fokus auf die Merkmale der Gattung und ihren historischen Kontext. Die Analyse von Goethes "Der Zauberlehrling" betont den Inhalt, die Entwicklung der Gefühlslage des Zauberlehrlings über die Strophen hinweg und den formalen Aufbau der Ballade (Reimschema, Metrum). Abschließend werden wichtige Aspekte der Vortragsgestaltung einer Ballade beleuchtet, mit Hinweisen auf die Bedeutung von Tempo, Lautstärke, Stimmhöhe und Ausdruck.
II Entscheidungsteil: Dieser Teil fehlt im bereitgestellten Text und kann daher nicht zusammengefasst werden.
Schlüsselwörter
Goethe, Der Zauberlehrling, Ballade, Gefühlslage, Vortragsgestaltung, Didaktik, Unterrichtsplanung, literarische Analyse, emotionale Entwicklung, Vortragstechnik
Goethes "Der Zauberlehrling": Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Gefühlslage des Zauberlehrlings in Goethes Ballade "Der Zauberlehrling" und entwickelt daraus eine Vortragspartitur. Sie verbindet literarische Analyse mit didaktischen Überlegungen für den Unterricht und konzentriert sich auf die emotionale Entwicklung der Figur und die Gestaltung eines wirkungsvollen Vortrags.
Welche Teile umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: einen Analyseteil (Situationsanalyse, Sachanalyse mit Fokus auf die Ballade und Goethes Werk, didaktische Analyse und Kompetenzorientierung), einen Entscheidungsteil (methodische Entscheidungen für den Unterrichtseinsatz) und einen Quellenverzeichnis. Der Entscheidungsteil fehlt jedoch im vorliegenden Text.
Was wird im Analyseteil behandelt?
Der Analyseteil beginnt mit einer Situationsanalyse der Klasse 7a (Rahmenbedingungen und Lernvoraussetzungen der Schüler). Es folgt eine Sachanalyse der Ballade im Allgemeinen und von Goethes "Der Zauberlehrling" im Speziellen, inklusive Inhaltsanalyse, Analyse der Gefühlslage des Zauberlehrlings und der formalen Aspekte (Reimschema, Metrum). Schließlich werden Aspekte der Vortragsgestaltung einer Ballade beleuchtet (Tempo, Lautstärke, Stimmhöhe, Ausdruck).
Was wird im Entscheidungsteil behandelt (so weit vorhanden)?
Der Entscheidungsteil, der im vorliegenden Text fehlt, würde methodische Entscheidungen für den Unterricht beinhalten, einschließlich der Phasen des Unterrichts (Einstieg, Hinführung, Erarbeitungsphasen mit Ergebnissicherungen und Ausstieg).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Der Zauberlehrling, Ballade, Gefühlslage, Vortragsgestaltung, Didaktik, Unterrichtsplanung, literarische Analyse, emotionale Entwicklung, Vortragstechnik.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist die Untersuchung der emotionalen Entwicklung des Zauberlehrlings in Goethes Ballade und die Nutzung dieser Erkenntnisse für die Gestaltung eines wirkungsvollen Vortrags im Unterricht. Die Arbeit soll Literaturanalyse und didaktische Überlegungen verbinden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Gefühlslage des Zauberlehrlings, die Entwicklung der emotionalen Dynamik in der Ballade, methodische Vorgehensweisen für einen effektiven Vortrag, didaktische Überlegungen zur Umsetzung im Unterricht und die Verbindung von Literaturanalyse und Vortragsgestaltung.
- Quote paper
- Romy Stegen (Author), 2011, Die Gefühlslage des Zauberlehrlings in der gleichnamigen Ballade interpretieren und eine Vortragspartitur erstellen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/184459