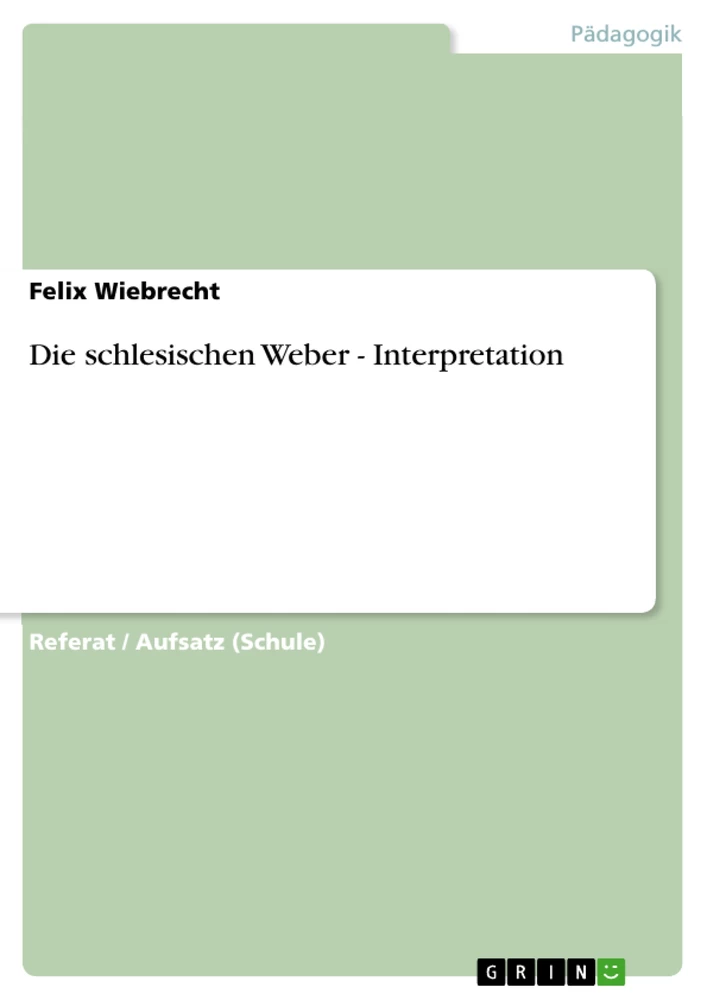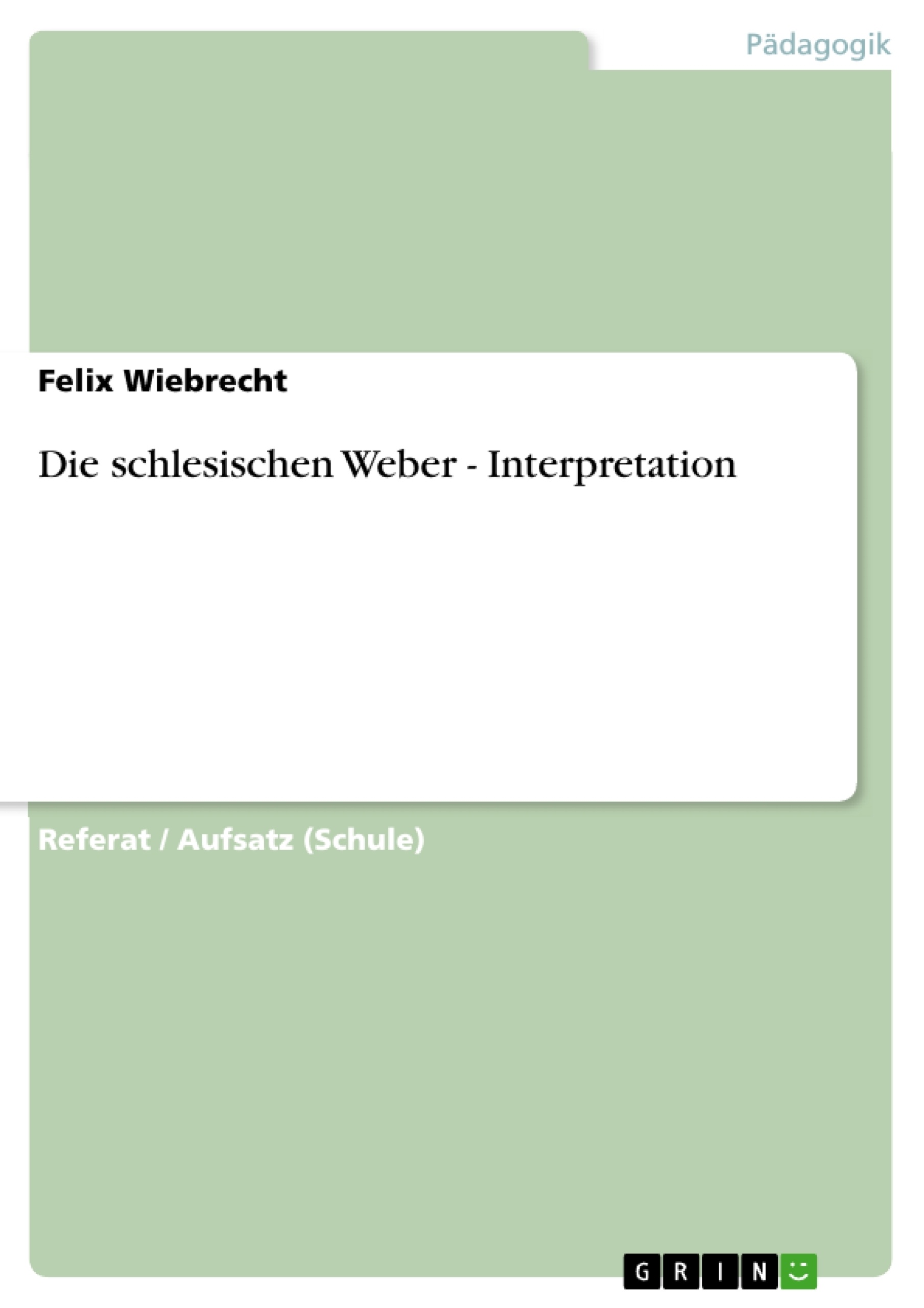In unserer heutigen Zeit gibt es zahlreiche Proteste, angefangen bei den Gegner von
neuen Bahnhöfen über Feinde der Atomenergie bis zur Kritik an der eigentlichen
Herrschaft der Finanzmärkte über die Politik und vollkommener Systemkritik.
Zustände des Protests und des Begehrens sind allerdings nicht neu in der Geschichte,
denn zum Beispiel kam es während der Zeit der Industrialisierung, die
bekanntermaßen sowohl zahlreiche Gewinner als auch Verlierer hervorbrachte, zu
einigen Konflikten. Einer von ihnen ist der Aufstand der schlesischen Weber im Jahr
1844. Im gleichen Jahr macht auch der Dichter Heinrich Heine mit seinem Gedicht
,,Die schlesischen Weber" auf die Lebenssituation jener aufmerksam.
Das Gedicht ist in geschlossener Form geschrieben und besteht aus 5 Strophen mit
jeweils 5 Versen. Es wurde im Paarreim geschrieben, es gibt jedoch dabei eine
Ausnahme, denn der jeweils letzte Vers der Strophen ist immer der gleiche, und somit
eine Repetitio: ,,Wir weben, wir weben!" und wirkt so als eine Art Refrain. Dies
verstärkt den Eindruck, dass Heine das Gedicht absichtlich ähnlich wie ein Volkslied
verfasst hat. Nach dem ersten Lesen fällt auf, dass dieses Gedicht einen Gestus
besitzt, den man mit den Adjektiven kritisch, wütend und dunkel beschreiben kann
Inhaltsverzeichnis
- Beschreibung der äußeren Form
- systematische Darlegung der Analyseergebnisse unter Berücksichtigung der Inhalt-Form-Beziehung
- Darlegung der Intention
- biographischer Bezug
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Gedicht „Die schlesischen Weber“ von Heinrich Heine analysiert die Lebensbedingungen der schlesischen Weber im Jahr 1844 während der Industrialisierung. Es untersucht die soziale und politische Situation der Arbeiterklasse und die Kritik an den herrschenden Verhältnissen.
- Kritik an der Kirche und Gott
- Kritik am König und der Oberschicht
- Kritik an den Zuständen in Deutschland
- Die Situation der Weber in der Industrialisierung
- Die Bedeutung von Protest und Aufstand
Zusammenfassung der Kapitel
Das Gedicht „Die schlesischen Weber“ von Heinrich Heine ist in fünf Strophen mit jeweils fünf Versen verfasst. Die Weber, die am Webstuhl sitzen und „die Zähne fletschen“, weben ein „Leichentuch“ für Deutschland, in das sie einen „dreifachen Fluch“ einweben. Dieser Fluch richtet sich gegen Gott, den König und das „falsche Vaterland“. Die Weber beklagen ihre Armut und Not, die sie trotz ihrer Gebete und ihres Vertrauens in Gott nicht überwinden konnten. Sie werfen dem König vor, nur der „König der Reichen“ zu sein und sich nicht um das Leid des Volkes zu kümmern. Sie sehen in Deutschland ein Land der „Schmach und Schande“, in dem die „Blume früh geknickt“ wird und „Fäulnis und Moder den Wurm erquickt“. In der letzten Strophe kehren die Weber an ihren Arbeitsplatz zurück, aber ihre revolutionäre Stimmung bleibt bestehen. Sie weben weiter am Leichentuch für Deutschland, das sie mit „Altdeutschland“ bezeichnen, und rufen zu einer Revolution auf, die der alten Ordnung den Untergang weihen soll.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die schlesischen Weber, die Industrialisierung, die Kritik an Kirche, König und Deutschland, die soziale und politische Situation der Arbeiterklasse, Protest und Aufstand, die Ausbeutung des Proletariats, die Folgen der industriellen Revolution und die Soziale Frage.
- Arbeit zitieren
- Felix Wiebrecht (Autor:in), 2011, Die schlesischen Weber - Interpretation, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/183825