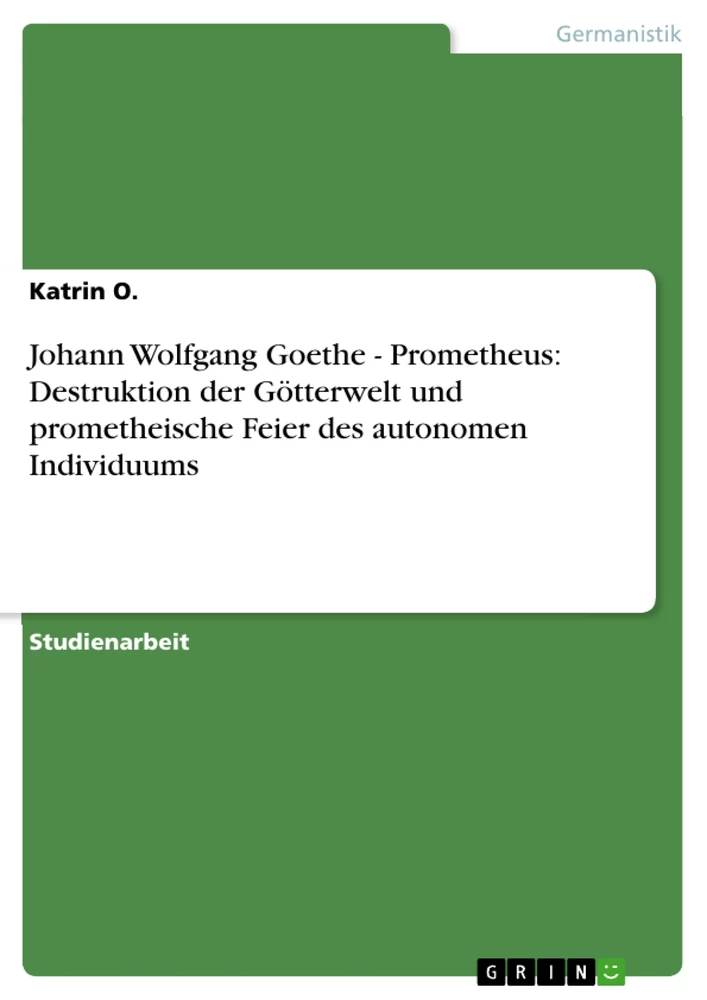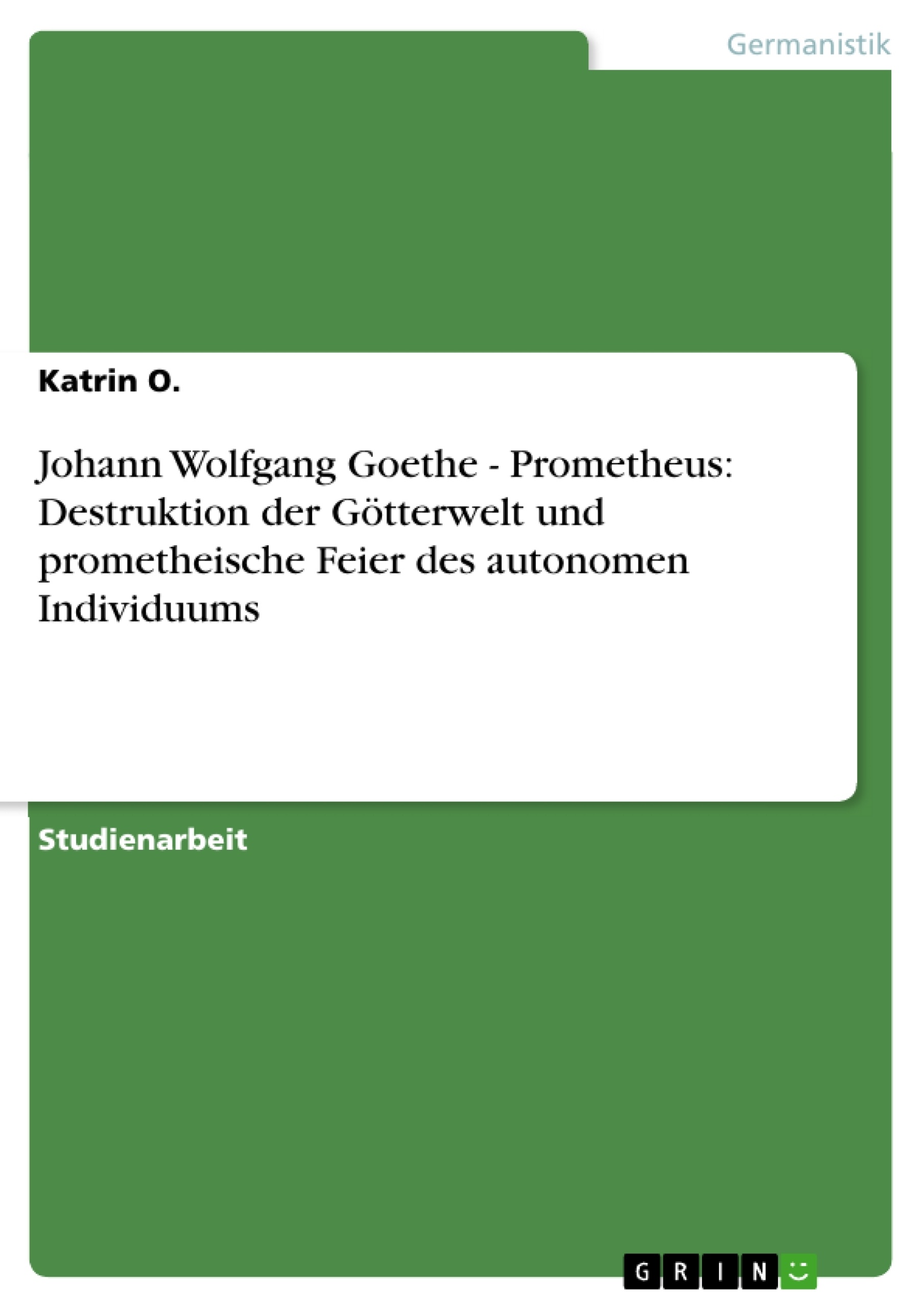„Es diente zum Zündkraut einer Explosion, welche die geheimsten Verhältnisse würdiger Männer aufdeckte und zur Sprache brachte...“ kommentierte Johann Wolfgang Goethe rückschauend im 15. Buch von „Dichtung und Wahrheit“ die Wirkung der Hymne „Prometheus“.1 Goethe selbst hielt sein dramatisches Fragment sogar lange Zeit unter Verschluss. Nachdem der Monolog zeitweise als verloren galt, tauchte er in Zeiten des Sturm und Drang über Umwege wieder auf. Doch auch zu diesem Zeitpunkt hielt der Dichter, der angespannten politischen Lage wegen, eine Veröffentlichung nicht für ratsam. Dazu schrieb Johann Wolfgang Goethe 1820 an Zelter: „Lasset ja das Manuskript nicht zu offenbar werden, damit es nicht im Druck erscheine. Es käme unserer revolutionären Jugend als Evangelium recht willkommen [..].“ Doch auch gerade der unmittelbar zu spürende antichristliche Charakter der Hymne hielt Goethe womöglich davon ab, einer Veröffentlichung unter seinem Namen zuzustimmen. So wurde der Monolog Prometheus, der in Verbindung mit dem Drama Prometheus. Dramatisches Fragment 1773 entstand, nur anonym veröffentlicht.2
Es scheint sich also zu lohnen, dieses Gedicht, das schon bei seiner ominösen Veröffentlichung 1784 für Kontroversen sorgt, näher zu beleuchten und zu klären, warum es einen so großen Tabubruch darstellte, so dass sich der Autor von seinem Stück derart distanzierte.
Es folgt demnach eine genaue Analyse des Gedichtes unter Berücksichtigung des Entstehungskontextes, des mythologischen Hintergrunds, des ideengeschichtlichen Aspektes und der Einordnung in die Ideenwelt des Sturm und Drang.
Vorweg kann jedoch schon angemerkt werden, dass das Ergebnis dieser Arbeit keine konkrete, sich auf ihre Richtigkeit berufende These sein wird. Vielmehr steht die Betrachtung des Gedichtes als ‚Gesamtkomplex’ im Vordergrund, um es in seiner Aussage nicht zu beschneiden. So ist es auch unvermeidlich, dass einzelne Deutungselemente, Aspekte und Teile der Aufgabenstellung ineinander überfließen und verschmelzen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse der Hymne „Prometheus“
- Der mythologische Hintergrund
- Interpretation des Gedichtes
- Verschiedene Deutungsdimensionen
- Bezug zu den Ideen des Sturm und Drang
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Goethes Gedicht „Prometheus“, indem sie den Entstehungskontext, den mythologischen Hintergrund, den ideengeschichtlichen Aspekt und die Einordnung in die Ideenwelt des Sturm und Drang beleuchtet. Ziel ist es, das Gedicht in seiner Gesamtheit zu betrachten und verschiedene Deutungsebenen zu erforschen, ohne eine definitive These aufzustellen.
- Goethes persönliche Motive im Gedicht
- Der mythologische Prometheus und seine Relevanz für das Gedicht
- Die Darstellung der Rebellion gegen die Götter
- Die sprachliche Gestaltung und ihre Bedeutung
- Die Einordnung des Gedichts in den Sturm und Drang
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die kontroverse Geschichte der Veröffentlichung des Gedichts. Der Hauptteil beginnt mit einer Betrachtung des mythologischen Hintergrunds von Prometheus und dessen Anpassung durch Goethe. Anschließend wird die Interpretation des Gedichts behandelt, wobei die emotionale Distanz zwischen Prometheus und Zeus sowie die sprachliche Gestaltung im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Prometheus, Goethe, Sturm und Drang, Mythologie, Rebellion, Gott, Individuum, Sprache, Interpretation, Emanzipation.
- Quote paper
- Katrin O. (Author), 2008, Johann Wolfgang Goethe - Prometheus: Destruktion der Götterwelt und prometheische Feier des autonomen Individuums, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/182726