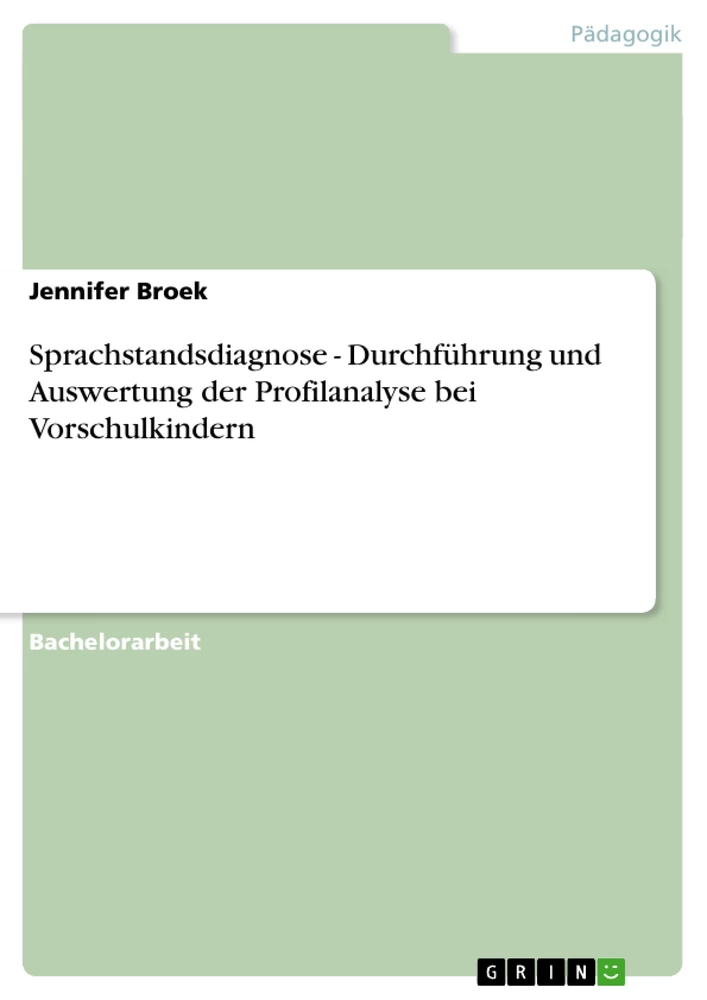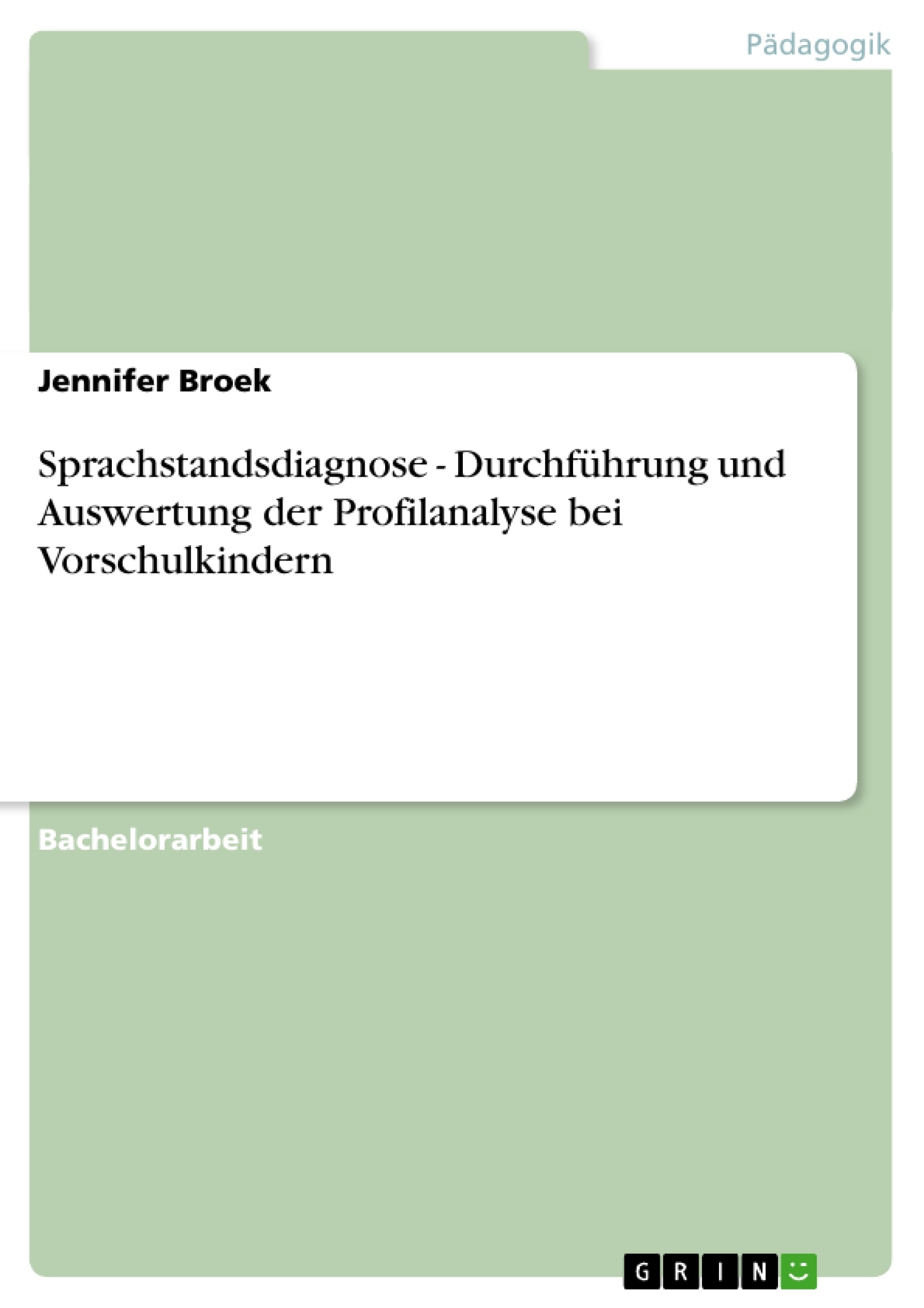1. Einleitung
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“, konsta-tierte schon Wittgenstein (1921: 246) im beginnenden 20. Jahrhundert. Dass „die Grenze der Welt“ für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) im 21. Jahrhundert die Bildung darstellen kann, attestieren internationale ver-gleichende Schulleistungsstudien wie PISA (Programme for international Student Assessment) und IGLU (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung), die einen maßgeblichen Einfluss der Sprachkompetenz auf den Bildungserfolg festgestellt haben (Roux 2005). Dass ein erheblicher Teil der in Deutschland lebenden Kinder und Jugendlichen aus Zuwanderer-familien aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse keine Teilhabe an Bildung hat, zeigt deutlich, dass diagnostische Instrumente von Nöten sind, die Lücken in der Sprache offenbaren und Lernziele festlegen können.
In der vorliegenden Arbeit wird die Profilanalyse nach Wilhelm Grießhaber vorgestellt, an Vorschulkindern durchgeführt und ausgewertet. Dieses Ver-fahren erfasst den Sprachstand von Zweitspracherwerben anhand syntakti-scher Strukturen, die in einer invarianten Reihenfolge erworben werden. Für die Einteilung in insgesamt fünf Profilstufen, von denen die höchste dem muttersprachlichen Niveau entspricht und von gleichaltrigen deutschen Kindern tatsächlich erreicht wird, ist die Stellung des Verbs die zentrale Größe. Nach Grießhaber (2006, 2010) legen die Ergebnisse der Profilanalyse den tatsächlichen Sprachstand in der Zweitsprache insofern dar, als dass sich der Blick auf die grammatischen Tiefenstrukturen der Sprache richtet, deren Erwerbsreihenfolge, wie empirische Befunde zeigen, bei allen Lernern gleich ist. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Sprachstand zweier Vor-schulkinder untersucht, die zum Zeitpunkt der Sprachstandserfassung Vor-schulkinder waren. Sie sind libanesischer Herkunft und lernen Deutsch als Zweitsprache seit dem Eintritt in die Kindertagesstätte in ihrem 3. Lebens-jahr. Das Ziel der Untersuchung ist, den Sprachstand mit der Profilanalyse zu ermitteln und diesen im Hinblick auf die Methodik, den Spracherwerbs-typ nach Grießhaber & Rehbein (1996) und soziale Bedingungen zu analy-sieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Einleitung ins Thema Zweitspracherwerb
- 2.1 Definitionen
- 2.2 Zweitspracherwerbsforschung
- 2.3 Zweitspracherwerbstypen nach Grießhaber & Rehbein
- 2.4 Praxis und Relevanz von Diagnostik
- 3. Grundlagen der Profilanalyse nach Grießhaber
- 3.1 Linguistische Grundlage: Die Klammerstruktur der deutschen Sprache
- 3.2 Die Erwerbsreihenfolge im Zweitspracherwerb
- 3.3 Der vereinfachte Profilbogen nach Grießhaber
- 4. Durchführung der Profilanalyse
- 4.1 Die Probanden
- 4.2 Der Kontext der Datenerhebung
- 5. Ergebnisse
- 5.1 Ergebnisse der Daten von Kind HAS
- 5.2 Ergebnisse der Daten von Kind HAM
- 6. Diskussion
- 6.1 Ergebnisse im Kontext der Datenerhebung
- 6.2 Abweichungen an der „Wortoberfläche“
- 6.3 Ergebnisse im sozialen Kontext
- 7. Kritische Betrachtung der Profilanalyse
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht den Sprachstand von Vorschulkindern mit Deutsch als Zweitsprache mithilfe der Profilanalyse nach Grießhaber. Ziel ist die Ermittlung des Sprachstands und dessen Analyse im Hinblick auf Methodik, Spracherwerbstyp und soziale Bedingungen. Die Arbeit fokussiert auf die Anwendung und Auswertung der Profilanalyse in der Praxis.
- Profilanalyse als Methode zur Sprachstandsdiagnose bei DaZ-Kindern
- Analyse der syntaktischen Strukturen im Spracherwerb
- Einordnung der Ergebnisse in den Kontext des Spracherwerbstypes nach Grießhaber & Rehbein
- Berücksichtigung sozialer Faktoren im Spracherwerb
- Kritische Reflexion der Methode
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung von Sprachkompetenz für den Bildungserfolg von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ), basierend auf Studien wie PISA und IGLU. Sie führt die Profilanalyse nach Grießhaber als Untersuchungsmethode ein, die den Sprachstand anhand syntaktischer Strukturen erfasst. Die Arbeit untersucht den Sprachstand zweier libanesischer Vorschulkinder und analysiert diesen im Hinblick auf Methodik, Spracherwerbstyp und soziale Bedingungen.
2. Theoretische Einleitung ins Thema Zweitspracherwerb: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen des Zweitspracherwerbs. Es werden Definitionen wichtiger Termini erläutert und ein Überblick über gängige Theorien gegeben. Besonderes Augenmerk liegt auf den Zweitspracherwerbstypen nach Rehbein & Grießhaber (1996), die für die Einordnung der Probanden im empirischen Teil relevant sind. Die Relevanz von Diagnostik im Zweitspracherwerb im Kontext Schule wird herausgestellt.
3. Grundlagen der Profilanalyse nach Grießhaber: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Profilanalyse nach Grießhaber. Es erklärt die linguistische Grundlage, die Klammerstruktur der deutschen Sprache, und die daraus resultierende invariante Erwerbsreihenfolge syntaktischer Strukturen. Die Methode der Profilanalyse, inklusive Durchführungs- und Auswertungsmodalitäten, wird umfassend dargestellt.
4. Durchführung der Profilanalyse: Dieses Kapitel beschreibt die Durchführung der Studie. Es liefert Informationen über die Probanden, ihre Sprachbiographie und die Kontexte der Datenerhebung. Die detaillierte Beschreibung der Methodik ermöglicht die Nachvollziehbarkeit der Studie.
5. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert und erläutert die Ergebnisse der Untersuchung in tabellarischer Form. Die Daten der beiden untersuchten Kinder werden detailliert vorgestellt, bilden aber den Ausgangspunkt der weiteren Diskussion.
6. Diskussion: Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse im Kontext des Sprachstands der untersuchten Kinder. Es berücksichtigt die Aufnahmesituationen, den Zweitspracherwerbskontext und die sozialen Bedingungen der Probanden. Die Ergebnisse werden im Lichte der theoretischen Grundlagen aus Kapitel 2 und 3 eingeordnet.
7. Kritische Betrachtung der Profilanalyse: Dieses Kapitel enthält eine kritische Auseinandersetzung mit der Methode der Profilanalyse im Hinblick auf ihre Eignung zur Sprachstanderhebung bei Vorschulkindern. Stärken und Schwächen des Verfahrens werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Profilanalyse, Zweitspracherwerb, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Sprachstandsdiagnose, Vorschulkinder, syntaktische Strukturen, Spracherwerbstypen, Grießhaber, Rehbein, Sprachbiographie, soziale Bedingungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Profilanalyse im Zweitspracherwerb bei Vorschulkindern
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht den Sprachstand von zwei Vorschulkindern mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) mithilfe der Profilanalyse nach Grießhaber. Sie analysiert den Sprachstand im Hinblick auf Methodik, Spracherwerbstyp und soziale Bedingungen und fokussiert auf die praktische Anwendung und Auswertung der Profilanalyse.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die zentrale Methode ist die Profilanalyse nach Grießhaber. Diese Methode erfasst den Sprachstand anhand der Analyse syntaktischer Strukturen im Deutschen, basierend auf dem Konzept der Klammerstruktur und der invarianten Erwerbsreihenfolge.
Wer sind die Probanden der Studie?
Die Studie untersucht zwei libanesische Vorschulkinder. Die Arbeit beschreibt detailliert deren Sprachbiografien und den Kontext der Datenerhebung.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die theoretischen Grundlagen des Zweitspracherwerbs, einschließlich Definitionen wichtiger Begriffe und gängiger Theorien. Ein Schwerpunkt liegt auf den Zweitspracherwerbstypen nach Rehbein & Grießhaber (1996) zur Einordnung der Probanden. Die Relevanz von Diagnostik im Zweitspracherwerb wird ebenfalls erläutert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert: Einleitung, theoretische Grundlagen des Zweitspracherwerbs, Grundlagen der Profilanalyse nach Grießhaber, Durchführung der Profilanalyse, Ergebnisse, Diskussion der Ergebnisse, kritische Betrachtung der Profilanalyse und Fazit. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis findet sich im Dokument.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert und interpretiert die Ergebnisse der Profilanalyse für beide Kinder in tabellarischer Form. Die Ergebnisse werden im Kontext der Datenerhebung, des Spracherwerbstypes und der sozialen Bedingungen der Kinder diskutiert.
Welche Aspekte werden kritisch betrachtet?
Die Arbeit enthält eine kritische Auseinandersetzung mit der Methode der Profilanalyse selbst, beleuchtet ihre Stärken und Schwächen im Hinblick auf die Sprachstanderhebung bei Vorschulkindern und bewertet ihre Eignung für den Untersuchungsgegenstand.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Sprachstand von DaZ-Kindern mithilfe der Profilanalyse zu ermitteln und zu analysieren. Sie untersucht die Methodik der Profilanalyse, den Spracherwerbstyp der Kinder und den Einfluss sozialer Faktoren auf den Spracherwerb.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Profilanalyse, Zweitspracherwerb, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Sprachstandsdiagnose, Vorschulkinder, syntaktische Strukturen, Spracherwerbstypen, Grießhaber, Rehbein, Sprachbiographie, soziale Bedingungen.
- Quote paper
- Jennifer Broek (Author), 2011, Sprachstandsdiagnose - Durchführung und Auswertung der Profilanalyse bei Vorschulkindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/181373