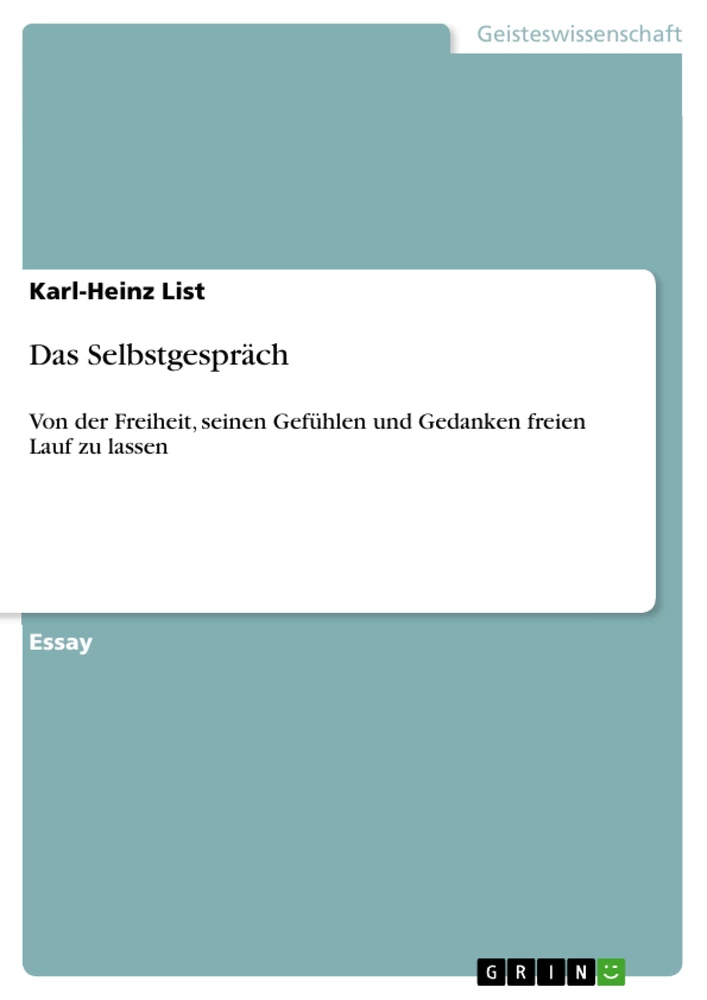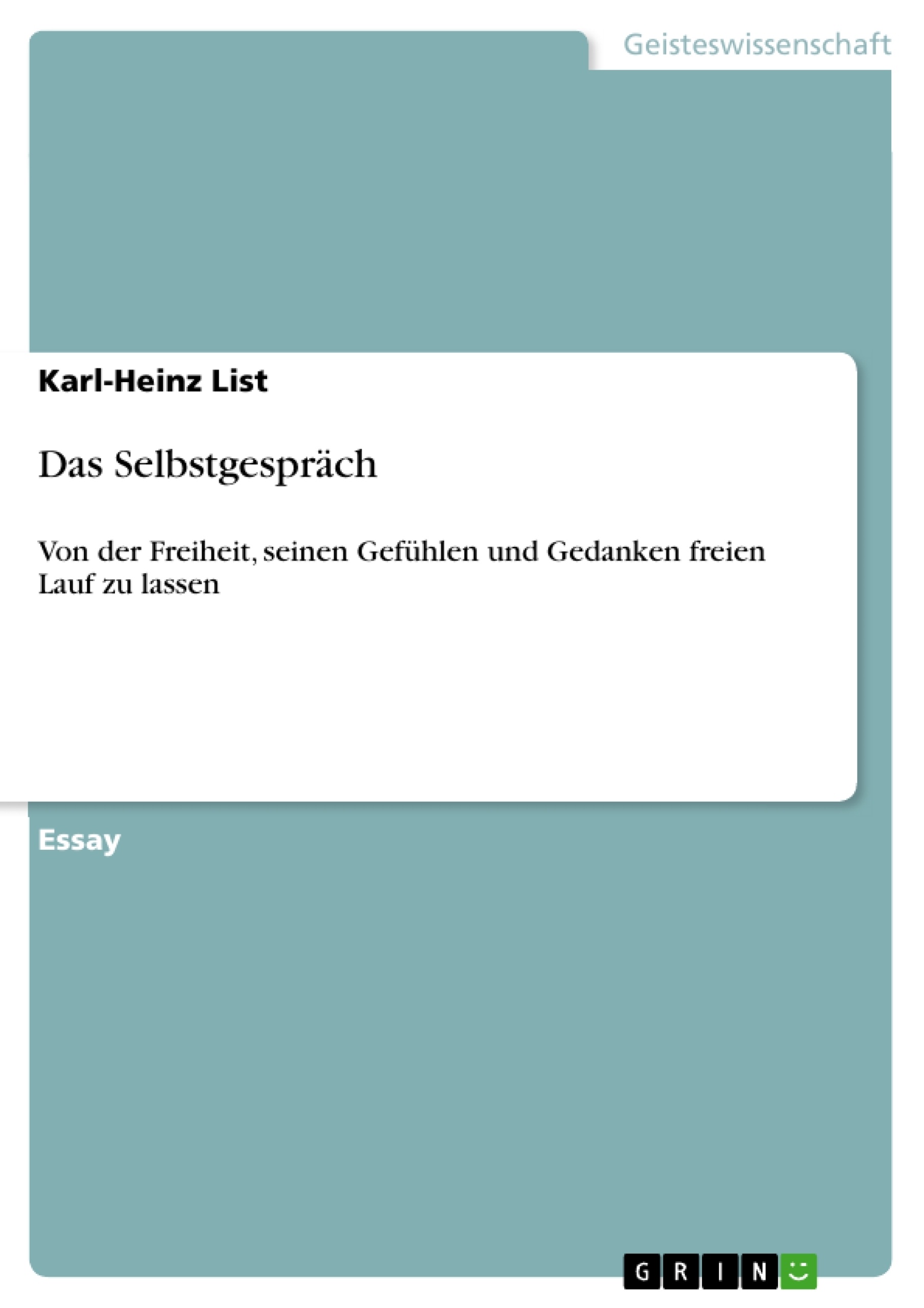Wir sprechen eigentlich immer mit uns selbst, ohne dass es uns bewusst ist. Das erinnert mich an den Satz des Psychologen Paul Watzlawik, den er über Kommunikation geschrieben hat: „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Das gilt auch für das Selbstgespräch.
So zu reden, dass die Worte mit den Gedanken Hand in Hand gehen, gelingt, wenn überhaupt, nur im Selbstgespräch. Doch authentisch ist die Kommunikation deshalb nicht. Diesen Anspruch haben die Apologeten der Humanistischen Psychologie wie Carl Rogers oder Schulz von Thun. Im Selbstgespräch muss man nicht - wie bei der Zwei-Weg-Kommunikation - auf die Körpersignale achten, muss keinem Gesprächspartner Empathie und Wertschätzung entgegenbringen, Gefühle verbalisieren, Ich-Botschaften senden und Rückmeldungen geben.
Das Thema dieses Buches ist das bewusste Selbstgespräch. Hier ist die Rede von Gedanken und Gefühlen im Selbstgespräch, vom inneren Monolog und anderen Formen des Selbstgesprächs: Bücherlesen, Tagebüchern, Biografien, Romane, Gedichte, Theaterstücke.
In Selbstgesprächen können wir uns die Realität vom Halse halten, wie Woody Allen sagt: „Die Wirklichkeit verletzt dich pausenlos, sie ist ein extrem unerfreulicher Ort. Selbstgespräche sind meine Therapie.“
Im Selbstgespräch können wir die Welt neu erfinden: Wie sollte sie sein, diese Welt, in der ich leben will? Was müsste man tun, um diese Welt so zu verändern, dass man darin gut leben kann? Was würdest du tun, wenn du Macht hättest, das alles zu verändern? Jeder soll genug zu essen haben, ein Dach über dem Kopf, glückliche Beziehungen und Muße statt Arbeit. Denn „Arbeit stört beim Leben.“ wie Friedrich Nietzsche es ausdrückte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Freiheit des homo sapiens
- Von Brabblern, Grantlern und Kindern
- Wir sind alle Experten
- Die Freiheit und die ungeahnten Möglichkeiten
- Große Vorbilder: Die alten Griechen
- Die antike Philosophie als Lebensform
- Die Kyniker
- Diogenes von Sinope
- Epikur lebt
- Epikurs Philosophie
- Veränderung der Sicht aller Dinge
- Die „geistigen Übungen”
- Nur noch sich selbst gehören
- Langeweile
- Literarische Muster: Monologe
- Shakespeare Hamlet: Sein oder Nichtsein
- Goethes Faust I: Studierstube
- Kleists Abschiedsbrief
- Tagebuchschreiber
- Ulysses: Molly
- Schnitzlers Leutnant Gustl
- Beckett: Das letzte Band
- Thomas Bernhard: Das Leben in Monologen
- Die Dogmen
- Der Mensch ist gut
- Authentisch sein: Offen, ehrlich, echt
- Authentisch kommunizieren
- Besser kommunizieren mit Schulz von Thun
- Entscheidungsfindung: Das innere Team
- Muße
- Ein zeitgemäßes Thema
- Vom Recht auf Faulheit
- Muße: Nichts tun und mit sich selbst reden
- Ist Müßiggang aller Laster Anfang?
- Im Club der Müßiggänger
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch untersucht das bewusste Selbstgespräch als Methode zur Selbstfindung und Verbesserung der Lebensqualität. Es beleuchtet die historische und philosophische Perspektive des Selbstgesprächs, insbesondere im Kontext der antiken Philosophie, und analysiert literarische Beispiele innerer Monologe. Darüber hinaus werden aktuelle Ansätze wie positive Denkweisen und therapeutische Methoden im Zusammenhang mit dem Selbstgespräch betrachtet.
- Das Selbstgespräch als philosophische und literarische Praxis
- Die Rolle des Selbstgesprächs in der Selbstfindung und Persönlichkeitsentwicklung
- Vergleichende Analyse verschiedener Ansätze zum Selbstgespräch (antike Philosophie, Literatur, moderne Therapiemethoden)
- Der Einfluss des Selbstgesprächs auf Kommunikation und Entscheidungsfindung
- Die Bedeutung von Muße und innerer Ruhe für ein produktives Selbstgespräch
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des bewussten Selbstgesprächs ein und stellt die zentrale Frage nach der Natur und Bedeutung innerer Dialoge. Das Kapitel „Die Freiheit des homo sapiens“ untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Selbstreflexion. Im Kapitel „Große Vorbilder: Die alten Griechen“ werden die philosophischen Ansätze der Antike zur Selbstfindung und inneren Freiheit beleuchtet, insbesondere die Rolle des Selbstgesprächs bei Kynikern und Epikur. Das Kapitel „Literarische Muster: Monologe“ analysiert verschiedene literarische Beispiele von Monologen, die das Selbstgespräch veranschaulichen. Das Kapitel „Die Dogmen“ diskutiert den Einfluss von Idealen wie Authentizität auf die Selbstwahrnehmung und -darstellung. Das Kapitel „Muße“ thematisiert die Bedeutung von Ruhe und Selbstreflexion für das gelingende Selbstgespräch.
Schlüsselwörter
Selbstgespräch, innere Monologe, Philosophie, Antike, Selbstfindung, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Entscheidungsfindung, Muße, positive Denkweise, Therapie, Literatur.
- Arbeit zitieren
- Karl-Heinz List (Autor:in), 2011, Das Selbstgespräch, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/181350