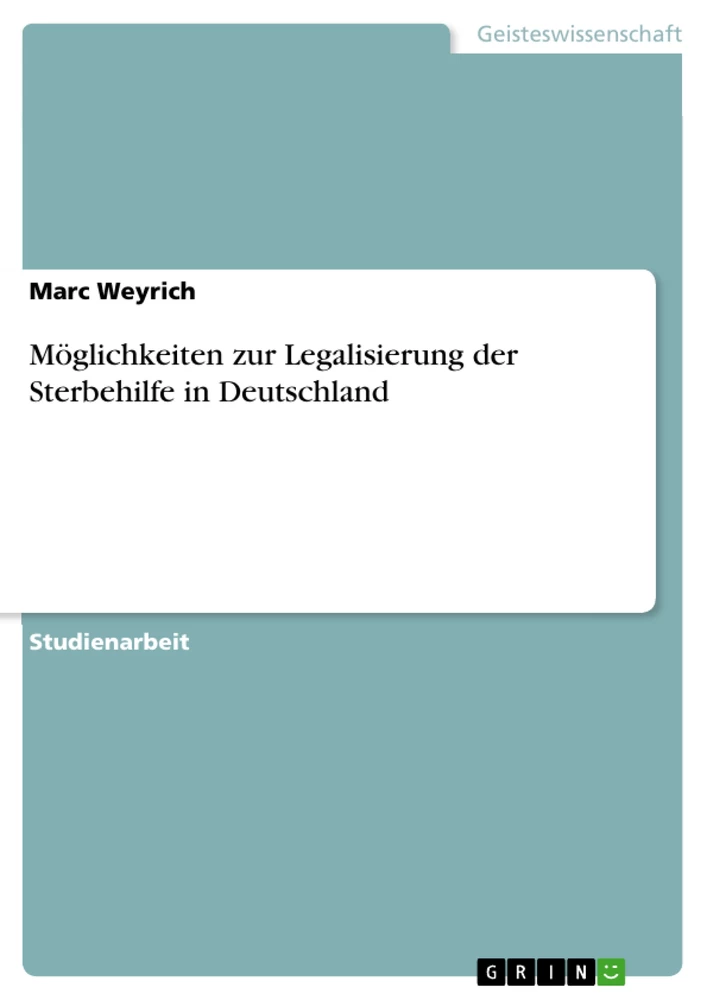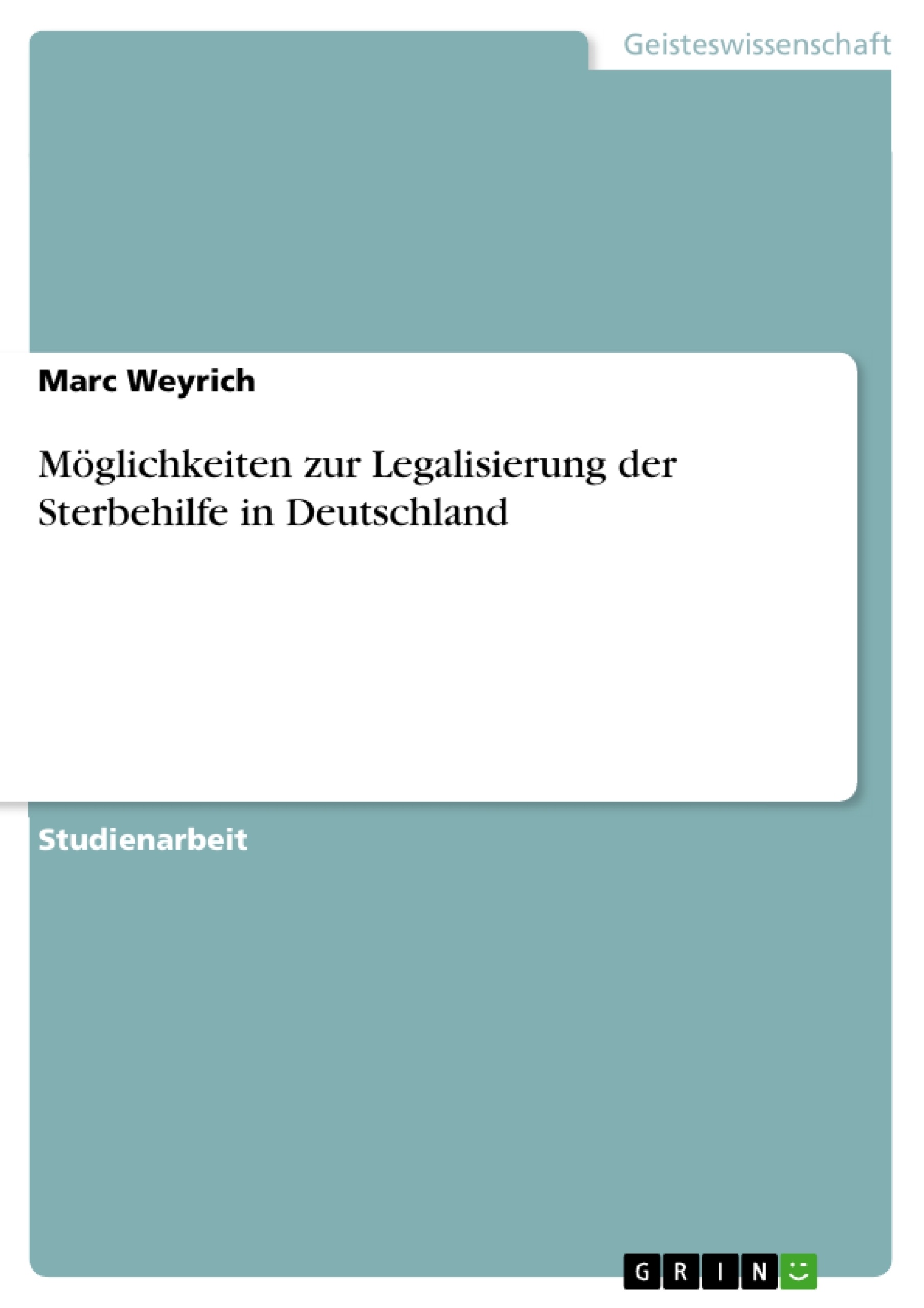Gibt es nicht ein Recht des Menschen auf einen Tod in Würde – im Zweifel durch die künstliche Herbeiführung des Todes zur Vermeidung unwürdigen Leidens? Was ist unwürdiges Leiden? Konterkariert die Tötung eines Menschen nicht in anderer Weise mit Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ – auf den in Bezug auf das mutmaßlich würdigere Sterben eines euthanasiewilligen Menschen verwiesen wird?
Was bedeutet nun Tod in Würde? Kann der gesunde Mensch sich erlauben, darüber zu urteilen, ob das Leiden des Sterbenden durch die Möglichkeiten der Palliativmedizin in einem Maß gelindert werden kann, das den Wunsch nach einer vorzeitigen Beendigung des Lebens unnötig macht? Oder ist es gar unmoralisch, wenn sich Kirche, Moraltheologen und Ärzte Behauptungen anmaßen, dass die Möglichkeiten der Palliativmedizin und der liebevollen Betreuung Sterbender ausreichend sind und Sterbehilfe nicht gefordert zu werden braucht.
Kann man als gesunder Mensch das Leiden eines Todkranken tatsächlich adäquat beurteilen – oder spielt man in einer solchen Rolle in ähnlicher Weise Gott, wie auch ein Arzt, der einem Todkranken das todbringende Medikament verabreicht? Gehen wir von einem christlichen Weltbild aus, so muss sich auch die Frage aufdrängen, ob nicht – im Sinne der vieldiskutierten Theodizee-Frage und der Annahme, dass der Herr uns eigene Entscheidungsmöglichkeiten im Rahmen seiner Schöpfung, beispielsweise durch die Schöpfung des Menschen mit den Möglichkeiten seines Verstandes – der Mensch eben auch von Gott gegeben nicht nur die Freiheit, sondern medizinisch eben auch die Möglichkeit zu töten hat; mindestens in bestimmten Situation?
Oder legen wir die Theologie zu Grunde, dass Gott das Leben eines jeden Menschen lenkt und führt: Führt er dann nicht auch im Zweifel die Hand des Arztes, der die todbringende Spritze setzt, oder die Todespille verabreicht? Wäre dann nicht Sterbehilfe auch ein Teil des Werkes Gottes, bzw. Teil des göttlichen Planes eines jeden Menschen?
Die folgende Hausarbeit soll unter Beachtung der Gesichtspunkte einer theologisch-ethischen Entscheidungsfindung erläutern, ob und unter welchen Bedingungen Sterbehilfe in Deutschland möglich – und nötig – wäre.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Begriffsdefinition
- aktive Sterbehilfe
- passive Sterbehilfe
- indirekte Sterbehilfe
- Hilfe zum Sterben oder Hilfe im Sterben?
- Positionen in Geschichte, Gesellschaft und Kirche
- Ein Versuch der Lösungsfindung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der ethischen Vertretbarkeit der Legalisierung aktiver Sterbehilfe bzw. Freitodhilfe in Deutschland. Sie analysiert die verschiedenen Formen der Sterbehilfe und untersucht die Argumente für und gegen eine Legalisierung im Kontext der deutschen Rechtsordnung und ethischen Prinzipien.
- Definition und Abgrenzung der verschiedenen Formen der Sterbehilfe
- Rechtliche und ethische Aspekte der Sterbehilfe in Deutschland
- Die Rolle der Kirche und der Gesellschaft in der Debatte um die Sterbehilfe
- Mögliche Folgen einer Legalisierung der Sterbehilfe
- Die Bedeutung der Autonomie und Selbstbestimmung des Einzelnen im Kontext der Sterbehilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Sterbehilfe ein und stellt die Relevanz der Debatte in Deutschland dar. Sie beleuchtet die Entwicklungen in anderen Ländern, die bereits eine Legalisierung der Sterbehilfe vollzogen haben, und zeigt die kontroversen Positionen in der Gesellschaft auf.
Im Kapitel „Begriffsdefinition“ werden die verschiedenen Formen der Sterbehilfe – aktive, passive und indirekte Sterbehilfe – klar abgegrenzt und definiert. Die Unterschiede zwischen diesen Formen werden anhand von Beispielen erläutert, um ein besseres Verständnis für die Komplexität des Themas zu schaffen.
Das Kapitel „Hilfe zum Sterben oder Hilfe im Sterben?“ beschäftigt sich mit der Frage, ob Sterbehilfe als Hilfe zum Sterben oder als Hilfe im Sterben verstanden werden kann. Es werden die unterschiedlichen Perspektiven auf die Rolle des Arztes und die Bedeutung der Autonomie des Patienten in diesem Kontext beleuchtet.
Das Kapitel „Positionen in Geschichte, Gesellschaft und Kirche“ analysiert die historischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Positionen zur Sterbehilfe. Es werden die Argumente der verschiedenen Akteure, wie z.B. der Kirche, der Politik und der Medizin, dargestellt und kritisch betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die aktive Sterbehilfe, die passive Sterbehilfe, die indirekte Sterbehilfe, die Legalisierung der Sterbehilfe, die ethische Vertretbarkeit der Sterbehilfe, die Autonomie des Patienten, die Rolle des Arztes, die Positionen der Kirche und der Gesellschaft, die rechtlichen Rahmenbedingungen der Sterbehilfe in Deutschland, die Folgen einer Legalisierung der Sterbehilfe und die Bedeutung der Würde des Menschen im Kontext der Sterbehilfe.
- Quote paper
- Marc Weyrich (Author), 2008, Möglichkeiten zur Legalisierung der Sterbehilfe in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/180998