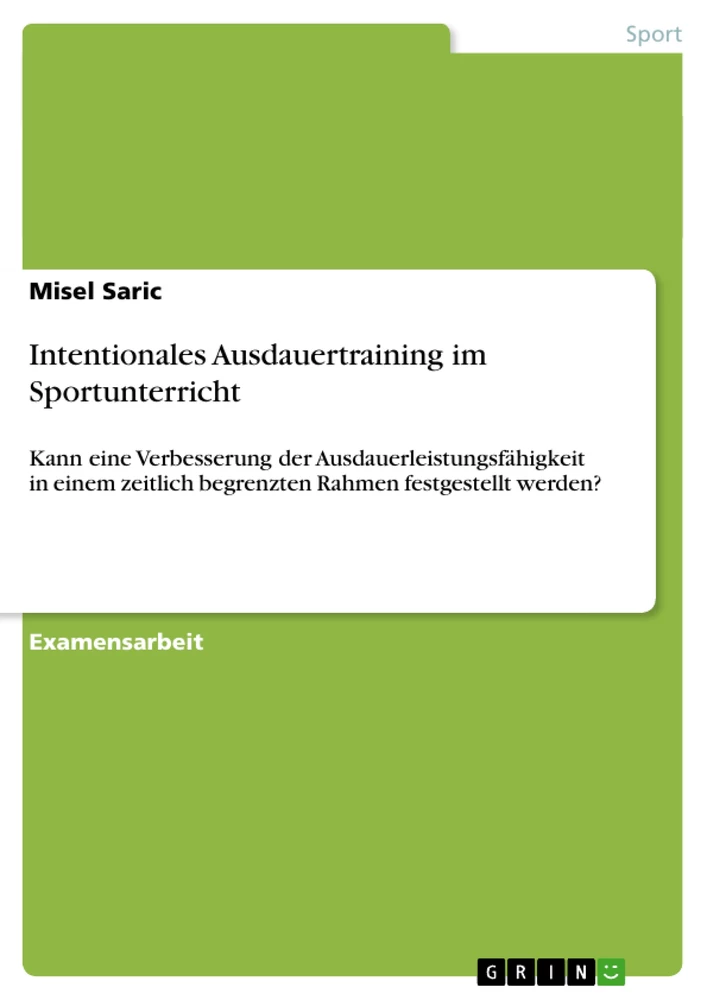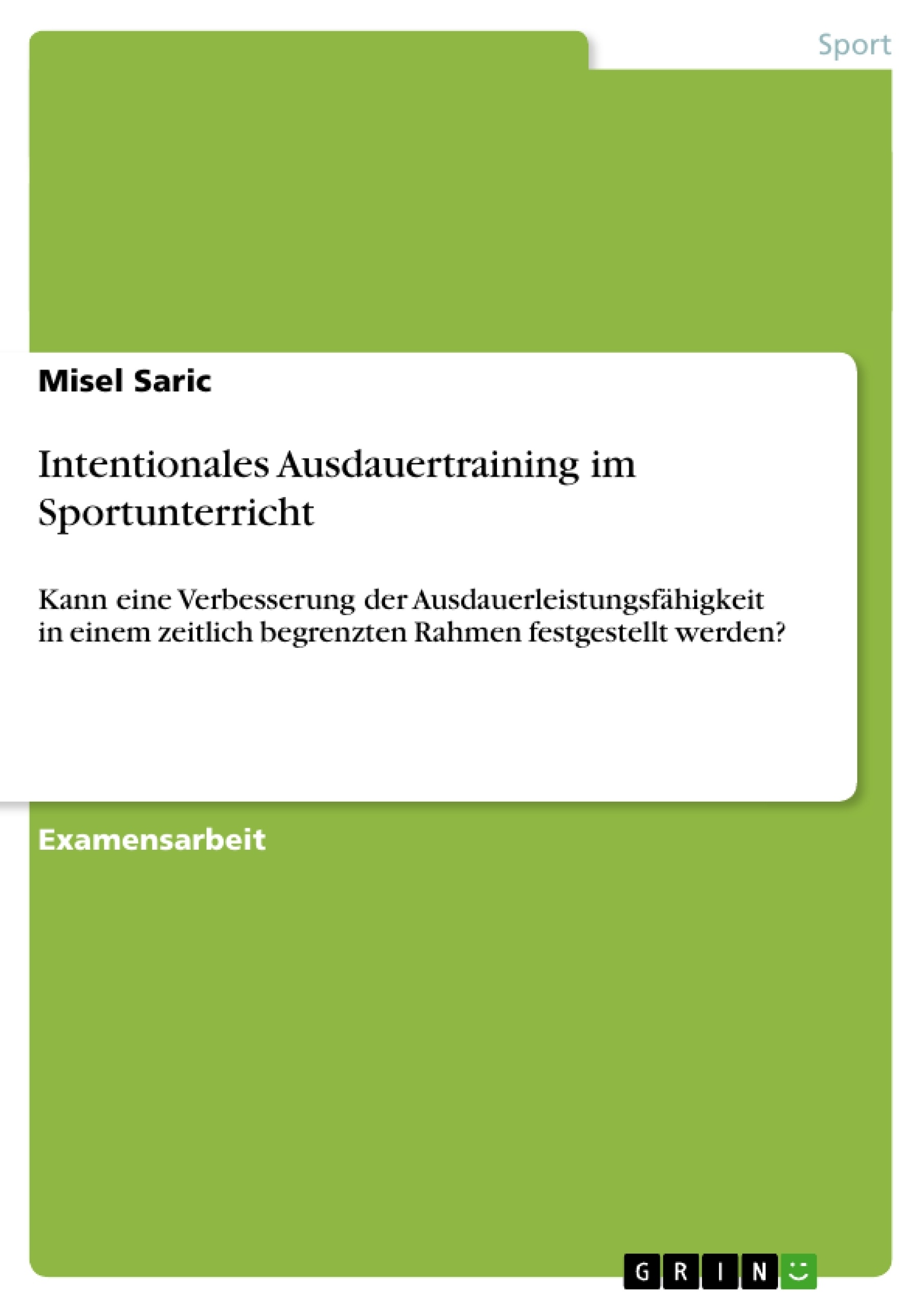Mein Schwerpunkt liegt auf dem Bereich der Sekundarstufe, speziell auf
Fünftklässlern einer Real- und einer Gymnasialklasse. Deshalb soll eine
Antwort auf die Frage gefunden werden, ob innerhalb eines sechswöchigen
Ausdauerprogramms von 15 Minuten zu Beginn in jeder Sportstunde eine
erkennbare Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit bei den Schülern
erzielt werden kann.
Meine wissenschaftliche Arbeit fand also in Zusammenarbeit mit drei Sportlehrern
statt. In diesem Zusammenhang waren sich auch die beteiligten
Personen nicht ganz einig, ob im Rahmen des Schulsports ein Training der
Ausdauerleistung geeignet ist und ob Effekte sichtbar werden können.
Deshalb möchte ich anhand meiner eigens durchgeführten empirischen
Studie ein Feedback über die Wirksamkeit der Ausdauertrainingsbausteine
erhalten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1. EINSTIEG IN DAS THEMA
- 1.2. ZIELSETZUNG DER ARBEIT
- 1.3. PERSÖNLICHER ANREIZ
- 1.4. AUFBAU DER WISSENSCHAFTLICHEN ARBEIT
- 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN DES AUSDAUERTRAININGS
- 2.1. SPORTLICHE LEISTUNG
- 2.2. SPORTMOTORISCHE AUSDAUER
- 2.3. DEFINITION AUSDAUER
- 2.4. ABGRENZUNG DER AUSDAUERLEISTUNGSFÄHIGKEITEN
- 2.4.1. Allgemeine und spezielle Ausdauer
- 2.4.2. Ausdauer nach Umfang der eingesetzten Muskulatur
- 2.4.3. Ausdauer nach vorrangigen Art der Energiebereitstellung
- 2.4.4. Ausdauer nach dem Zeitfaktor
- 2.4.5. Ausdauer nach der Arbeitsweise der Skelettmuskulatur
- 2.4.6. Ausdauer nach den motorischen Hauptbeanspruchungsformen
- 2.4.7. Zusammenfassung der unterschiedlichen Betrachtungsweisen
- 2.5. MECHANISMEN DER ENERGIEBEREITSTELLUNG UND VO2 MAX
- 2.5.1. Anaerober Energiestoffwechsel
- 2.5.2. Aerober Energiestoffwechsel
- 2.5.3. Aerobe und anaerobe Schwelle
- 2.5.4. VO2 max
- 2.6. DER BEGRIFF TRAINING
- 2.7. AUSDAUERTRAINING
- 2.8. TRAININGSWIRKUNG DURCH AUSDAUERTRAINING
- 2.9. ALLGEMEINE GESETZMÄSSIGKEITEN DES TRAININGS
- 2.9.1. Qualitätsgesetz
- 2.9.2. Homöostase und Superkompensation
- 2.9.3. Reizschwellengesetz
- 2.9.4. Verlauf der Leistungsentwicklung
- 2.9.5. Anpassungsfestigkeit
- 2.9.6. Trainierbarkeit
- 2.10. TRAININGSPRINZIPIEN
- 2.10.1. Prinzip des trainingswirksamen Reizes
- 2.10.2. Prinzip der progressiven Belastungen
- 2.10.3. Prinzip der optimalen Relation von Belastung und Erholung
- 2.10.4. Prinzip der unvollständigen Erholung
- 3. AUSDAUERFÄHIGKEIT IM KINDES- UND JUGENDALTER UND TRAINING IM RAHMEN DES SCHULSPORTS
- 3.1. LEGITIMATION DES KINDER- UND JUGENDTRAININGS
- 3.2. SPORTBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN VON KINDERN UND JUGENDLICHEN
- 3.2.1. Aerobe Leistungsfähigkeit
- 3.2.2. Anaerobe Leistungsfähigkeit
- 3.2.3. Geschlechtsspezifische Unterschiede
- 3.3. METHODIK DES AUSDAUERTRAININGS IM KINDER- UND JUGENDALTER
- 3.4. AUSDAUERTRAINING IN DER SCHULE
- 3.4.1. Aufgaben des Schulsports
- 3.4.2. Praktische Umsetzung für die Sportstunde
- 3.4.3. Bezug zum Bildungsplan
- 4. ZWISCHENFAZIT
- 5. DIE STUDIE
- 5.1. FORMULIERUNG DER FORSCHUNGSFRAGE
- 5.2. BILDUNG DER HYPOTHESEN
- 5.3. DAS UNTERSUCHUNGSSDESIGN
- 5.4. FESTLEGUNG DER STICHPROBEN
- 5.5. DIE UNTERSUCHUNG
- 6. TREATMENT
- 6.1. ABLAUF UND WICHTIGE HINWEISE
- 6.2. TRAININGBAUSTEINE
- 6.2.1. KW 18 „Die Eisenbahn“
- 6.2.2. KW 19 „Zeitschätzläufe“
- 6.2.3. KW 19 „Figurenlauf mit Musik“
- 6.2.4. KW 20 „Blindenhund“
- 6.2.5. KW 20 „Vierecks- bzw. Quadratläufe“
- 6.2.6. KW 21 „Hindernislauf“
- 6.2.7. KW 21 „Laufen mit Lösen von Denkaufgaben“
- 6.2.8. KW 22 „Umkehrläufe“
- 6.2.9. KW 22 „Dauerlauf“
- 6.2.10. KW 23 „Wiederholung“
- 6.3. SPORTSTUNDEN DER KONTROLLGRUPPE
- 7. DIE DATENERHEBUNG
- 7.1. DURCHFÜHRUNG SPORTMOTORISCHER TESTS
- 7.2. GÜTEKRITERIEN DER VERSCHIEDENEN TESTVERFAHREN
- 7.3. TESTS ZUR ERMITTLUNG DER DATENERHEBUNG
- 7.3.1. Cooper-Test
- 7.3.2. Conconi-Test
- 7.3.3. Shuttle-Run
- 7.4. TECHNIKEN UND MITTEL DER DATENERHEBUNG
- 7.4.1. T-Test und Signifikanzniveau
- 7.5. ORGANISATION UND DURCHFÜHRUNG DER DATENERHEBUNG
- 7.5.1. Messzeitpunkte
- 7.5.2. Durchführung des Shuttle-Run-Test
- 7.5.3. Schwierigkeiten
- 8. ERGEBNISSE BEI DER DATENAUSWERTUNG
- 8.1. DESKRIPTIVE STATISTIK
- 8.2. AUSGANGSNIVEAUS DER TG UND KG ZU BEGINN DES TREATMENTS
- 8.3. T-TEST BEI ABHÄNGIGEN STICHPROBEN
- 8.3.1. Vergleich Prä- und Posttest
- 8.3.2. Vergleich Post- und Nachhaltigkeitstest
- 8.4. ÜBERPRÜFUNG DER AUFGESTELLTEN HYPOTHESEN
- 8.5. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE
- 9. INTERPRETATION DER ERGEBNISSE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit durch intensives Ausdauertraining im Sportunterricht über einen begrenzten Zeitraum. Ziel ist es, wissenschaftlich fundiert zu überprüfen, ob sich innerhalb dieses Zeitrahmens messbare Verbesserungen feststellen lassen.
- Auswirkungen von Ausdauertraining auf Kinder und Jugendliche
- Methodische Ansätze des Ausdauertrainings im Schulsport
- Messung und Bewertung der Ausdauerleistungsfähigkeit
- Analyse der Trainingswirkung anhand empirischer Daten
- Relevanz von Ausdauertraining für die körperliche Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema ein, erläutert die Zielsetzung der Arbeit – die Untersuchung der Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit durch intensives Ausdauertraining in einem begrenzten Zeitraum – und beschreibt den persönlichen Anreiz des Autors für die Thematik. Es skizziert den Aufbau der wissenschaftlichen Arbeit, der die theoretischen Grundlagen, den empirischen Teil und ein Fazit umfasst. Der Einstieg verdeutlicht die Relevanz von Ausdauerfähigkeit und die Notwendigkeit, diese gezielt im Schulsport zu fördern.
2. Theoretische Grundlagen des Ausdauertrainings: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert den Begriff Ausdauer, grenzt verschiedene Ausdauerleistungsfähigkeiten voneinander ab und erläutert die Mechanismen der Energiebereitstellung, insbesondere den aeroben und anaeroben Stoffwechsel. Es werden die Konzepte VO2 max, Trainingsprinzipien und allgemeine Gesetzmäßigkeiten des Trainings (Qualitätsgesetz, Homöostase, Superkompensation, Reizschwellengesetz etc.) eingehend behandelt. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der physiologischen Prozesse, die beim Ausdauertraining im Körper ablaufen und die Grundlage für die Trainingsgestaltung bilden.
3. Ausdauerfähigkeit im Kindes- und Jugendalter und Training im Rahmen des Schulsports: Dieses Kapitel befasst sich mit den sportbiologischen Grundlagen von Kindern und Jugendlichen im Hinblick auf Ausdauertraining. Es beleuchtet die Unterschiede zwischen der aeroben und anaeroben Leistungsfähigkeit und Geschlechtsspezifische Unterschiede. Die Legitimation von Kinder- und Jugendtraining wird begründet, und es werden methodische Ansätze für das Ausdauertraining in diesem Altersbereich im Kontext des Schulsports erörtert, einschließlich der Integration in den Bildungsplan und der Berücksichtigung der schulischen Aufgaben.
Schlüsselwörter
Ausdauertraining, Ausdauerleistungsfähigkeit, Schulsport, Kinder, Jugendliche, VO2 max, aerober und anaerober Energiestoffwechsel, Trainingsprinzipien, empirische Untersuchung, methodische Ansätze, Leistungsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur wissenschaftlichen Arbeit: Ausdauertraining im Schulsport
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen durch intensives Ausdauertraining im Sportunterricht über einen begrenzten Zeitraum. Es wird wissenschaftlich geprüft, ob innerhalb dieses Zeitraums messbare Verbesserungen der Ausdauerleistung erzielt werden können.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Auswirkungen von Ausdauertraining auf Kinder und Jugendliche, methodische Ansätze des Ausdauertrainings im Schulsport, Messung und Bewertung der Ausdauerleistungsfähigkeit, Analyse der Trainingswirkung anhand empirischer Daten und die Relevanz von Ausdauertraining für die körperliche Entwicklung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (mit Zielsetzung und Aufbau), Theoretische Grundlagen des Ausdauertrainings (Definitionen, Energiebereitstellung, Trainingsprinzipien), Ausdauerfähigkeit im Kindes- und Jugendalter und Training im Rahmen des Schulsports (sportbiologische Grundlagen, Methodik, Schulpraktische Umsetzung), Zwischenfazit, Die Studie (Forschungsfrage, Hypothesen, Untersuchungsdesign, Stichprobe), Treatment (Trainingsablauf, Trainingseinheiten), Datenerhebung (Tests, Methoden, Durchführung), Ergebnisse der Datenauswertung (deskriptive Statistik, T-Tests, Hypothesenprüfung), und Interpretation der Ergebnisse.
Welche theoretischen Grundlagen werden erläutert?
Die theoretischen Grundlagen umfassen Definitionen von Ausdauer und deren verschiedenen Facetten, die Mechanismen der Energiebereitstellung (aerob und anaerob), VO2 max, Trainingsprinzipien (z.B. progressiver Belastung, optimale Relation von Belastung und Erholung), und allgemeine Gesetzmäßigkeiten des Trainings (Qualitätsgesetz, Homöostase, Superkompensation, Reizschwellengesetz).
Welche Methoden der Datenerhebung werden eingesetzt?
Zur Datenerhebung werden verschiedene sportmotorische Tests verwendet, darunter der Cooper-Test, der Conconi-Test und der Shuttle-Run-Test. Die statistische Auswertung erfolgt mittels T-Tests zur Überprüfung der Hypothesen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse umfassen deskriptive Statistiken, Vergleiche von Prä- und Posttests sowie Post- und Nachhaltigkeitstests mithilfe von T-Tests bei abhängigen Stichproben. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Überprüfung der aufgestellten Hypothesen interpretiert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen basieren auf der Interpretation der empirischen Ergebnisse und befassen sich mit der Frage, ob und in welchem Umfang intensives Ausdauertraining im Schulsport zu einer messbaren Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit bei Kindern und Jugendlichen führt. Die Arbeit liefert Hinweise auf die Wirksamkeit und methodische Gestaltung von Ausdauertraining im schulischen Kontext.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ausdauertraining, Ausdauerleistungsfähigkeit, Schulsport, Kinder, Jugendliche, VO2 max, aerober und anaerober Energiestoffwechsel, Trainingsprinzipien, empirische Untersuchung, methodische Ansätze, Leistungsentwicklung.
- Quote paper
- Misel Saric (Author), 2011, Intentionales Ausdauertraining im Sportunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/180416