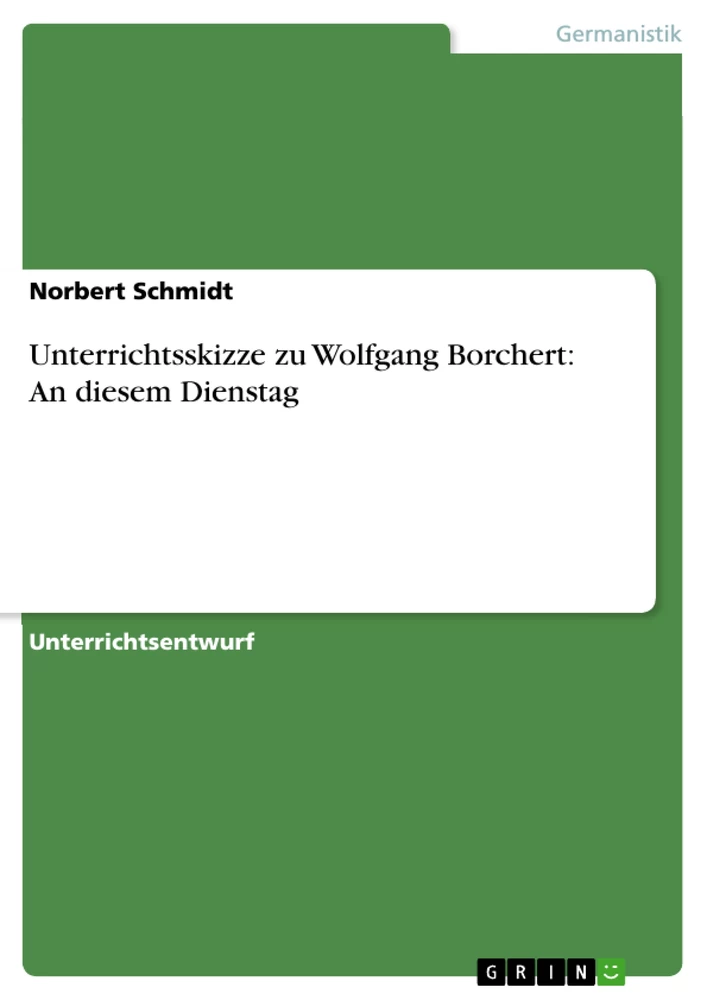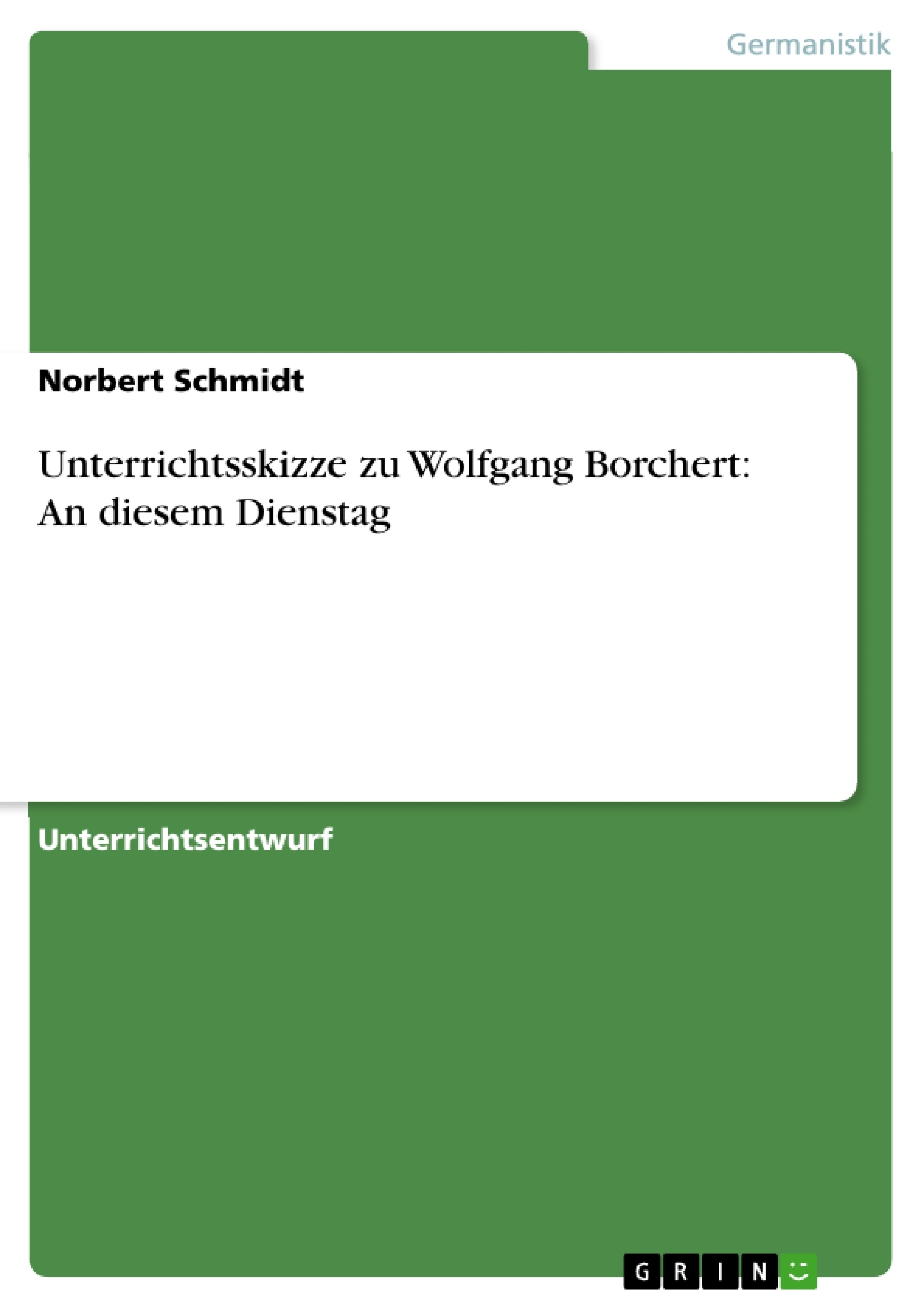Stundenentwurf zu Wolfgang Borcherts: An diesem Dienstag, beinhaltet: Sachanalyse, didaktische Analyse, Methodik
Sachanalyse
Gegenstand der Unterrichtsstunde soll die Kurzgeschichte „An diesem Dienstag“ von Wolfgang Borchert sein. Sie wurde 1947 veröffentlicht.
Borchert wurde 1921 geboren, veröffentlichte bereits 1938 einzelne Gedichte. Er nahm 1939 nach dem Abgang von der Oberrealschule eine Lehre in einer Buchhandlung auf und ließ sich nebenbei zum Schauspieler ausbilden. Das erste Mal eckte er 1940 an, indem er an literarischen Diskussionsabenden teilnahm, auf denen expressionistische Gedichte vorgetragen wurden, was ihm eine Nacht Haft bescherte. Er erhält ein Engagement an der Landesbühne Osthannover und spielt vorwiegend in zeitgenössischen Schwänken. Er wird 1941 einberufen, verliert auf einem Postengang den Mittelfinger, erkrankt an Diphtherie und Gelbsucht. Da ihm vorgeworfen wird, er habe sich selbst verstümmelt, kommt es zu einer Hausdurchsuchung, bei der ihn belastendes Material gefunden wird. Dieses trägt ihm drei Monate Einzeluntersuchungshaft ein. Er entgeht zwar der beantragten Todesstrafe, wird allerdings zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Auf eigenen Antrag wird das Urteil in sechs Wochen verschärften Arrest mit anschließender Frontbewährung umgewandelt, so daß er im November 1942 wieder an der Ostfront ist. Er trägt Erfrierungen an den Füßen davon wird mit Fleckfieberverdacht ins Seuchenlazarett Smolensk eingeliefert, von wo aus er die Gräber der bereits Gestorbenen sehen kann. Als er im Oktober 1943 neue Fieberanfälle und Leberbeschwerden bekommt, soll er wegen Dienstunfähigkeit zum Fronttheater abgestellt werden. Wegen einer Parodie auf Goebbels wird er erneut verhaftet und wartet neun Monate auf den Prozeß, welcher ihm neun Monate Haft einbringt, allerdings aufgeschoben wird zu Gunsten der Frontbewährung. Er flieht aus französischer Gefangenschaft 600 km nach Hamburg, wo er als Regieassistent arbeitet und sein Zimmertheater gründet. Er nimmt seine schriftstellerische Tätigkeit wieder auf. Bei einem Krankenhausaufenthalt gegen Ende des Jahres 1945 wird eine Leberentzündung diagnostiziert - eine Fehldiagniose, wie sich herausstellen wird. Die Leber ist aufgrund von Ernährungsmängeln bereits nahezu außer Funktion. Als sich sein Gesundheitszustand 1947 erneut verschlechtert, ermöglichen ihm Gönner eine Kur in der Schweiz, wo er jedoch an inneren Blutungen bald stirbt.
Borchert gilt als Exponent einer Blüte der deutschen Kurzgeschichte, welche etwa während der ersten zehn Nachkriegsjahre anzusetzen ist. Mitverursacht wurde diese Blüte jedoch auch durch das Hereinströmen ausländischer Literatur, besonders der amerikanischen short stories, mit denen die deutsche Kurzgeschichte aber nicht automatisch gleichgesetzt werden sollte. Hinsichtlich der deutschen Kurzgeschichte ist die Wissenschaft ohnehin uneins, welches die Kriterien der Abgrenzung, die Quellen ihrer Entwicklung seien.[1] Verhältnismäßig einig ist man sich aber über gewisse Grundkriterien, die für eine Einstufung als Kurzgeschichte sprechen können.
So ist immer wieder die Rede von:
Offenheit, unmittelbares Einsetzen und Enden der Geschichte
Kürze, stoffliche und sprachliche Verdichtung
Fehlen von Handlung, eher Skizze einer Momentaufnahme
Hauptfigur, um die alles durch ungewöhnliches Ereignis kreist
Exemplarizität durch Mehrdeutigkeit und Typisierung von Raum und Figuren
Sprache, sachlich, kühl, alltäglich, beiordnend, aber hintergründig.[2]
Die Kurzgeschichte scheint dem Mitteilungsbedürfnis der Schriftsteller nach dem Krieg am ehesten gerecht zu werden. Die Geschichten beschäftigen sich zunächst vorwiegend mit den leidvollen Erfahrungen des Krieges und der Not der Nachkriegszeit, zeigen aber schon bald eine inhaltliche Wandelbarkeit, die bis in die jüngste Vergangenheit anhält. Sie seien Seismographen der sozialen, politischen und allgemeinen menschlichen Verhältnisse, ihnen wohne die Kraft zu einer Anklage oder gar Waffe inne. Autoren von Kurzgeschichten schreiben, weil ihnen etwas nicht paßt. Dabei steht der Transport von Moral vor literarischem Ehrgeiz, obgleich sie die Gattung gegen Diskriminierung von außen durch literarische Qualität zu schützen wissen.[3]
In der vorliegenden Kurzgeschichte wird das Schicksal des Hauptmanns Hesse an einem bestimmten Tag fixiert. Dies geschieht in neun Episoden, welche abwechselnd Front- und Heimatgeschehen einblenden. Den Rahmen bildet die Schreibübung Ullas, welche den Tod u.a. des Hauptmanns vorausdeutet (Grube) und ihm Exemplarizität (wie oft habe ich das schon gesagt) verleiht. Gleichzeitig wird das erste Mal auf Beschränktheit im Blick des Einzelnen, auf Unterordnung des Individuellen unter das Korrekte verwiesen. Materiellen Ausdruck findet die eingeengte Sicht in der Brille der Lehrerin. Ähnlich dem verstellten Blick findet man eine gestörte Kommunikation und herunterspielendes, nicht adäquat erscheinendes Verhalten angesichts der vorhandenen Realität vor. Die Nachbarinnen reden tatsächlich aneinander vorbei - Frau Hesse feiert, als ihr Mann stirbt, womit auch formal eine Kommunikationsstörung bewußt wird.
[...]
[1] Vgl. hierzu Lange, S. 75-80; Nentwig, S. 7-10.
[2] Vgl. hierzu Nentwig, S. 14-19.
[3] Nach Wolfdietrich Schnurre in: Pelster, S. 96-98.
- Quote paper
- Norbert Schmidt (Author), 2003, Unterrichtsskizze zu Wolfgang Borchert: An diesem Dienstag, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/179699