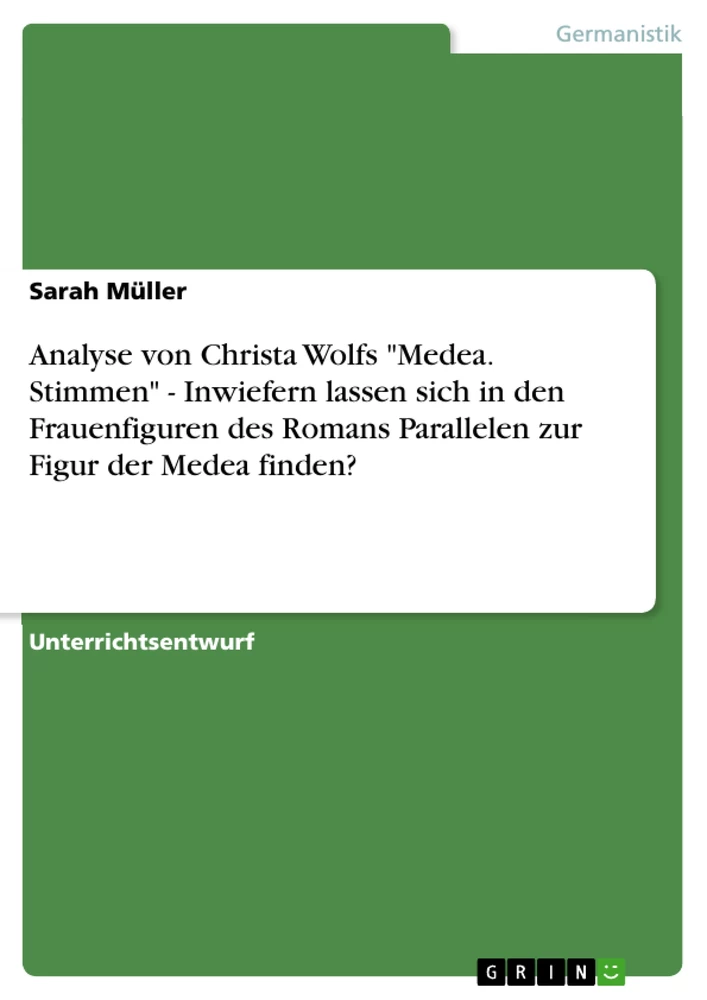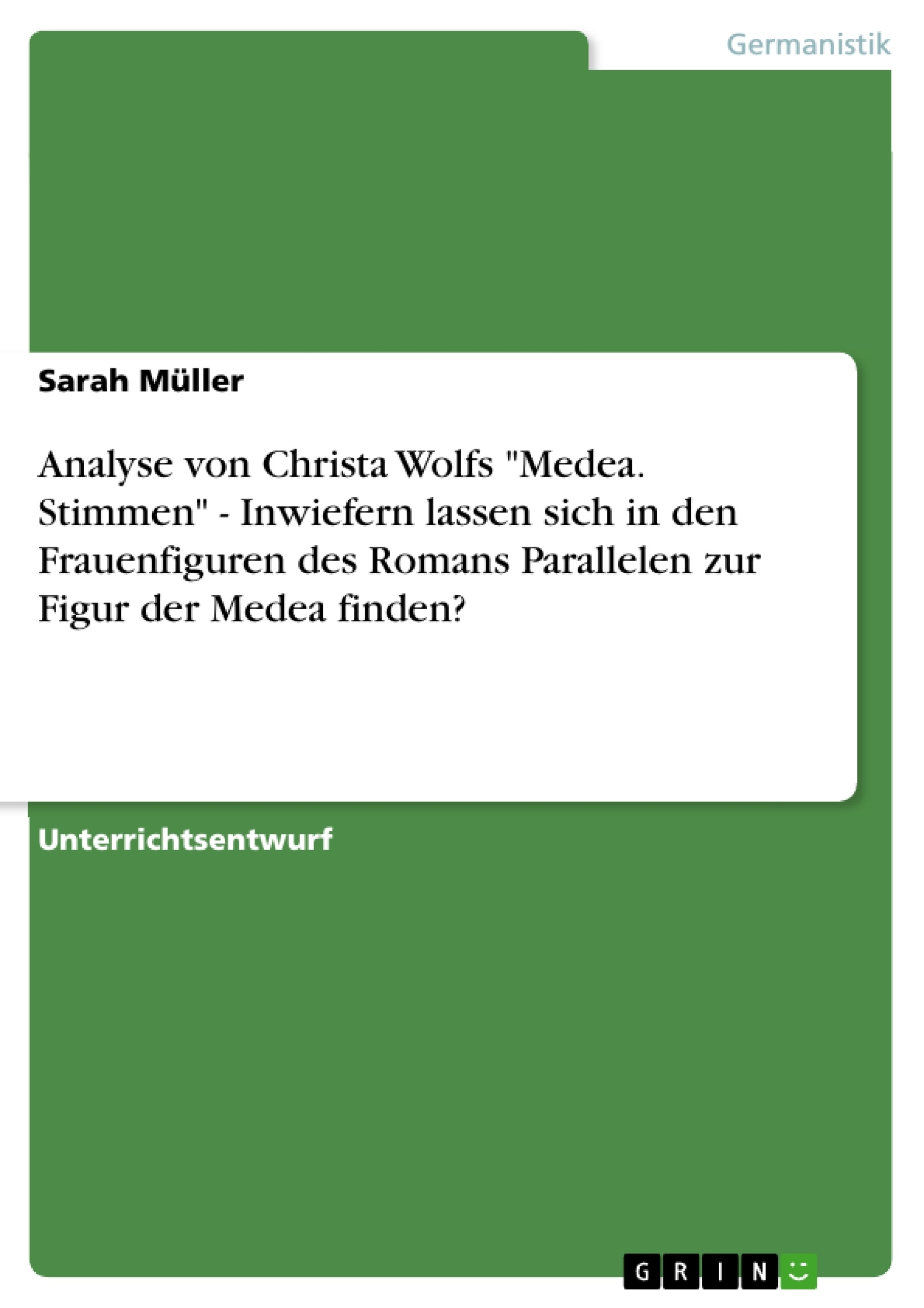Inwiefern lassen sich in den Frauenfiguren des Romans Parallelen zur Figur der Medea finden?
Die Schüler erarbeiten Eigenschaften der Frauenfiguren Glauke, Kirke, Lyssa, Agagameda und Arethusa, projizieren diese auf die Figure der Medea und erkennen, dass Wolf ein komplexes Frauenbild in ihrem Roman darstellt, das sich in der Protagonistin bündelt.
Inhaltsverzeichnis
- Lernbedingungen
- Lerngruppenbeschreibung
- Lernvoraussetzungen – Lernausgangslage und Lernstand
- Didaktische Überlegungen
- Didaktische Begründung des Themas
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die Analyse des Romans „Medea. Stimmen“ von Christa Wolf im Kontext des Deutschunterrichts der 13. Jahrgangsstufe. Es soll untersucht werden, wie Wolf den Mythos der Medea umformuliert und ein differenziertes Frauenbild präsentiert. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Hauptfigur und ihrer Beziehung zu anderen weiblichen Charakteren im Roman.
- Reformulierung des Medea-Mythos
- Differenziertes Frauenbild in Christa Wolfs Roman
- Analyse der Machtstrukturen in Kolchis und Korinth
- Vergleichende Betrachtung verschiedener weiblicher Figuren
- Die Frage nach dem Humanum in der Darstellung der Geschlechter
Zusammenfassung der Kapitel
Lernbedingungen: Dieses Kapitel beschreibt die Lerngruppe, bestehend aus zehn Schülerinnen und zwei Schülern der 13. Jahrgangsstufe, deren Leistungsstand und Arbeitsverhalten. Es werden sowohl leistungsstarke als auch schwächere Schüler*innen beschrieben und individuelle Lernbedürfnisse und Herausforderungen benannt. Die Vorerfahrungen der Schüler*innen mit Textinterpretationsmethoden und dem Kontext des Medea-Mythos werden beleuchtet. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der didaktischen Entscheidungen im weiteren Verlauf des Unterrichtsentwurfs. Es wird deutlich, dass die Lerngruppe ein heterogenes Bild abgibt und verschiedene methodische Ansätze erfordert, um alle Schüler*innen effektiv einzubinden.
Didaktische Überlegungen: In diesem Kapitel wird die didaktische Begründung des Themas und die Wahl des Romans „Medea. Stimmen“ von Christa Wolf im Deutschunterricht erläutert. Es wird hervorgehoben, dass Wolfs Interpretation des Mythos eine neue Perspektive auf die Figur der Medea bietet und sich mit zeitgenössischen Fragen der Geschlechtergleichstellung auseinandersetzt. Die Auswahl des Romans wird mit dem hessischen Lehrplan in Verbindung gebracht, der die Bearbeitung von Mythen und deren Reformulierung vorsieht. Das Kapitel unterstreicht die Relevanz des Romans für den Unterricht und die Möglichkeiten, die er bietet, um kritische Auseinandersetzung mit Frauenbildern und Geschlechterrollen zu fördern.
Schlüsselwörter
Medea, Christa Wolf, Mythos, Reformulierung, Frauenbild, Patriarchat, Matriarchat, Geschlechtergleichstellung, Textinterpretation, Interpretationsmethoden, Charakterisierung, Humanum.
Häufig gestellte Fragen zu "Medea. Stimmen" Unterrichtsentwurf
Was ist der Gegenstand dieses Unterrichtsentwurfs?
Der Unterrichtsentwurf analysiert Christa Wolfs Roman „Medea. Stimmen“ im Kontext des Deutschunterrichts der 13. Jahrgangsstufe. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Hauptfigur Medea, ihrem Frauenbild und den Machtstrukturen im Roman.
Welche Ziele werden mit diesem Entwurf verfolgt?
Der Entwurf zielt darauf ab, die Reformulierung des Medea-Mythos durch Wolf zu untersuchen und ein differenziertes Frauenbild zu präsentieren. Es werden die Machtstrukturen in Kolchis und Korinth analysiert und verschiedene weibliche Figuren vergleichend betrachtet. Die Frage nach dem Humanum in der Darstellung der Geschlechter spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die wichtigsten Themen sind die Reformulierung des Medea-Mythos, das differenzierte Frauenbild in Wolfs Roman, die Analyse der Machtstrukturen, der Vergleich verschiedener weiblicher Figuren und die Frage nach dem Humanum im Kontext der Geschlechterdarstellung.
Wie ist der Unterrichtsentwurf strukturiert?
Der Entwurf beinhaltet Abschnitte zu den Lernbedingungen (Beschreibung der Lerngruppe, Lernvoraussetzungen), didaktischen Überlegungen (Begründung des Themas und der Romanwahl), Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffen.
Was wird unter "Lernbedingungen" beschrieben?
Dieser Abschnitt beschreibt die Lerngruppe (zehn Schülerinnen und zwei Schüler der 13. Jahrgangsstufe), ihren Leistungsstand, ihr Arbeitsverhalten und individuelle Lernbedürfnisse. Die Vorerfahrungen der Schüler*innen mit Textinterpretationsmethoden und dem Medea-Mythos werden ebenfalls beleuchtet.
Worauf konzentrieren sich die "Didaktischen Überlegungen"?
Dieser Abschnitt begründet die didaktische Wahl des Romans „Medea. Stimmen“. Es wird die Relevanz des Romans für den Unterricht und seine Eignung zur kritischen Auseinandersetzung mit Frauenbildern und Geschlechterrollen im Kontext des hessischen Lehrplans hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Entwurf?
Wichtige Schlüsselwörter sind Medea, Christa Wolf, Mythos, Reformulierung, Frauenbild, Patriarchat, Matriarchat, Geschlechtergleichstellung, Textinterpretation, Interpretationsmethoden, Charakterisierung und Humanum.
Welche Kapitelzusammenfassungen sind enthalten?
Der Entwurf enthält Zusammenfassungen der Kapitel "Lernbedingungen" und "Didaktische Überlegungen", die die jeweiligen Inhalte detailliert beschreiben.
Für wen ist dieser Unterrichtsentwurf gedacht?
Dieser Unterrichtsentwurf richtet sich an Deutschlehrer*innen der 13. Jahrgangsstufe, die den Roman „Medea. Stimmen“ von Christa Wolf im Unterricht behandeln möchten.
Wie kann ich den vollständigen Unterrichtsentwurf erhalten?
Der vollständige Unterrichtsentwurf ist in dem bereitgestellten HTML-Dokument enthalten (siehe oben).
- Quote paper
- Sarah Müller (Author), 2011, Analyse von Christa Wolfs "Medea. Stimmen" - Inwiefern lassen sich in den Frauenfiguren des Romans Parallelen zur Figur der Medea finden? , Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/179524