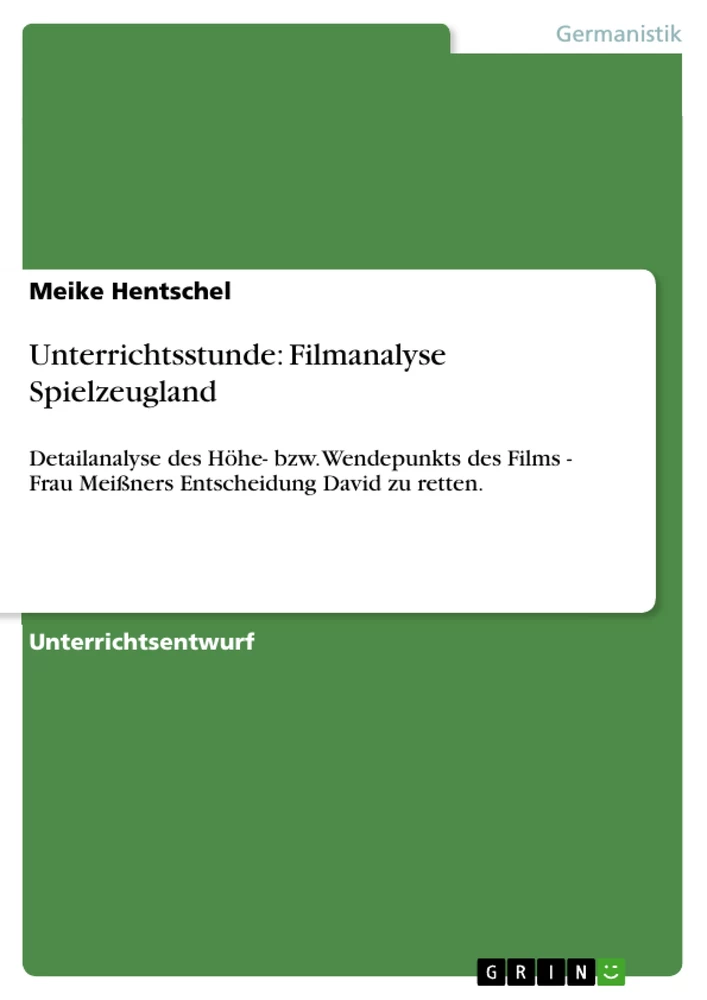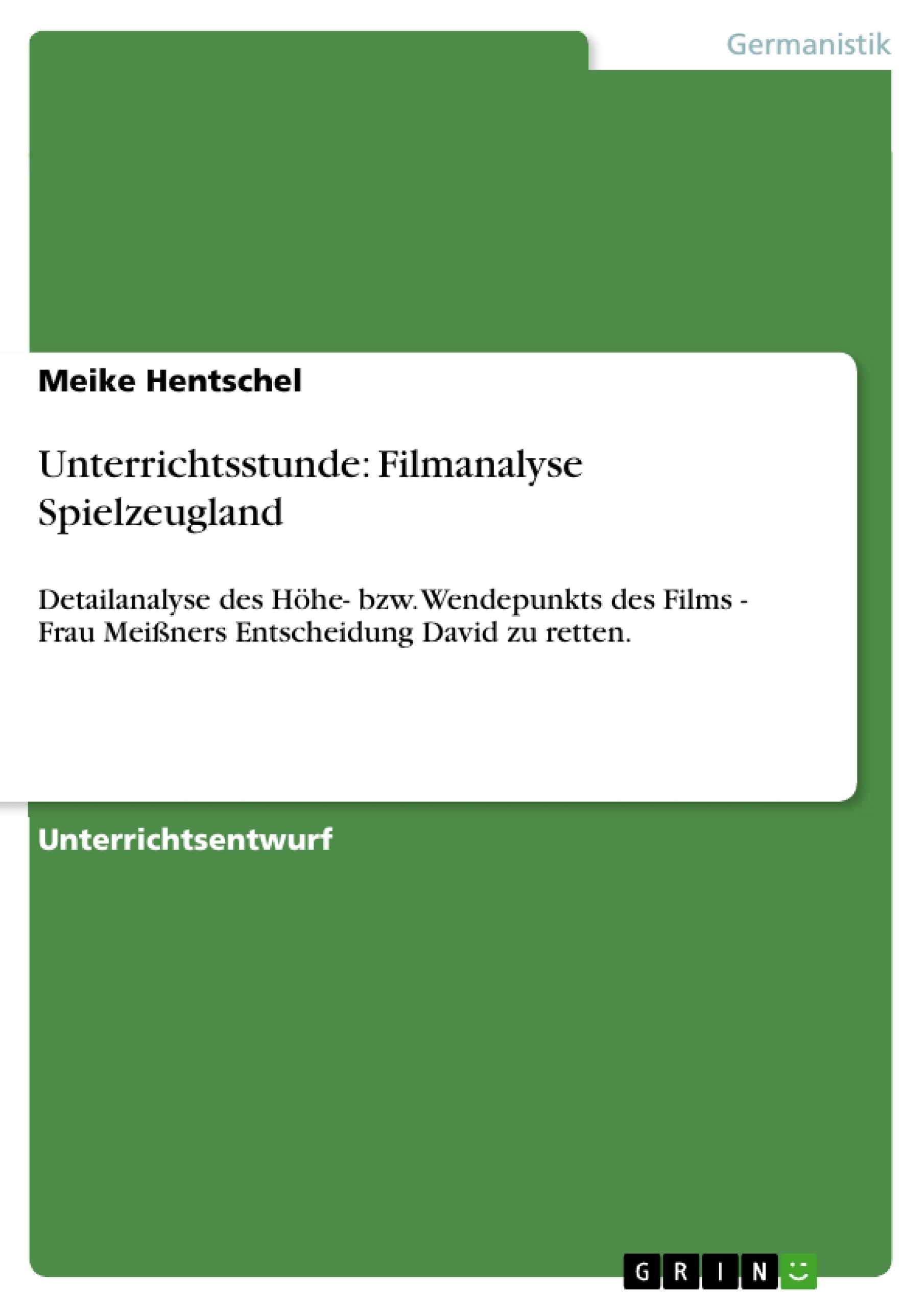Die SuS erkennen mit Hilfe der Analyse inhaltlicher und formaler Aspekte, dass die gezeigte Szene der Höhe- bzw. Wendepunkt des Films ist und einen Entscheidungsmoment für die deutsche Mutter darstellt. Sie erläutern und diskutieren die zentrale Frage des Films im Plenum.
Thema der Unterrichtsreihe:
Filmanalyse des Kurzfilms „Spielzeugland“ von Jochen Alexander Freydank, als Beispiel für einen medienreflexiven Deutschunterricht.
Thema der Unterrichtsstunde:
Detailanalyse des Höhe- bzw. Wendepunkts des Films - Frau Meißners Entscheidung David zu retten.
Einordnung der Stunde in die Unterrichtsreihe:
Intention der Unterrichtsstunde:
Die SuS erkennen mit Hilfe der Analyse inhaltlicher und formaler Aspekte, dass die gezeigte Szene der Höhe- bzw. Wendepunkt des Films ist und einen Entscheidungsmoment für die deutsche Mutter darstellt. Sie erläutern und diskutieren die zentrale Frage des Films im Plenum.
Lernziele
Die SuS sind in der Lage ihr Wissen abzurufen und anzuwenden, indem sie die in dieser Szene eingesetzten Gestaltungsmittel des Films beschreiben und ihre rezeptionslenkenden Wirkung erkennen. Sie können kooperativ arbeiten, indem sie in Gruppenarbeit ihre Ergebnisse austauschen und sich auf zentrale Gedanken der Filmanalyse einigen. Die SuS erkennen den in der Szene deutlich werdenden Konflikt der Hauptcharaktere, indem sie die Haltung der Protagonisten bezüglich ihrer Beziehung in eigene Worte fassen und die unterschiedlichen Positionen im Plenum diskutieren. Sie erkennen die Funktion der gezeigten Szene im Gesamtkontext des Films, indem sie die Szene in die Makrostruktur des Films einordnen, erkennen, dass sie einen Höhe- bzw. Wendepunkt des Films darstellt und die zentrale Frage des Films aufwirft. Sie diskutieren diese Frage ebenfalls im Plenum.[1]
Zur Lerngruppe:
Ich hospitiere in dieser Jahrgangsstufe seit August 2009 und unterrichte sie seit Ende September. Die Lerngruppe besteht aus 4 Schülerinnen und 14 Schülern. Das Gruppenklima des Grundkurses ist noch nicht optimal, da sich die meisten SuS erst seit Beginn des Schuljahres kennen. Daher befinden sie sich noch in der Angleichungsphase. Jungen und Mädchen agieren in Partner- und Gruppenarbeiten jedoch relativ gut miteinander und liefern meistens detaillierte Ergebnisse, welche sie altersgemäß sicher präsentieren. Die Gruppe ist sehr heterogen, was sich primär in der sprachlichen Qualität der Schüleräußerungen zeigt. Einige SuS bleiben mit ihren Antworten oberflächlicher als andere. Gerade diese schwächeren SuS können ihre Aktivität im Unterricht erhöhen, wenn sie ihre Arbeit und ihre Ergebnisse zunächst innerhalb des Kurses (z. B. in Guppen- oder Partnerarbeit) entwickeln, vergleichen und/oder erweitern können, um somit mehr Sicherheit bezüglich ihrer Arbeitsergebnisse und gleichzeitig ihrer Beteiligung im Unterricht erlangen. Die Gruppenarbeit und die Schlussdiskussion im Plenum eignen sich daher gut für die Auswertung der heutigen Ergebnisse. Inhaltliche und formale Defizite können so allmählich ausgeglichen werden.
Sachanalyse
Laut der Richtlinien ist die Behandlung eines Films in der Sekundarstufe II obligatorisch. Mit Hilfe filmanalytischer Instrumentarien soll den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 11 der Funktionszusammenhang von Sprache, Bild und Musik in audiovisuellen Texten verständlich werden.[2] Das Medium Film soll den SuS in dieser Unterrichtsreihe als komplexer “Bild-Ton Teppich”[3] bewusst gemacht werden. Der Oskar-preisgekrönte Kurzfilm Spielzeugland eignet sich für die Filmanalyse in besonderer Weise, weil ihn seine außergewöhnliche Erzählstruktur mit Rückblenden und Gegenwartsdarstellungen, das Spiel mit den technischen Möglichkeiten des Films insgesamt und seine Leerstellen besonders für den Deutschunterricht interessant machen. Außerdem stellt er zentrale Fragen (Woher kann man wissen, was man zu wissen glaubt?) in einer fesselnden Art und Weise.
Die Szene vor dem Waggon ist eine Schlüsselzene für den gesamten Film. Hier fällt Frau Meißner die Entscheidung für den jüdischen Jungen und für ein Leben in Gefahr. Weder Bewegung der Kamera noch Musik oder harte Schnitte lenken von der Perspektive der deutschen Mutter und Familie Silberstein ab, die wir hier hautnah erleben. Die Szene tritt als Höhe- bzw. Wendepunkt bedeutsam aus dem Ganzen des Films heraus. Sie ist ästhetisch aufgeladen und kompositorisch zentral und eignet sich daher besonders für die heutige Stunde, auch wenn diese Bedeutsamkeit sich für einige SuS nicht unbedingt sofort vollständig erschließen lässt.
Zu diesem Unterrichtsvorhaben gibt es weder schriftliches noch gutes digitales Material. Eine Homepage (www.medienzentrum-kirchhain.net) bietet Arbeitshilfen an, die meines Erachtens teilweise falsch gedeutet werden.
Methodisch-didaktischer Kommentar
Im Mittelpunkt der heutigen Stunde steht die gezeigte Szene als Höhe- bzw. Wendepunkt des Films, die Untersuchung der filmischen Mittel und die Diskussion über die sich ergebende zentrale Frage des Films.
In der Darstellung des Verhaltens einer unbekannten Frau thematisiert der Film ein zentrales Problem der NS-Zeit: die Frage nach Verantwortung, die Frage nach Gut und Böse, die Frage nach menschlichem Verhalten, die Frage nach Ethik und Moral angesichts eines Unterdrückungsregimes. Diese Frage spitzt sich in der Entscheidung der deutschen Mutter zu, David als ihr eigenes Kind auszugeben. Dies birgt jedoch die Gefahr der Entlarvung durch die jüdischen Eltern, durch das Kind oder andere beteiligter Personen.
Indem der Regisseur die Protagonisten lediglich handeln und nicht sprechen lässt und durch entsprechende inhaltliche Situationen, entstehen Leerstellen im Film.
Es bedarf unterschiedlicher fachmethodischer Formen, um die Leerstellen zu füllen und über diese Problematik zu sprechen.
In der Einstiegsphase äußern sich die SuS zunächst spontan zu der bereits bekannten Szene um Auffälligkeiten festzuhalten, so dass jeder entsprechend seines ihm eigenen Wahrnehmungsschwerpunktes (inhaltlich, auditiv, visuell) angehalten ist, die subjektive Wirkung dieser Szene für sich zu erschließen. Wichtig ist die Verbindung aller Elemente, da filmisches Erzählen das mehrkanalige Wahrnehmen des Zuschauers fordert.
Da die SuS noch nicht sehr gut in der Lage sind, Begriffe zu abstrahieren, schreibt der Lehrer in der Spontanphase mit und wertet die Schülerergebnisse aus. Es ergeben sich mögliche Themenschwerpunkte für die Stunde, die mit den SuS gemeinsam besprochen werden.
Die folgende Erarbeitung dient dem verdeutlichen der filmischen Mittel und ihrer Funktion in dieser besonderen Szene. Durch die Form des “Think, (Pair), Share” erlangen die SuS mehr Sicherheit bezüglich ihrer Arbeitsergebnisse und gleichzeitig ihrer Beteiligung im Unterricht. Die Präsentation der Gruppenergebnisse folgt auf DIN A 4 Blättern an der Tafel, um alle Ergebnisse würdigen zu können.
Es ergibt sich ein Tafelbild, welches den Wendepunkt der Szene deutlicht macht und die zentrale Frage des Films aufwirft.
Die SuS versetzen sich in die Rolle der Mutter, die innerhalb von Sekunden die Entscheidung trifft, einen jüdischen Jungen aus dem Waggon vor dem Abtransport zu retten, obwohl sie ihren Sohn sucht. Die SuS nähern sich so der Szene aus ihrer subjektiven Rezeption heraus und können diese hinterfragen. Auf dieser Grundlage entsteht eine Diskussion über Frau Meißners Gedanken. Es wird noch einmal deutlich, dass es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten gibt, um die Leerstelle im Film zu füllen. Welchen Spielraum der Interpretation lässt uns diese Leerstelle? Welche Haltung der deutschen Mutter tritt in diesen Beipielen in der Vordergrund?
Die mutige, die leichtsinnige, die mütterliche, die menschliche?
Des weiteren geht es um die Übertragung dieser Szene auf die heutige Zeit, um einen Gegenwartsbezug herzustellen und die Frage nach Zivilcourage, Verantwortung, etc. zu diskutieren. Wieviel Verantwortung haben die deutschen Bürger damals gehabt/haben sie heute?
Die Sitzordnung in U–Form fördert das Gespräch, da die SuS in Augenkontakt miteiander treten können.
Durch eine Meldekette versuche ich mich als Lehrperson erst einmal zu entziehen, ggf. versuche ich mit Impulsfragen die Diskussion ein wenig zu lenken.
Eine erneute Auswertung ist in diesem Fallenicht mehr vonnöten, da es die Diskussion durch Hauptargumente zu sehr festlegen würde. Daher sollen die SuS zur eigenständigen Wiederholung, Vertiefung und Sicherung eine Rezeption über diese Szene schreiben.
Literatur
Abraham, U.: Film im Deutschunterricht. Klett/Kallmeyer Seelze/Velber 2009
Bienk, Alice: Filmsprache. Einführung in die interaktive Filmanalyse. Schüren-Verlag, Marburg 2008
Gast, W.: Grundbuch Film und Literatur. Einführung in die Begriffe und Methoden der Filmanalyse. Frankfurt am Main 1993
Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II – Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Deutsch. Hrsg. vom Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Frechen: Ritterbach Verlag GmbH 2006
Steinmetz, R.: Filme sehen lernen. Verlag Zweitausendeins, Ffm. 2005
Internetquellen
www.learn-line.nrw.de
Geplanter Unterrichtsverlauf:
Materialanhang
Arbeitsblätter
[...]
[1] Vgl. auch UpP der Filmanalyse „Lola rennt“ von Tom Tykwer
[2] Vgl.: Richtlinien S. 20
[3] Gast, W.: Grundbuch Film und Literatur. Einführung in die Begriffe und Methoden der Filmanalyse. Frankfurt am Main 1993. S. 7
- Quote paper
- Meike Hentschel (Author), 2009, Unterrichtsstunde: Filmanalyse Spielzeugland, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/179335